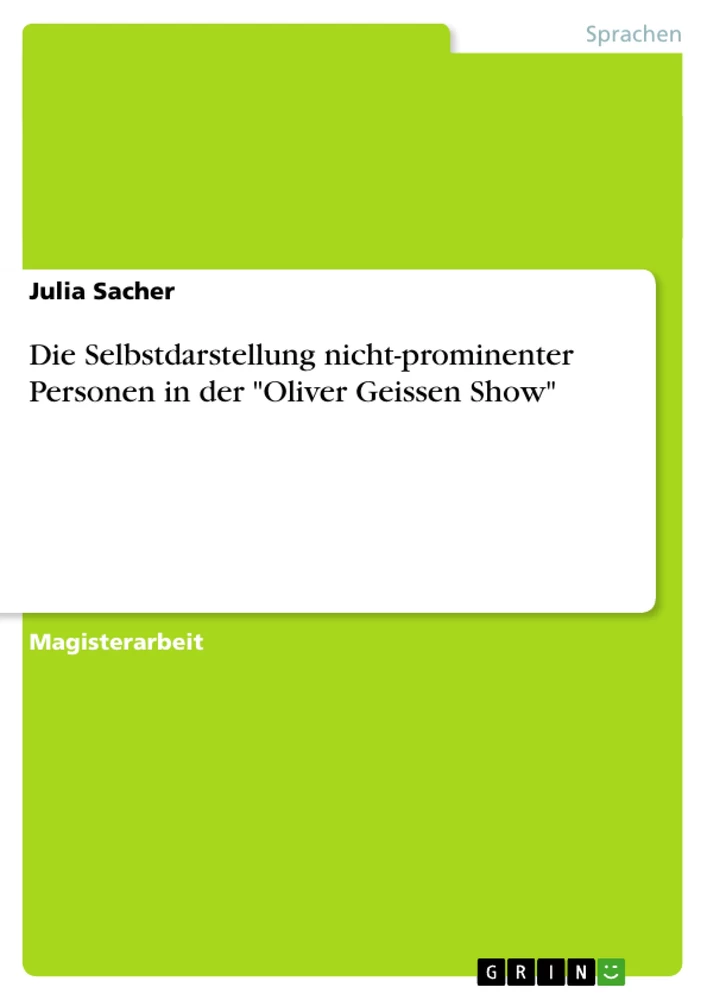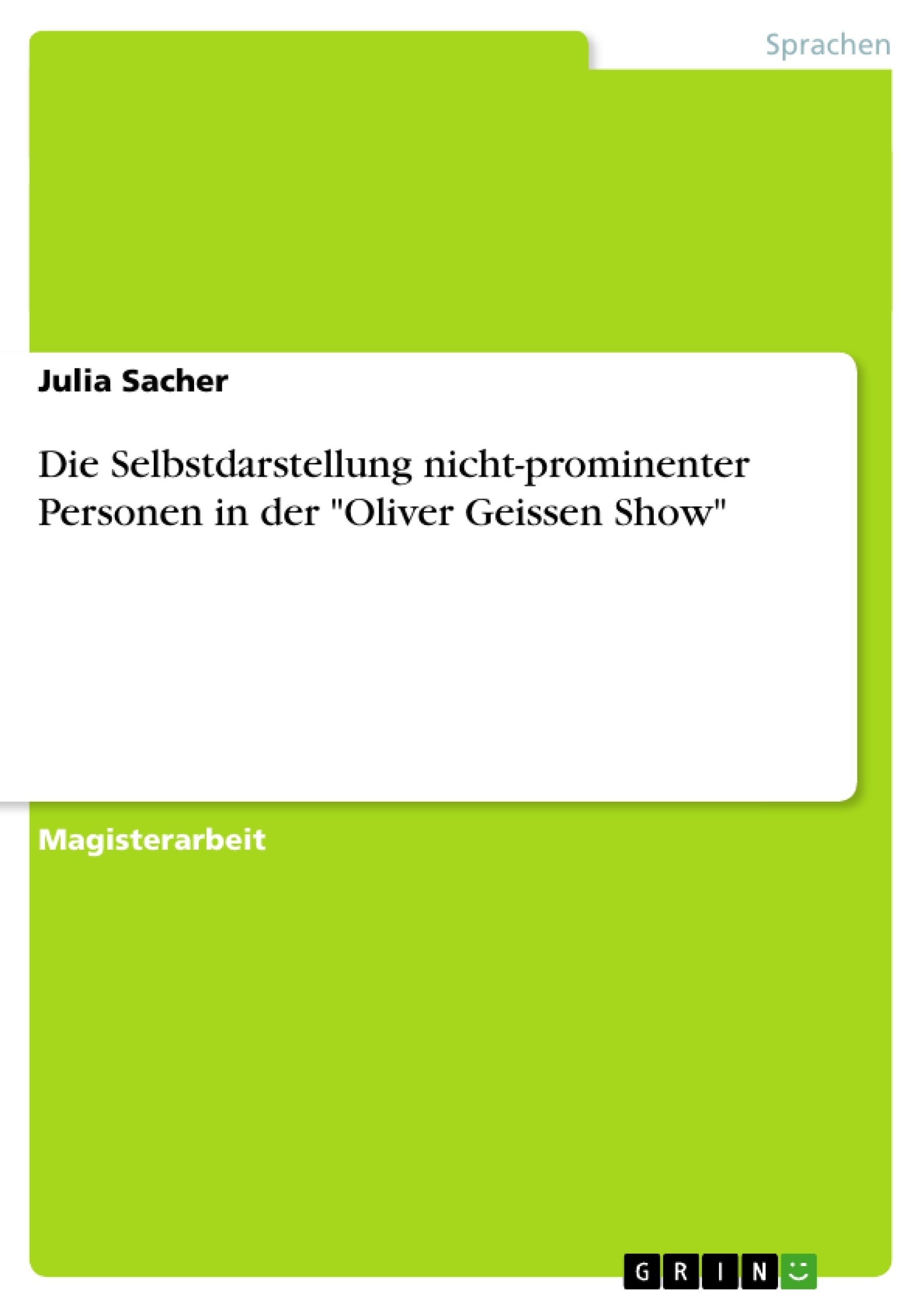Die Literatur zum Thema Talkshow entstammt einem heterogenen Forschungsfeld. Egal ob Psychologie, Soziologie, Medienpädagogik oder Linguistik – die Untersuchungen beschäftigen sich zwar mit formalen Charakteristika der Gattung, Auftrittsmotiven der Gäste oder rhetorischen Strategien der Moderatoren, die selbstdarstellerischen Aktivitäten der eingeladenen Personen wurden bislang nur selten untersucht. Dabei erscheint gerade dieses Verhalten interessant, denn in der biographischen Sendeform der Talkshow steht eindeutig die Person des Gastes im Mittelpunkt (vgl. MÜHLEN 1985, 184).
Da unprominente Personen das Medium Fernsehen an erster Stelle aus der Rezipientenperspektive kennen, beschränkt sich ihre Routine mit derart öffentlichen Situationen wie einem Fernsehauftritt konsequenterweise auf ein Minimum. Nicht – prominente Menschen sind für die Medien nur dann von öffentlichem Interesse, wenn eine besondere „Geschichte“ mit ihnen verbunden ist.
Nicht so in Talkshows: Hier stehen hauptsächlich die persönlichen Ansichten einer Person im Zentrum. Aufgrund des breit gefächerten Themenspektrums findet sich für jede Meinung das passende Thema, so dass prinzipiell jeder in einer Talkshow auftreten kann – so er denn will. Durch die ungewohnte Situation des Auftritts, der neben der Mehrfachadressierung der Kommunikation sicherlich auch auf einer psychischen Ebene durch individuelle Anzeichen von Nervosität geprägt ist, wird das Verhalten der Gäste beeinflusst. Die generelle Tendenz, sich vor anderen Personen möglichst positiv darzustellen, wird durch die extreme Öffentlichkeit der Auftrittssituation noch verstärkt.
Im Gegensatz zu Prominenten, die über Routine im Umgang mit Medien verfügen und deswegen in öffentlichen Auftritten auch nur eine für die Öffentlichkeit gedachte Facette ihrer Person zeigen, kann man bei Nicht – Prominenten davon ausgehen, dass sie sich in öffentlichen und nicht – öffentlichen Situationen tendenziell gleich verhalten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Selbstdarstellung
- 2.1. Symbolischer Interaktionismus und Identitätsentwicklung
- 2.1.1. Geste, Symbol, Sprache, Kommunikation
- 2.1.2. Identität und Gesellschaft
- 2.1.3. Gesellschaftswandel und Identitätsentwicklung
- 2.2. Rollenentwicklung und Rollenverhalten
- 2.3. Strategien der Selbstdarstellung
- 2.3.1. Definitionen
- 2.3.2. Der face - Begriff nach Goffman
- 2.3.3. Das Dramaturgische Modell der Eindruckssteuerung
- 2.3.4. Verbale Strategien
- 2.3.5. Nonverbale Strategien
- 3. Die Talkshow
- 3.1. Zur Sendeform
- 3.1.1. Historie
- 3.1.2. Formen
- 3.1.3. Charakteristika
- 3.2. Der unprominente TV-Gast
- 3.2.1. Die Rezipientenperspektive
- 3.2.2. Motive für einen TV-Auftritt
- 3.3. Gesprächssorten in Talkshows
- 3.3.1. Das Streitgespräch
- 3.3.1.1. Charakteristika von Streitgesprächen
- 3.3.1.2. Selbstdarstellung im Streit
- 3.3.2. Scherzkommunikation
- 3.3.2.1. Charakteristika von Scherzkommunikation
- 3.3.2.2. Selbstdarstellung durch Humor
- 3.3.2.3. Negativer Humor
- 3.4. Selbstdarstellung in Talkshows
- 3.4.1. Das Korpus
- 3.4.1.1. Das Format „Oliver Geissen Show“
- 3.4.1.2. Transkriptionskonventionen
- 3.4.2. Analysen
- 3.4.2.1. Martina
- 3.4.2.2. Vera
- 3.4.2.3. Cathy
- 3.4.2.4. Tamara
- 3.4.2.5. Inga
- 3.4.2.6. Sarah
- 3.4.2.7. Elke
- 3.4.2.8. Margarete und Monique
- 3.4.2.9. Dani
- Symbolischer Interaktionismus und Identitätsentwicklung
- Rollenentwicklung und Rollenverhalten in öffentlichen Situationen
- Strategien der Selbstdarstellung in Talkshows
- Analyse von Gesprächssorten in Talkshows, insbesondere Streitgespräche und Scherzkommunikation
- Linguistische Analyse von Transkripten aus der "Oliver Geissen Show"
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit analysiert die Selbstdarstellung nicht-prominenter Personen in der Talkshow "Oliver Geissen Show". Der Fokus liegt auf der Erforschung der Strategien und Mechanismen der Selbstpräsentation, die diese Personen in der ungewohnten Situation eines Fernsehauftritts anwenden. Die Arbeit untersucht, wie nicht-prominente Personen ihre Identität und ihre Selbstdefinition in einem öffentlichen und medial gesteuerten Kontext kommunizieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Selbstdarstellung, ausgehend vom symbolischen Interaktionismus und der Entwicklung von Identität. Es werden die Konzepte von face und der dramaturgischen Eindruckssteuerung vorgestellt, die die Strategien der Selbstdarstellung in sozialen Interaktionen erklären. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Talkshow als Genre, dem unprominenten Gast und den verschiedenen Gesprächssorten, die in dieser Sendeform vorkommen. Kapitel 3.4 beinhaltet die Analyse von Transkripten aus der "Oliver Geissen Show", wobei das Kommunikationsverhalten von verschiedenen Teilnehmerinnen untersucht und die eingesetzten Strategien der Selbstdarstellung herausgearbeitet werden.
Schlüsselwörter
Selbstdarstellung, Identitätsentwicklung, Symbolischer Interaktionismus, Talkshow, "Oliver Geissen Show", unprominente Personen, Gesprächssorten, Streitgespräch, Scherzkommunikation, verbale und nonverbale Strategien, face, dramaturgisches Modell der Eindruckssteuerung.
- Quote paper
- M.A. Julia Sacher (Author), 2006, Die Selbstdarstellung nicht-prominenter Personen in der "Oliver Geissen Show", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90117