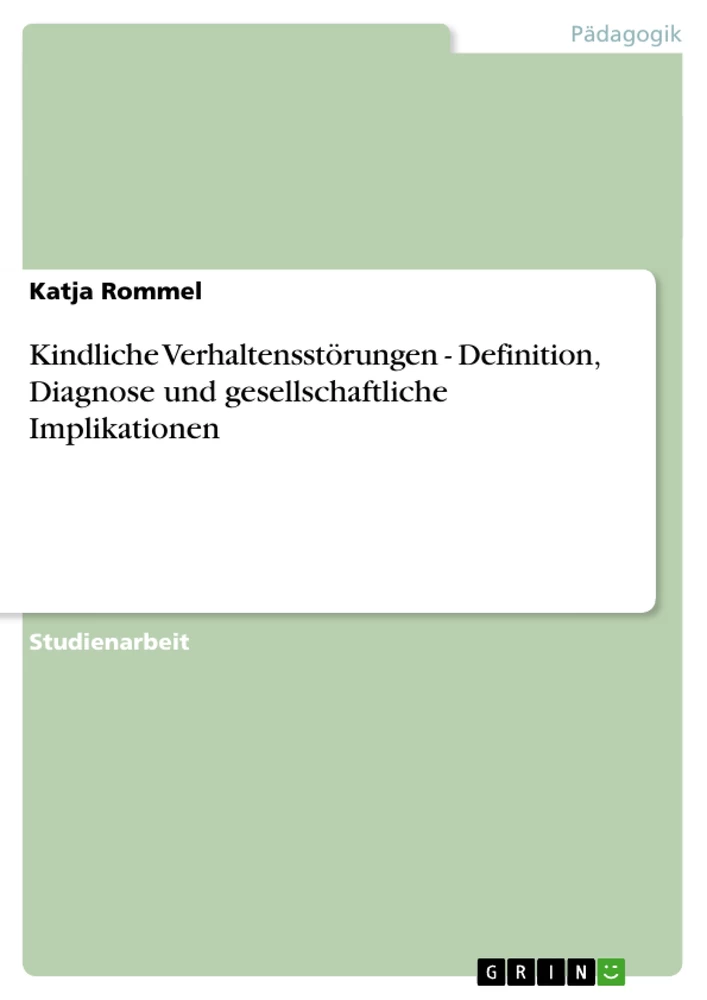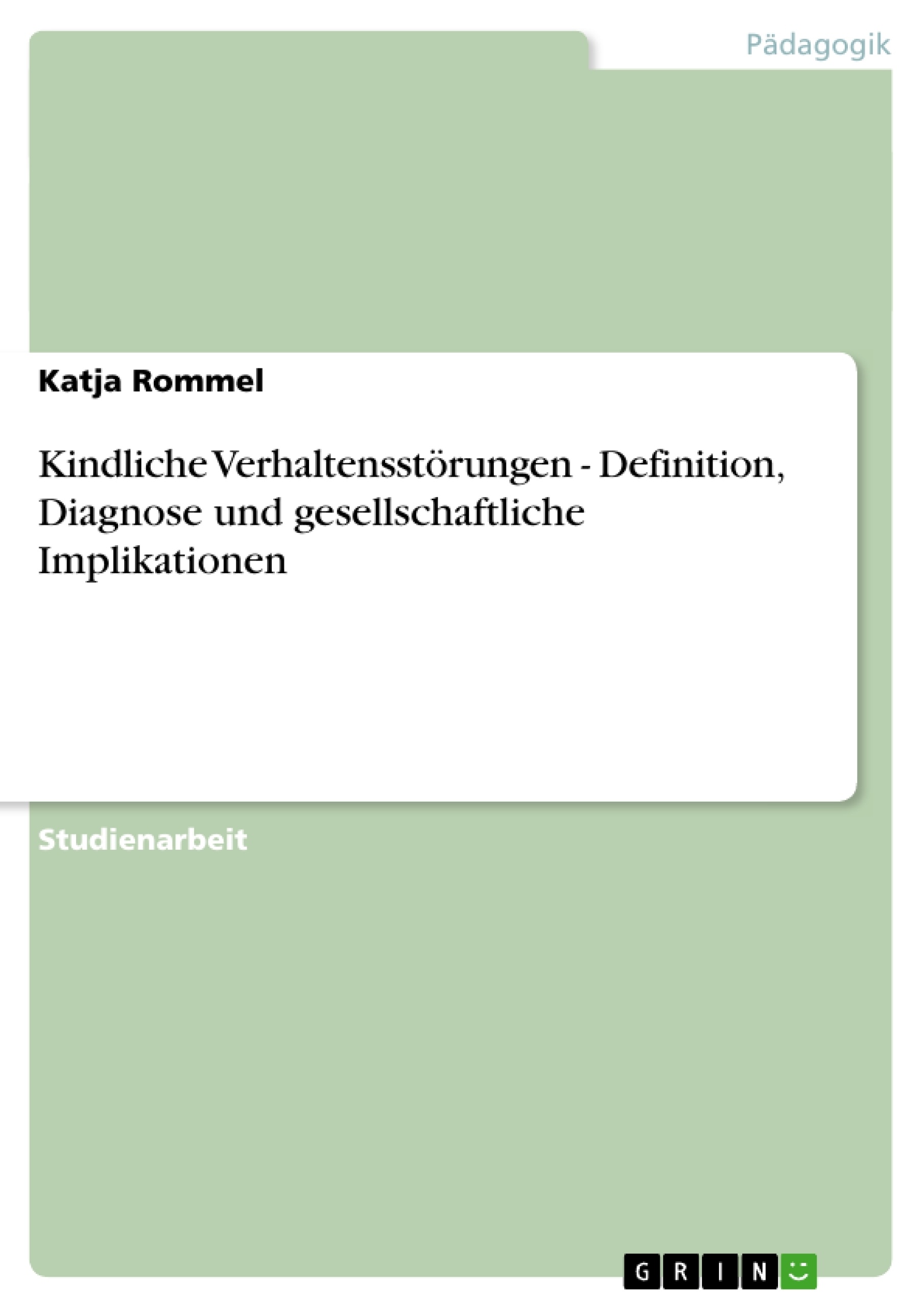Als Fachterminus für bestimmte Störungsbilder bei Kindern, Jugendlichen und He-ranwachsenden kennt man den Begriff der Verhaltensstörung erst seit 1950, als er auf einem Kongress für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Paris in das Fachvokabular eingeführt wurde (vgl. Hillenbrand 2006, 31).
Auch wenn man angesichts mancher Medienberichte und politischer Fensterreden zu der irrigen Auffassung gelangen könnte, Verhaltensstörungen seien erst in die Welt gekommen, als der Fernseher und die Computerspielkonsole das Kinderzimmer eroberten, kennt man das Phänomen, die typischen Erscheinungsbilder dessen, was auch de Laien als „Verhaltensstörung“ geläufig ist, schon lange. Heinrich Hoffmann, ein Frankfurter Psychiater, hat schon 1845 die entsprechenden Störungsbilder beschrieben: Sie alle stammen, ebenso wie der „böse Friedrich“, der „Daumenlutscher“, „das Paulinchen mit den Streichhölzern“ und weitere bekannte Charaktere aus dem berühmten Kinderbuch „Der Struwwelpeter“ (Abbildungen aus: Hoffmann 2002). Der Autor, Heinrich Hoffmann, kannte diese Störungsbilder aus seiner eigenen psychiatrischen Praxis. Den „Struwwelpeter“ hat er nicht als Fachliteratur verfasst, sondern als Weihnachtsgeschenk für seinen eigenen Sohn – vor mehr als 160 Jahren.
Versucht man zu definieren, was „Verhaltensstörungen“ sind, so nähert man sich diesem komplexen Begriff vernünftiger Weise, indem man zunächst die Frage stellt, was „Verhalten“ bedeutet: Dorschs Psychologisches Wörterbuch, gibt die Auskunft, es handele sich um die physische Aktivität eines Organismus, die beobachtbar und somit grundsätzlich objektiv messbar sei. Zu dieser Aktivität zähle man willkürliche und unwillkürliche Muskelbewegungen sowie Sprach- und Lautäußerungen. Eine bis dahin beruhigende Antwort, die jedoch alsbald einen neue Richtung einschlägt und den Leser mit der Unschärfe des Begriffs konfrontiert, denn es folgt der Hinweis, dass „Verhalten“ – im Sinne des Behaviorismus – auch ein Spiegel der innerpsychischen Vorgänge sei, weshalb auch innere Erlebnisprozesse, das Denken und Wollen zum Verhalten zu rechnen seien (vgl. Ries 1994, 846). Dass der Begriff der „Verhaltensstörung“ von einer Vielzahl definitorischer Fallstricke umgeben ist, über die zu straucheln man fortwährend Gefahr läuft, merkt man vollends, wenn man nunmehr zu bestimmen versucht, was den Unterschied von „nicht gestörtem Verhalten“ bzw. „normalem“ und „gestörtem Verhalten“ ausmacht.
Inhaltsverzeichnis
- I. Zum Begriff der „Verhaltensstörung“
- II. Diagnostische Kriterien für Verhaltensstörungen
- III. Gesellschaftliche Implikationen
- IV. Zur Frage der „Risikogruppen“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Begriff der kindlichen Verhaltensstörung. Ziel ist es, den historischen Kontext, diagnostische Kriterien und gesellschaftliche Implikationen zu beleuchten. Zusätzlich wird die Frage nach Risikogruppen thematisiert.
- Definition und historische Entwicklung des Begriffs „Verhaltensstörung“
- Diagnostische Kriterien und Klassifizierung von Verhaltensstörungen
- Gesellschaftliche Auswirkungen und Herausforderungen
- Identifizierung potentieller Risikogruppen
- Illustrative Beispiele aus der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
I. Zum Begriff der „Verhaltensstörung“: Der Begriff „Verhaltensstörung“ wird im Kontext von kindlichen, jugendlichen und heranwachsenden Störungsbildern erst seit 1950 verwendet, nachdem er auf einem Kongress in Paris in das Fachvokabular eingeführt wurde (vgl. Hillenbrand 2006, 31). Obwohl Medien und Politik oft einen modernen Ursprung suggerieren, ist das Phänomen der Verhaltensstörung an sich viel älter. Bereits 1845 beschrieb Heinrich Hoffmann entsprechende Störungsbilder, wie im „Struwwelpeter“ illustriert, der exemplarisch verschiedene Verhaltensauffälligkeiten anhand von Geschichten wie „Zappelphilipp“, „Hanns Guck-in-die-Luft“ und „Suppenkaspar“ darstellt. Diese frühen Beschreibungen bieten wertvolle Einblicke in die langjährige Auseinandersetzung mit dem Thema und zeigen die Kontinuität bestimmter Verhaltensmuster über die Zeit hinweg. Die Arbeit unterstreicht somit die historische Dimension des Phänomens und kontextualisiert den modernen Gebrauch des Begriffs.
Schlüsselwörter
Verhaltensstörung, kindliche Entwicklung, Diagnostik, Risikofaktoren, gesellschaftliche Implikationen, Heinrich Hoffmann, Struwwelpeter, Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS), Anorexia nervosa.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema kindlicher Verhaltensstörungen. Sie beleuchtet den Begriff der Verhaltensstörung historisch, beschreibt diagnostische Kriterien und analysiert gesellschaftliche Implikationen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Identifizierung potentieller Risikogruppen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Definition und historische Entwicklung des Begriffs „Verhaltensstörung“, diagnostische Kriterien und Klassifizierung von Verhaltensstörungen, gesellschaftliche Auswirkungen und Herausforderungen, Identifizierung potentieller Risikogruppen und illustrative Beispiele aus der Literatur. Die Kapitel befassen sich mit dem Begriff der Verhaltensstörung, diagnostischen Kriterien, gesellschaftlichen Implikationen und der Frage nach Risikogruppen.
Wie wird der Begriff „Verhaltensstörung“ historisch betrachtet?
Der Begriff „Verhaltensstörung“ im Kontext von kindlichen und jugendlichen Störungsbildern wird erst seit etwa 1950 verwendet. Die Arbeit zeigt jedoch, dass das Phänomen selbst viel älter ist und bereits 1845 von Heinrich Hoffmann in seinem Werk „Struwwelpeter“ beschrieben wurde, welches verschiedene Verhaltensauffälligkeiten illustriert.
Welche diagnostischen Kriterien werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt die diagnostischen Kriterien und die Klassifizierung von Verhaltensstörungen, jedoch ohne konkrete detaillierte Angaben zu den verwendeten Klassifikationssystemen. Es wird auf die Notwendigkeit der Diagnose und deren Kontext hingewiesen.
Welche gesellschaftlichen Implikationen werden diskutiert?
Die Arbeit untersucht die gesellschaftlichen Auswirkungen und Herausforderungen im Zusammenhang mit Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Konkrete Beispiele oder Auswirkungen werden jedoch nicht im FAQ genannt, sondern im Text selbst detailliert behandelt.
Welche Risikogruppen werden angesprochen?
Die Arbeit identifiziert potentielle Risikogruppen für Verhaltensstörungen, ohne jedoch spezifische Gruppen zu nennen. Die Identifizierung von Risikofaktoren ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Verhaltensstörung, kindliche Entwicklung, Diagnostik, Risikofaktoren, gesellschaftliche Implikationen, Heinrich Hoffmann, Struwwelpeter, Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS), Anorexia nervosa.
Gibt es Beispiele aus der Literatur?
Ja, die Arbeit enthält illustrative Beispiele aus der Literatur, insbesondere der Bezug auf Heinrich Hoffmanns „Struwwelpeter“ wird hervorgehoben.
- Quote paper
- Katja Rommel (Author), 2007, Kindliche Verhaltensstörungen - Definition, Diagnose und gesellschaftliche Implikationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90069