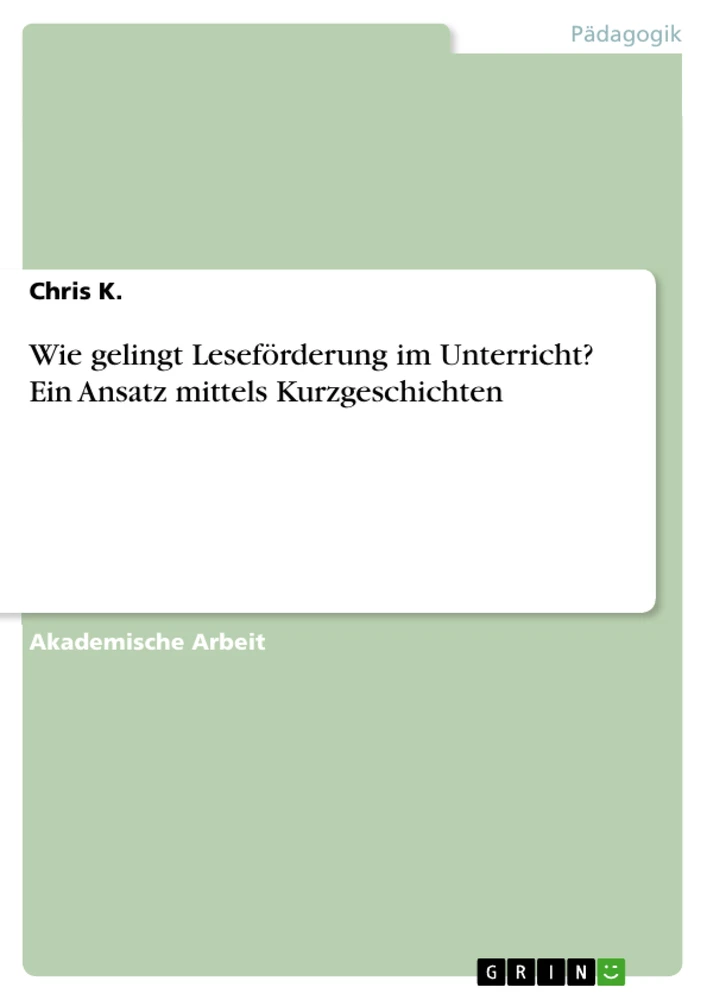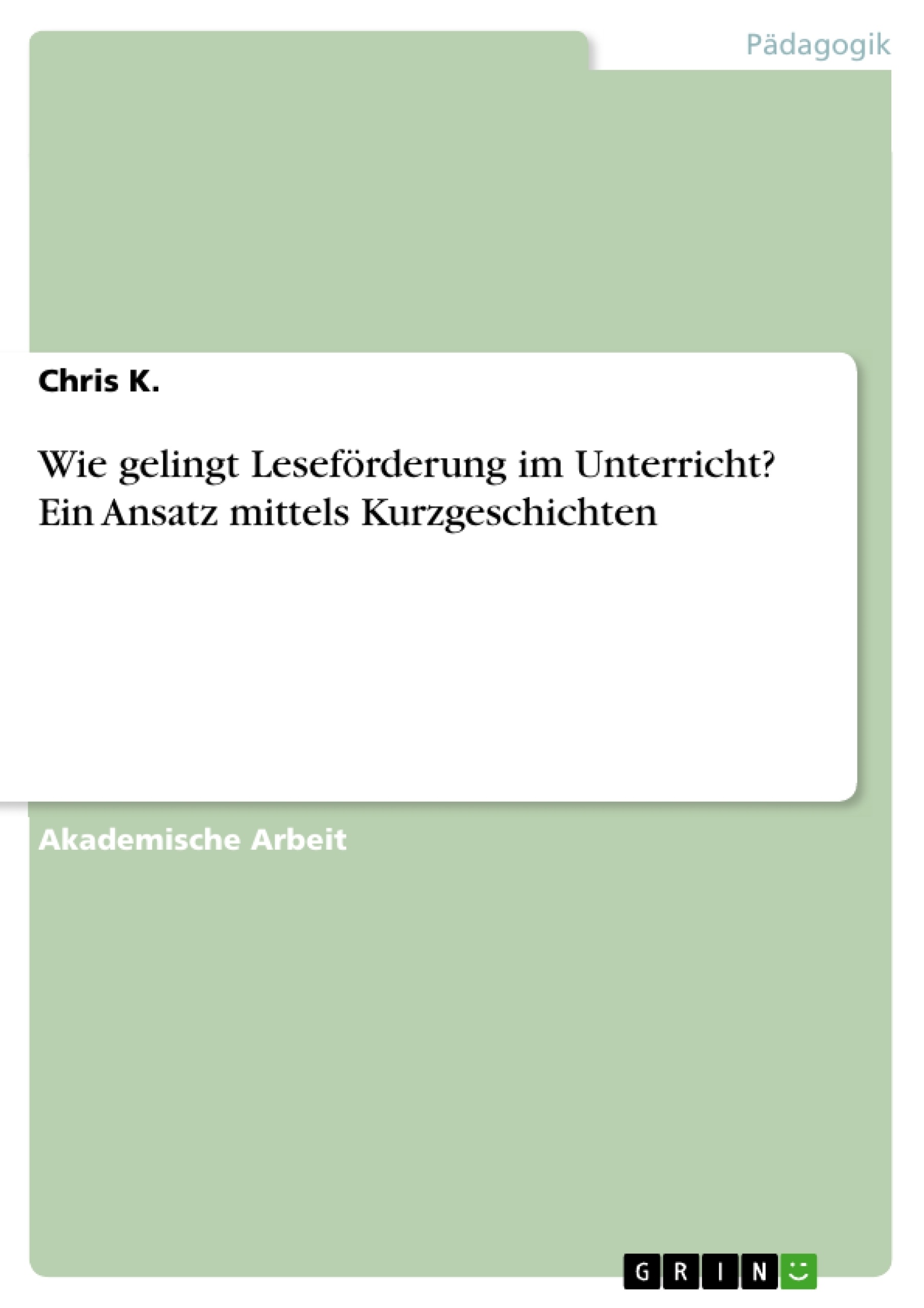Lesen im Unterricht Lesen mit Geschichten
Diese Ausarbeitung durchleuchtet die Leseförderung mit Kurzgeschichten in der Schule. Dabei werden zwei Kurzgeschichten als Beispiele herangezogen. Der Leseprozess gliedert sich in drei Prozessebenen, die jeweils gefördert werden können.
Die Kurzgeschichte ist bei Lehrern, aber auch bei Schülerinnen und Schülern beliebt. Dies liegt daran, dass sie nur einen geringen Textumfang besitzt, einen überschaubaren dramatischen und alltäglichen Handlungsausschnitt darstellt, sowie einen einfachen Sprachstil besitzt. Kurzgeschichten eignen sich gut für Sprachuntersuchungen, die Vermittlung von Epochenwissen und literarischem Wissen. Da die Lesesozialisation durch die Eltern nicht mehr so häufig geschieht, kann diese so im Unterricht nachgeholt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Die Kurzgeschichte
- Themenbereiche in Kurzgeschichten
- Kurzgeschichten sind im Unterricht beliebt
- Beliebte Kurzgeschichten für den Unterricht
- Didaktische Überlegungen zu zwei Kurzgeschichten
- Heinrich Böll: Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral 1963
- Herbert Malecha: Die Probe
- Leseförderung mit Hilfe der Kurzgeschichten
- Literarisches Lesen unterstützen
- Das Lautleseverfahren
- Die Anwendung auf die Kurzgeschichte
- Lesestrategieprogramm SQ3R
- Das Lesen trainieren: Die dominierenden lesedidaktischen Konzepte
- Das Lesetraining
- Literarisches Lernen mit Kurzgeschichten
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eignung von Kurzgeschichten für den Deutschunterricht und beleuchtet deren didaktische Umsetzung. Sie analysiert ausgewählte Texte hinsichtlich ihrer thematischen Vielfalt und ihrer Relevanz für Schüler. Der Fokus liegt auf der Leseförderung und dem literarischen Lernen mit Hilfe von Kurzgeschichten.
- Die Charakteristika der Kurzgeschichte als literarische Gattung
- Die didaktische Eignung von Kurzgeschichten im Unterricht
- Die Auswahl geeigneter Kurzgeschichten für verschiedene Altersstufen
- Methoden der Leseförderung durch Kurzgeschichten
- Analyse exemplarischer Kurzgeschichten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Kurzgeschichte: Die Kurzgeschichte zeichnet sich durch geringen Umfang, symbolische Überschriften, thematische Vielfalt und die Darstellung kurzer, dramatischer Alltagssituationen aus. Die Zeit wird augenblicklich dargestellt, mit Steigerung und Handlungsumschwung am Ende. Der Schauplatz ist meist einer, die Erzählperspektive oft personal mit auktorialen Zügen. Oft wird ein Problem geschildert, ohne Lösungsvorschläge, in alltäglicher Sprache mit offenem Anfang und Ende. Viele berühmte Autoren thematisieren politische Situationen ihrer Zeit, wie die NS-Zeit oder den Wirtschaftswunder.
Themenbereiche in Kurzgeschichten: Kurzgeschichten bieten eine hohe Themenvielfalt, beispielsweise moderne Arbeitswelt, Zwang und Gewalt, oder das Verhältnis von Gegeneinander und Miteinander. Manfred Durzak identifizierte zehn Themenkomplexe, die von der Doppelbödigkeit der Welt bis zum Leben in der DDR reichen. Moderne Kurzgeschichten behandeln Verunsicherung, Verliebtsein, Familienleben, Schule und gesellschaftliche Probleme.
Kurzgeschichten sind im Unterricht beliebt: Kurzgeschichten sind bei Lehrern und Schülern beliebt aufgrund ihres geringen Umfangs, des überschaubaren Handlungsausschnitts und des einfachen Sprachstils. Sie eignen sich gut für Sprachuntersuchungen, die Vermittlung von Epochen- und literarischem Wissen und können die Lesesozialisation unterstützen.
Beliebte Kurzgeschichten für den Unterricht: Untersuchungen zeigen, dass Werke von Borchert und Brecht besonders beliebt sind, gefolgt von Böll und Wohmann. Lehrwerke und Textsammlungen unterscheiden sich in ihrer Auswahl, wobei Krieg und seine Folgen, Erwachsenwerden, Umgang mit Fremden und Isolation des Individuums thematische Schwerpunkte darstellen.
Didaktische Überlegungen zu zwei Kurzgeschichten: In der Sekundarstufe I (Jahrgangsstufen 8-10) werden Kurzgeschichten didaktisch umgesetzt. Die Analyse konzentriert sich auf "Die Probe" von Herbert Malecha und "Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral" von Heinrich Böll aufgrund ihrer thematischen Vielfalt und Häufigkeit.
Heinrich Böll: Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral 1963: Bölls Kurzgeschichte, angesiedelt im Wirtschaftswunder, hinterfragt augenzwinkernd und provokant die Organisation von Arbeit und Wohlbefinden des Menschen. Die typischen unheroischen Charaktere, die sich ihrer Rolle widersetzen, bieten Schülern die Möglichkeit, eigene Standpunkte zu entwickeln. Die sprachliche Gestaltung spielt eine wichtige Rolle für den sprachlichen Lernprozess.
Schlüsselwörter
Kurzgeschichte, Leseförderung, Deutschunterricht, Didaktik, Literaturanalyse, Heinrich Böll, Herbert Malecha, Wirtschaftswunder, Lesestrategien, Sprachliche Analyse, Literarisches Lernen.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: "Eignung von Kurzgeschichten für den Deutschunterricht"
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument untersucht die Eignung von Kurzgeschichten für den Deutschunterricht und beleuchtet deren didaktische Umsetzung. Es analysiert ausgewählte Texte hinsichtlich ihrer thematischen Vielfalt und Relevanz für Schüler und konzentriert sich auf Leseförderung und literarisches Lernen mithilfe von Kurzgeschichten.
Welche Themen werden in den Kurzgeschichten behandelt?
Die Kurzgeschichten behandeln eine hohe Themenvielfalt, darunter die moderne Arbeitswelt, Zwang und Gewalt, das Verhältnis von Gegeneinander und Miteinander, Verunsicherung, Verliebtsein, Familienleben, Schule und gesellschaftliche Probleme. Manfred Durzak identifizierte zehn Themenkomplexe, die von der Doppelbödigkeit der Welt bis zum Leben in der DDR reichen. Krieg und seine Folgen, Erwachsenwerden, Umgang mit Fremden und Isolation des Individuums sind weitere wichtige Themen.
Welche Kurzgeschichten werden im Detail analysiert?
Im Detail analysiert werden "Die Probe" von Herbert Malecha und "Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral" von Heinrich Böll. Die Auswahl begründet sich auf der thematischen Vielfalt und der Häufigkeit ihrer Verwendung im Unterricht.
Welche didaktischen Überlegungen werden angestellt?
Das Dokument bietet didaktische Überlegungen zur Umsetzung von Kurzgeschichten in der Sekundarstufe I (Jahrgangsstufen 8-10). Es beleuchtet die Analyse der ausgewählten Texte, den Fokus auf die sprachliche Gestaltung und die Möglichkeiten, eigene Standpunkte der Schüler zu fördern.
Welche Charakteristika der Kurzgeschichte werden hervorgehoben?
Die Kurzgeschichte zeichnet sich durch geringen Umfang, symbolische Überschriften, thematische Vielfalt und die Darstellung kurzer, dramatischer Alltagssituationen aus. Die Zeit wird augenblicklich dargestellt, mit Steigerung und Handlungsumschwung am Ende. Der Schauplatz ist meist einer, die Erzählperspektive oft personal mit auktorialen Zügen. Oft wird ein Problem geschildert, ohne Lösungsvorschläge, in alltäglicher Sprache mit offenem Anfang und Ende.
Welche Methoden der Leseförderung werden diskutiert?
Das Dokument diskutiert Methoden der Leseförderung, darunter das Lautleseverfahren und das Lesestrategieprogramm SQ3R. Es behandelt auch das literarische Lesen und das Lesetraining im Allgemeinen und deren Anwendung auf die Kurzgeschichte.
Welche Autoren und Werke werden genannt?
Es werden Werke von Borchert, Brecht, Böll und Wohmann genannt. Böll's "Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral" und Malecha's "Die Probe" werden ausführlich behandelt. Die genannten Autoren thematisieren oft politische Situationen ihrer Zeit, wie die NS-Zeit oder den Wirtschaftswunder.
Für welche Altersstufen eignen sich die diskutierten Methoden?
Die didaktischen Überlegungen und die Analyse der Kurzgeschichten konzentrieren sich auf die Sekundarstufe I (Jahrgangsstufen 8-10).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Kurzgeschichte, Leseförderung, Deutschunterricht, Didaktik, Literaturanalyse, Heinrich Böll, Herbert Malecha, Wirtschaftswunder, Lesestrategien, Sprachliche Analyse, Literarisches Lernen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das Dokument enthält eine Quellenangabe, die weitere Informationen liefern könnte (im Originaldokument nicht vollständig aufgeführt).
- Quote paper
- Chris K. (Author), 2020, Wie gelingt Leseförderung im Unterricht? Ein Ansatz mittels Kurzgeschichten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/899841