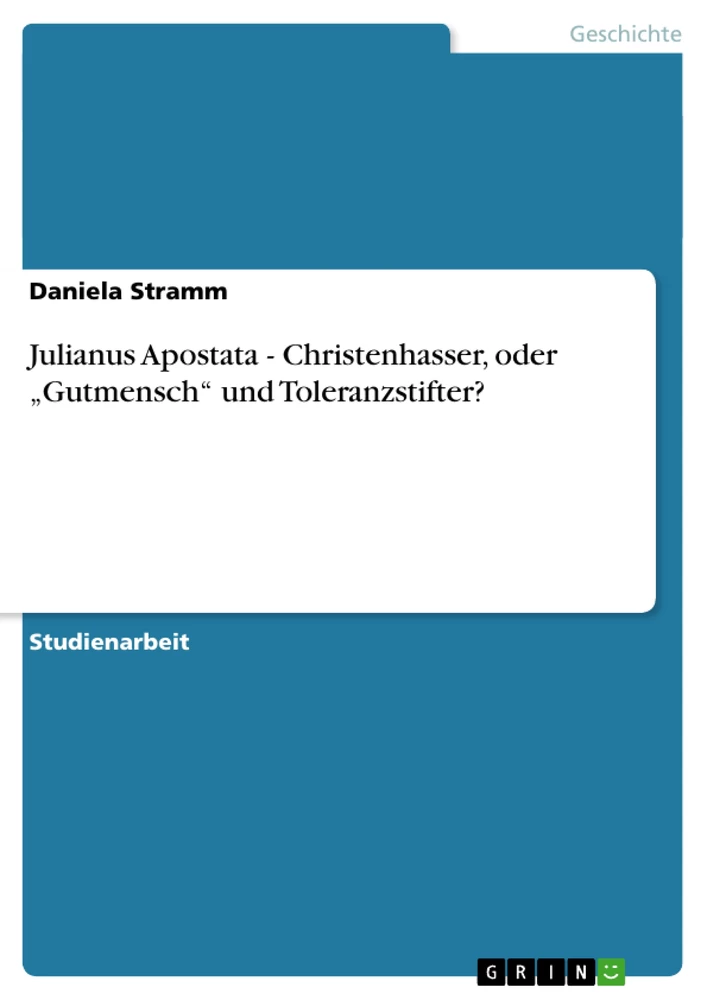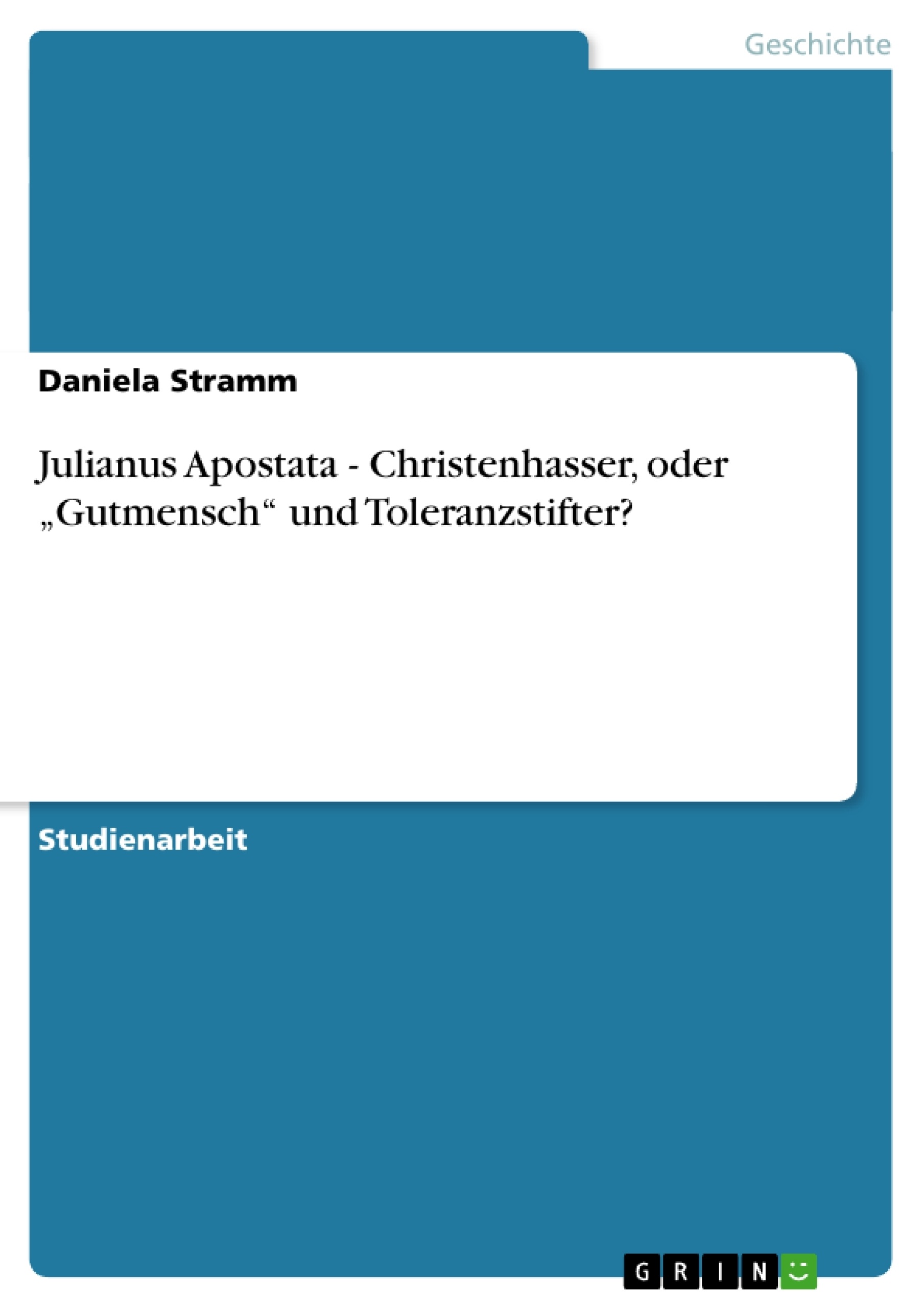Julian, ein verkannter „Gutmensch“?
Kaiser Julianus II., Neffe von Konstantin dem Großen und letzter der konstantinischen Dynastie, regierte nur
20 Monate. Die Zurücknahme der unter Konstantin gewährten Privilegien für das Christentum verschafften ihm einen großen, wenn auch negativen Ruhm. Die gleichzeitige Wiedereinführung der griechischen Religion und der östlichen Mysterienkulte stieß schon zu Julians Lebzeiten auf heftige Gegenwehr, in späterer Zeit wurde sie von den Christen als schwere Verfehlung ausgelegt. Der Namenszusatz Apostata- der Abtrünnige- ist ihm nachträglich von der Kirche gegeben worden, womit seine Person gebrandmarkt und der Ketzerei für schuldig befunden wurde.
So ist das Julianbild des Mittelalters ein zum Teil sehr negatives und auch noch bis weit in unsere Zeit hängt die Einschätzung seiner Leistungen davon ab, wie man sein Verhältnis zum Christentum bewertet. Dennoch begann in der Zeit der Aufklärung bereits eine positive Betrachtung Julians.
Die vorliegende Arbeit, die auf den neueren Forschungsergebnissen des späten 20. und des beginnenden 21. Jahrhunderts beruht, untersucht die Frage nach Julians tatsächlichem Verhältnis zum Christentum. War er ein echter Christenhasser, oder lehnte er lediglich die Privilegien für eine einzige Religion ab? Ebenfalls wird untersucht, wie tolerant Julians "Toleranzedikte" wirklich waren.
Julians schwere Kindheit und Jugend prägten seinen Charakter und seine Weltanschauung, darum soll in diese Betrachtung auch die menschliche Seite Julians mit einfließen. Die Frage nach seinen eigenen Visionen und der Möglichkeit ihrer Durchsetzung im römischen Staatsapparat der frühen Christenzeit wird sich im Zuge dieser Untersuchung selbst beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- Julian, ein verkannter „Gutmensch“?
- Julians Kindheit und Jugend
- Politischer Aufstieg unter Constantius II.
- Ernennung zum Caesaren
- Julian als Feldherr
- Regierungszeit und innenpolitische Maßnahmen
- Betrachtung der „Toleranz“ unter Julian
- Christenfeindliche Maßnahmen und Toleranzversuche
- Verhältnis zu den Juden
- Antiocheia und die Probleme der heidnischen Programmatik
- Abschließende Betrachtung
- Quellen
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Julians Verhältnis zum Christentum und analysiert, ob er ein echter Christenhasser war oder lediglich die Privilegien für eine einzige Religion ablehnte. Darüber hinaus soll untersucht werden, wie tolerant Julians Toleranzedikte tatsächlich waren.
- Julians Kindheit und Jugend prägten seinen Charakter und seine Weltanschauung.
- Julians Verhältnis zum Christentum und seine Toleranzpolitik.
- Die Auswirkungen von Julians Maßnahmen auf die Gesellschaft.
- Julians eigene Visionen und die Möglichkeit ihrer Durchsetzung im römischen Staatsapparat.
- Die Rolle der heidnischen Religion in Julians Regierungszeit.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Julian, ein verkannter „Gutmensch“?: Dieses Kapitel führt den Leser in die Person Julians ein und skizziert seine schwierige Kindheit und Jugend, geprägt von Verlusten und Morden in seiner näheren Umgebung. Es stellt Julians Verhältnis zum Christentum in den Kontext seiner Zeit und beschreibt die negative Sichtweise auf ihn in der Geschichte.
- Kapitel 2: Julians Kindheit und Jugend: Dieses Kapitel beleuchtet die frühe Lebensgeschichte Julians, von seiner Geburt in Konstantinopel bis zu seiner frühen Erziehung durch den arianischen Bischof Eusebios und seinen Lehrer Mardonios. Es zeigt, wie Constantius II., der Kaiser, Julians Bildung und seine Weltsicht kontrollierte.
- Kapitel 3: Politischer Aufstieg unter Constantius II.: Dieses Kapitel beschreibt Julians Aufstieg zum Caesaren und seine Rolle als Feldherr. Es geht auf die politische Situation der Zeit ein und beleuchtet die komplexen Beziehungen innerhalb der kaiserlichen Familie.
- Kapitel 4: Regierungszeit und innenpolitische Maßnahmen: Dieses Kapitel befasst sich mit Julians Regierungszeit und seinen innenpolitischen Maßnahmen, insbesondere mit der Wiedereinführung der heidnischen Religion und der damit verbundenen Herausforderungen.
- Kapitel 5: Betrachtung der „Toleranz“ unter Julian: Dieses Kapitel analysiert Julians Toleranzedikte und untersucht, ob er tatsächlich tolerant gegenüber anderen Religionen war. Es befasst sich mit seinen Maßnahmen gegenüber Christen und Juden sowie mit den Problemen, die aus seiner heidnischen Programmatik entstanden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind Julian, der letzte Kaiser der konstantinischen Dynastie, sein Verhältnis zum Christentum, seine Toleranzpolitik, die Wiedereinführung der heidnischen Religion, die Probleme der heidnischen Programmatik und die Auswirkungen von Julians Maßnahmen auf die Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Kaiser Julianus II. (Julianus Apostata)?
Julian war der letzte Kaiser der konstantinischen Dynastie und regierte von 361 bis 363 n. Chr. Er ist bekannt für seinen Versuch, die christlichen Privilegien zurückzunehmen und die heidnische Religion wiederherzustellen.
Warum erhielt er den Beinamen „Apostata“?
Der Beiname bedeutet „der Abtrünnige“. Er wurde ihm von der christlichen Kirche verliehen, weil er sich vom Christentum abwandte und die alten griechischen Kulte förderte.
War Julian ein echter Christenhasser?
Die Arbeit untersucht, ob er die Christen hasste oder lediglich die Bevorzugung einer einzigen Religion ablehnte, um eine religiöse Vielfalt (Toleranz) im römischen Staat wiederherzustellen.
Wie sah Julians Toleranzpolitik aus?
Er erließ Toleranzedikte, die allen Religionen die freie Ausübung ihrer Kulte erlaubten, entzog jedoch gleichzeitig der christlichen Kirche staatliche Förderungen und Privilegien.
Wie beeinflusste seine Kindheit seine Weltanschauung?
Seine Jugend war geprägt von Verlusten und Morden in seiner Familie durch christliche Verwandte, was vermutlich seine Skepsis gegenüber dem Christentum und seine Hinwendung zur Philosophie verstärkte.
Welches Verhältnis hatte Julian zu den Juden?
Julian stand den Juden wohlwollend gegenüber und plante sogar den Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem, teils um die christliche Lehre von der Zerstörung des Tempels zu widerlegen.
- Citation du texte
- BA Daniela Stramm (Auteur), 2006, Julianus Apostata - Christenhasser, oder „Gutmensch“ und Toleranzstifter?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89925