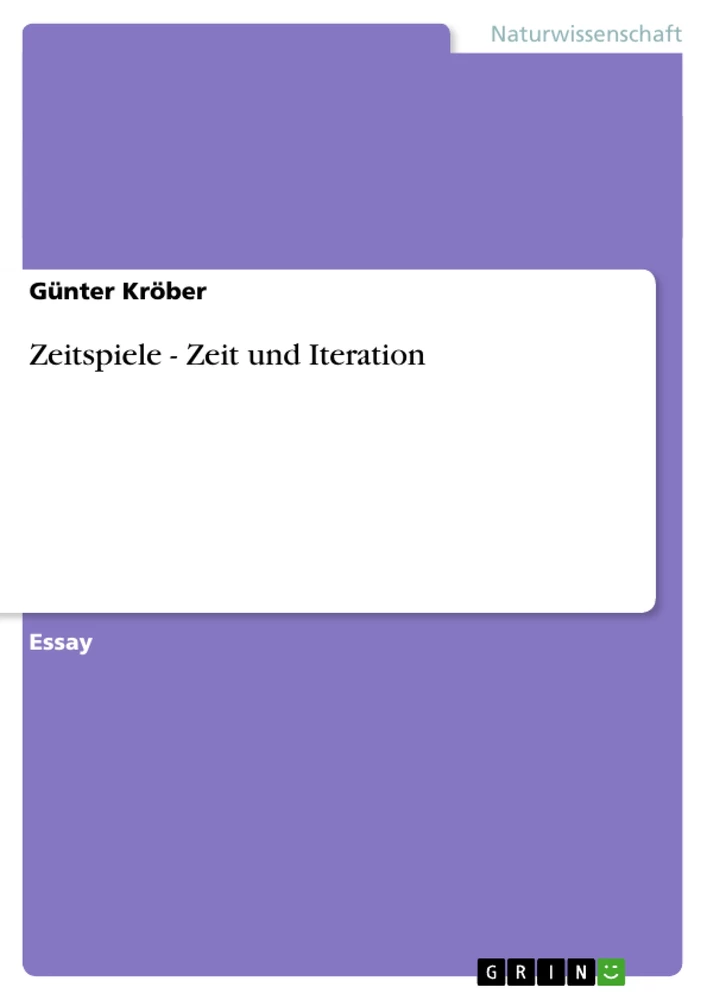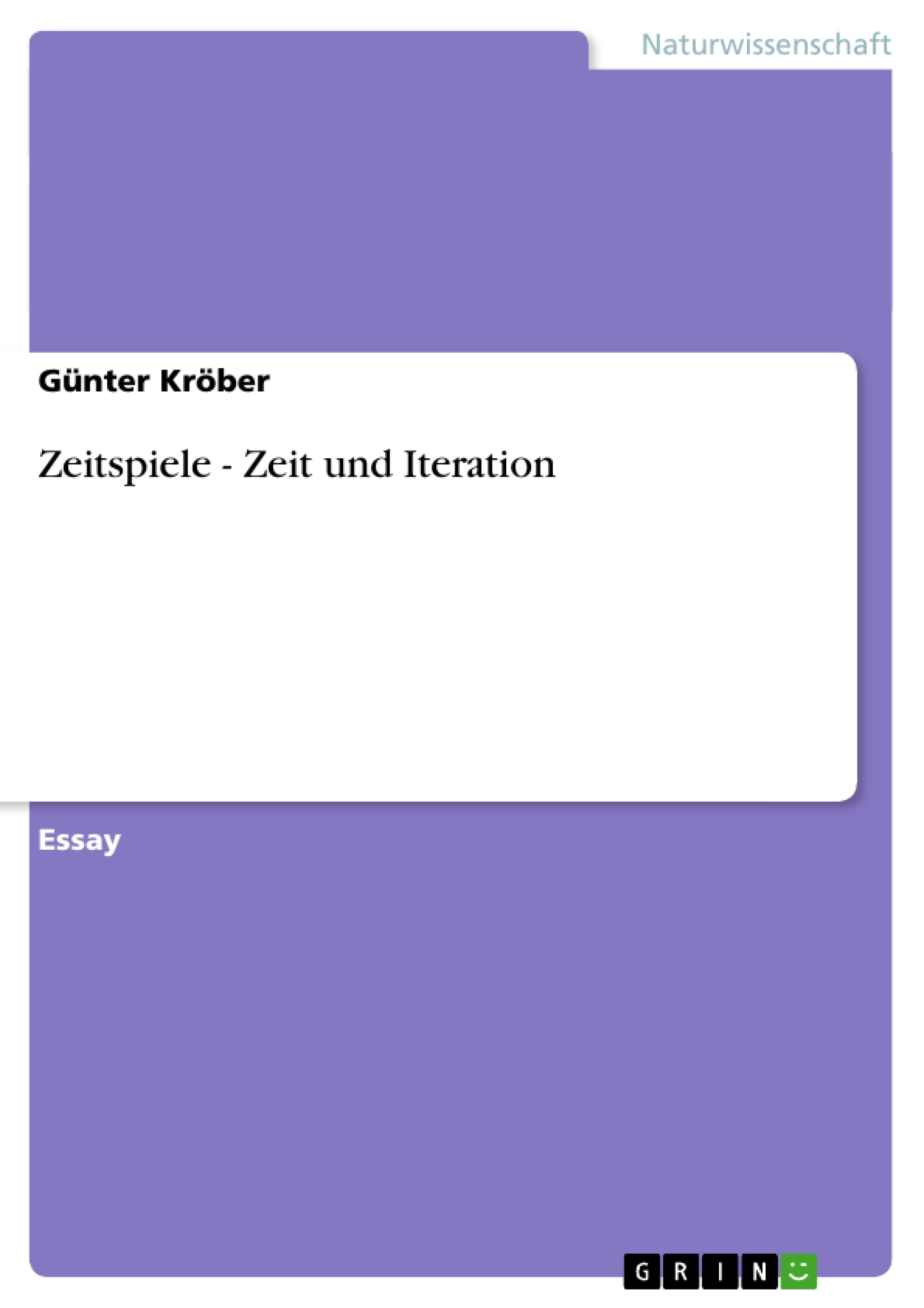Es gehört zu den unvergeßlichen Kindheitserlebnissen vieler Menschen, einen Wassertropfen, etwa aus einem Dorfteich, unter einem Mikroskop betrachtet und dabei ein Gewimmel von belebten Körperchen und unbelebten Strukturen erblickt zu haben, die dem bloßen Auge nicht sichtbar sind. Und wer jemals in einer sternklaren Nacht durch ein Fernrohr einen Blick in die Weiten des Weltalls getan und schier unerschöpfliche Ansammlungen von Sternen, Galaxien und kosmischen Nebeln gesichtet hat, wie sie in längst vergangenen Zeiten existierten, der ist ergriffen von der Tiefe des Raumes und der Unergründlichkeit der Zeit.
Mikroskop und Teleskop haben uns befähigt, die Welt in Bereichen kennen zu lernen, die uns ohne diese technischen Hilfsmittel für immer verborgen wären. Ihre Erfindung datiert um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. Als Erfinder des Fernrohrs werden in Arbeiten zur Wissenschafts- und Technikgeschichte holländische Brillenmacher genannt, insbesondere Hans Lippershey, der 1608 ein entsprechendes Patent beantragt hatte. Galileo Galilei setzte 1609 ein von ihm selbst konstruiertes Fernrohr für seine astronomischen Forschungen ein und entdeckte mit ihm die vier hellsten Jupitermonde. Der Erfindung des Fernrohrs folgte die des Mikrokosps auf dem Fuße. Neben Galilei werden in diesem Zusammenhang gewöhnlich die Holländer Cornelius Drebbel und Zacharias Janssen genannt.
Ursprünglich zur Erbauung von Seele und Auge gedacht, wurde das Mikroskop bald zu einem unentbehrlichen Instrument der wissenschaftlichen Forschung. Die Technik des Mikroskopierens wurde rasch weiterentwickelt und die Leistungsfähigkeit des Instruments kontinuierlich gesteigert. Im Elektronenmikroskop werden optische Linsen durch Elektronenlinsen ersetzt, und die Technik der Raster-Tunnel-Mikroskopie erlaubt es heute, Gebilde in atomaren Größenordnungen sichtbar zu machen.
Ähnlich rasant verlief die Entwicklung des Fernrohrs. Von Galileis Sicht auf die Jupitermonde bis zu den Aufnahmen, die uns heute das auf einer Erdumlaufbahn stationierte Hubble-Teleskop über unser Universum liefert, sind gerade einmal vier Jahrhunderte vergangen.
Teleskop und Mikroskop erschließen uns makroskopisch große und mikroskopisch kleine räumliche Dimensionen. Die durch astronomische Fernrohre beobachteten Objekte befinden sich in großer Entfernung von uns, die im Mikroskop sichtbaren Objekte sind unmittelbar vor uns. Beide Instrumente befähigen das Auge, Räume zu durchmessen: Das Mikroskop, indem es in kleinen Dimensionen existierende Objekte größer erscheinen läßt; das Teleskop, indem es Objekte, die uns auf Grund der großen Entfernung klein erscheinen, sofern sie mit bloßem Auge überhaupt sichtbar sind, näher an uns heranholt und sie damit größer erscheinen läßt. Mikroskop und Teleskop sind für räumliches Sehen geschaffen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Ein Mikroskop für die Zeit.
Felix Ebertys „Die Gestirne und die Weltgeschichte“ - 2. Ein Mikroskop für Raum und Zeit.
Das Apfelmännchen - 3. Ein Teleskop für Raum und Zeit.
Verborgene Similaritäten - 4. Evolution - Zeit - Iteration
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob es möglich ist, vergangene Zustände unserer Welt mithilfe von „Mikroskopen“ und „Teleskopen“ für Raum und Zeit zu betrachten. Der Autor erforscht die Möglichkeiten, die uns iterative Prozesse der Strukturbildung bieten, um sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft zu navigieren. Die zentrale These ist, dass die Iteration der Schlüssel zur Evolution ist.
- Ebertys Idee eines „Mikroskops für die Zeit“
- Strukturbildung durch iterative Prozesse
- Die Mandelbrot-Menge und ihre fraktale Natur
- Palindromisierungsprozesse und ihre Auswirkungen auf die Strukturbildung
- Die Rolle der Iteration in der Evolution
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel beleuchtet die Idee von Felix Eberty, der die Möglichkeit eines „Mikroskops für die Zeit“ erörterte. Er argumentierte, dass ein Beobachter auf einem entfernten Stern die Erde in verschiedenen historischen Epochen sehen könnte, da das Licht eine endliche Geschwindigkeit hat.
- Kapitel 2: Hier wird die Mandelbrot-Menge als Beispiel für einen iterativen Prozess der Strukturbildung vorgestellt. Die fraktale Natur dieser Menge ermöglicht es, sowohl räumlich als auch zeitlich zu navigieren.
- Kapitel 3: In diesem Kapitel werden Palindromisierungsprozesse als weitere Form der iterativen Strukturbildung untersucht. Die durch diese Prozesse entstehenden Strukturen lassen sich durch Variation der Iterationszahl als „Teleskop für Raum und Zeit“ betrachten.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel setzt sich mit der Evolution als Ergebnis von iterativen Prozessen auseinander und argumentiert, dass die Iteration die Grundlage der Evolution bildet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Iteration, Strukturbildung, Raum und Zeit, die Mandelbrot-Menge, Palindromisierungsprozesse und die Evolution. Weitere wichtige Begriffe sind „Mikroskop für die Zeit“, „Teleskop für Raum und Zeit“, Fraktale und die Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Idee hinter Felix Ebertys "Mikroskop für die Zeit"?
Eberty argumentierte, dass man aufgrund der endlichen Lichtgeschwindigkeit von einem fernen Stern aus die Vergangenheit der Erde wie durch ein Mikroskop betrachten könnte.
Welche Rolle spielt die Iteration in der Strukturbildung?
Iteration bezeichnet die wiederholte Anwendung eines Prozesses. Die Arbeit zeigt auf, dass solche iterativen Prozesse die Grundlage für komplexe Strukturen in Raum und Zeit bilden.
Was ist das "Apfelmännchen" im Kontext von Raum und Zeit?
Das Apfelmännchen (Mandelbrot-Menge) ist ein Fraktal, das durch Iteration entsteht und als Modell dient, um räumliche und zeitliche Navigation in komplexen Systemen zu verdeutlichen.
Was sind Palindromisierungsprozesse?
Dies sind spezielle iterative Prozesse, die symmetrische Strukturen erzeugen und als "Teleskop" genutzt werden können, um verborgene Similaritäten in der Evolution sichtbar zu machen.
Ist Iteration der Schlüssel zur Evolution?
Die zentrale These der Arbeit lautet, dass die Evolution das Ergebnis fortlaufender iterativer Prozesse ist, die über lange Zeiträume hinweg stabile Strukturen hervorbringen.
- Arbeit zitieren
- Prof. Dr. Günter Kröber (Autor:in), 2008, Zeitspiele - Zeit und Iteration, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89427