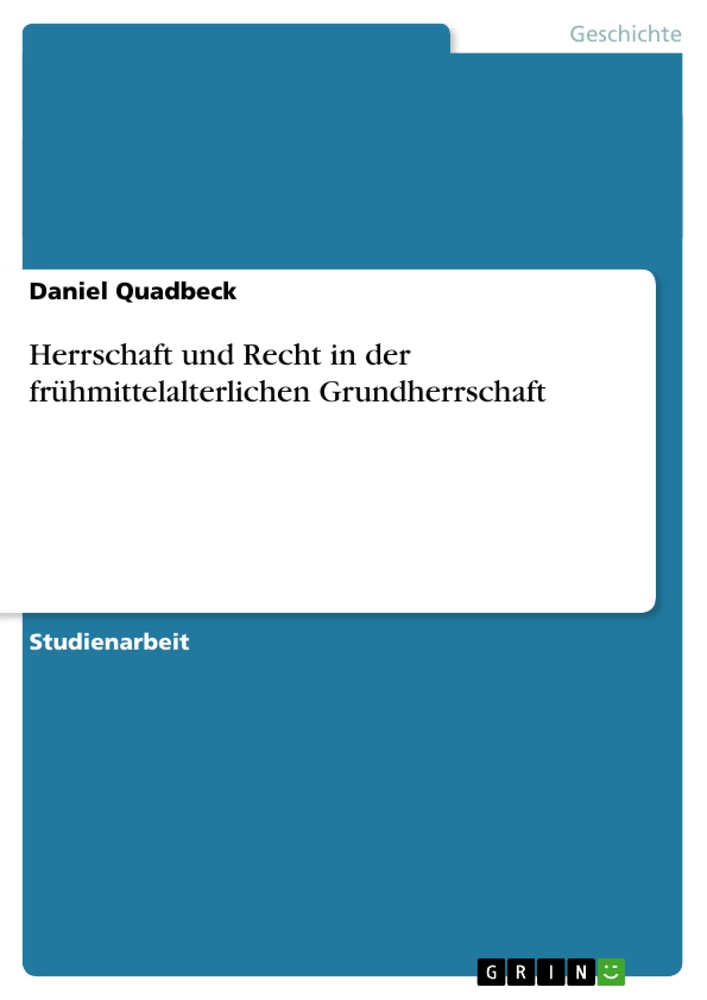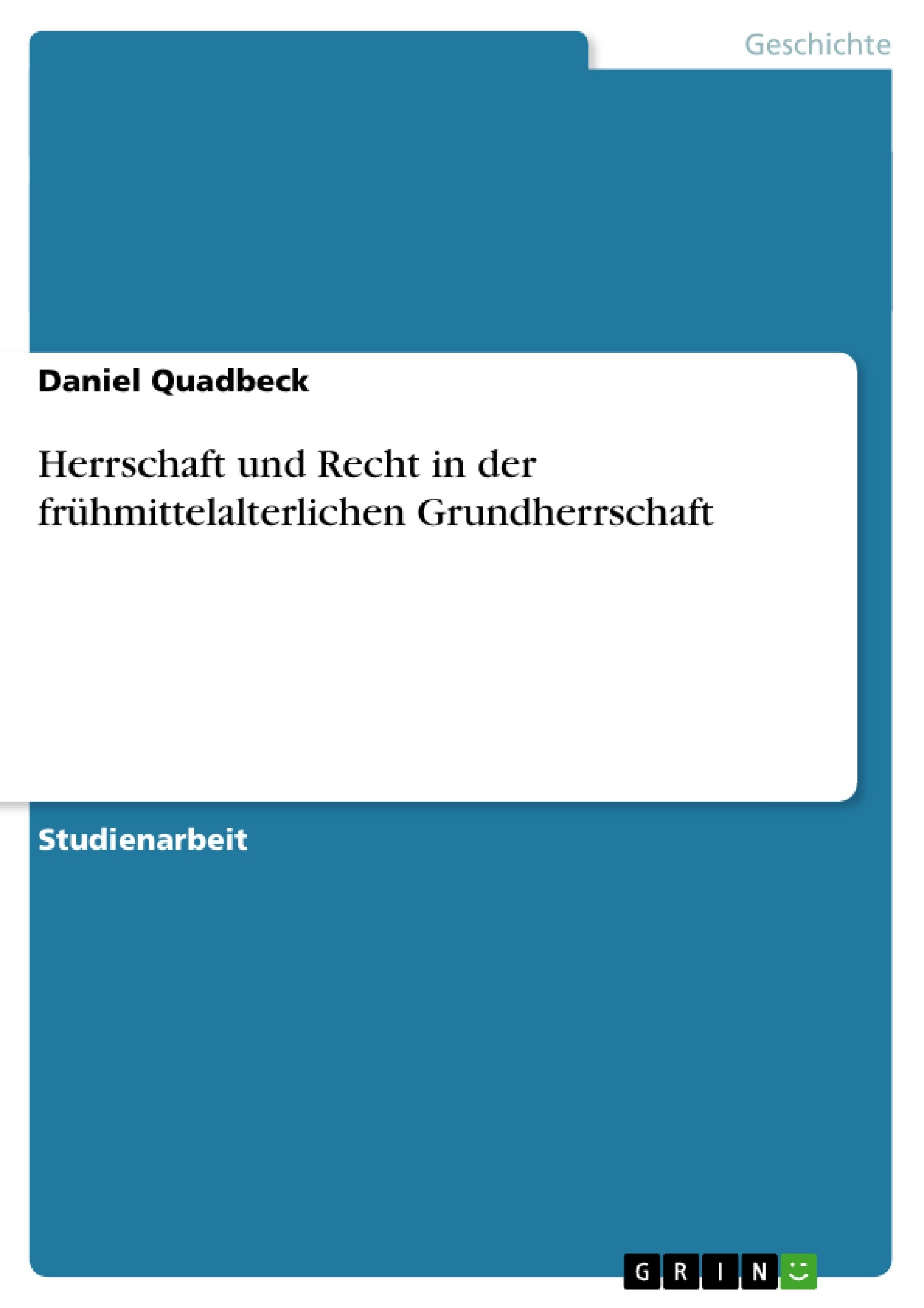Unter Grundherrschaft versteht die Mehrheit der Historiker heutzutage "eine Grundform mittelalterlicher Herrschaft (…), welche von der Verfügung über Grund und Boden ausgeht und die auf diesem Boden ansässigen Personen herrschaftlich erfasst" . Dieser Definition liegt die Annahme zugrunde, dass es sich bei der Grundherrschaft nicht um einen "Zustand freiwilliger Arbeitsteilung" handelte, sondern vielmehr um ein "Herrschafts- und Machtverhältnis".
Dieses System der Landleihe umfasst wirtschaftliche und soziale Faktoren, die ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis zwischen Grundherrn und Grundholden begründen. Grundvoraussetzung dafür ist der Landbesitz und die Vergabe des Nutzungsrechts an diesem Land. "Als Gegenleistung für die Nutzung von Grund und Boden schulden die damit Beliehenen ihrem Grundherrn Abgaben und vielfach auch Dienstleistungen".
Diese Hausarbeit soll sich mit der Frage beschäftigen, ob sich aus dem Landbesitz Herrschaftsrechte ableiten lassen und in wieweit diese willkürlich von dem Grundherrn ausgenutzt werden konnten, oder ob nicht das genossenschaftliche Element in der frühmittelalterlichen Grundherrschaft so stark ausgeprägt war, dass "für Herrschaft kein Raum war" .
Es soll näher untersucht werden, ob dem Grundherrn ein Ermessensspielraum bei der Ausübung von Herrschaft und bei der Festlegung der Abgaben bzw. bei der Setzung von Recht im Allgemeinen blieb, oder ob sich diese Einflussnahme im Gewohnheitsrecht auflöste und somit Herrschaft bzw. deren Missbrauch verhinderte.
Dazu soll zunächst näher auf das System der frühmittelalterlichen Grundherrschaft und insbesondere auf die Definition des darin enthaltenen Begriffes der Herrschaft eingegangen werden, um die daraus gewonnenen Ergebnisse anschließend anhand des Hofrechts Bischof Burchards von Worms als zeitgenössischer normativer Quelle zu überprüfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung, Fragestellung, Quellen
- 2. Herrschaft und Recht in der Grundherrschaft
- 2.1 Das System der frühmittelalterlichen Grundherrschaft
- 2.2 Herrschaft und Gewohnheitsrecht
- 2.3 Hofrecht des Bischofs Burchard von Worms
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Landbesitz und Herrschaftsrechten in der frühmittelalterlichen Grundherrschaft. Es wird die Frage beleuchtet, inwieweit der Grundherr seine Macht willkürlich ausüben konnte oder ob das genossenschaftliche Element die Herrschaft beschränkte. Die Untersuchung analysiert das Ausmaß des Ermessensspielraums des Grundherrn bei der Festlegung von Abgaben und Recht.
- Das System der frühmittelalterlichen Grundherrschaft und das gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis zwischen Grundherr und Grundholden.
- Die Rolle des Gewohnheitsrechts und seine Wirkung auf die Ausübung der Herrschaft.
- Die Analyse des Hofrechts von Bischof Burchard von Worms als zeitgenössische normative Quelle.
- Die Abgrenzung zwischen Herrschaftsrechten und genossenschaftlichen Elementen in der Grundherrschaft.
- Die Auswirkung des Landbesitzes auf die Ausübung von Herrschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung, Fragestellung, Quellen: Die Einleitung definiert die Grundherrschaft als eine Grundform mittelalterlicher Herrschaft, die auf der Verfügung über Grund und Boden basiert und die darauf ansässigen Personen einschließt. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis zwischen Landbesitz, Herrschaftsrechten und genossenschaftlichen Elementen in der frühmittelalterlichen Gesellschaft. Die Arbeit untersucht, ob sich aus dem Landbesitz willkürliche Herrschaftsrechte ableiteten oder ob das genossenschaftliche Element die Macht des Grundherrn beschränkte. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz, der auf der Analyse des Systems der Grundherrschaft und der Überprüfung der Ergebnisse anhand des Hofrechts von Bischof Burchard von Worms basiert.
2. Herrschaft und Recht in der Grundherrschaft: Dieses Kapitel analysiert das System der frühmittelalterlichen Grundherrschaft, wobei die wechselseitige Abhängigkeit zwischen Grundherrn und Grundholden im Vordergrund steht. Neben Abgaben und Dienstleistungen als Gegenleistung für die Landnutzung werden weitere Faktoren beleuchtet, wie z.B. die Rechte des Grundholden an Haus, Hof und Boden, die über bloße Nutzungsrechte hinausgehen. Das weitverbreitete Erbzinsrecht wird in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse zwischen Grundherr und Grundholden diskutiert. Die Rolle der Waffenleistung und des Schutzes des Grundherrn für die Bauern wird ebenfalls thematisiert, wobei betont wird, dass diese Schutzherrschaft aus der Notlage der Bauern entstand und die Grundlage für die Ausübung der Herrschaft bildete. Das Kapitel beschreibt auch die bipartite Struktur der Grundherrschaft mit dem Fronhof als Zentrum und der Bewirtschaftung des Hufenlandes durch die Bauern. Die unterschiedliche Höhe der Abgaben in verschiedenen Grundherrschaften wird erwähnt und am Beispiel des Urbars der Abtei Werden illustriert.
Schlüsselwörter
Frühmittelalterliche Grundherrschaft, Herrschaft, Recht, Gewohnheitsrecht, Landbesitz, Abgaben, Dienstleistungen, Grundherr, Grundholde, Hofrecht, Bischof Burchard von Worms, Genossenschaft, Abhängigkeit, Erbzinsrecht, Fronhof, Hufenland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Herrschaft und Recht in der frühmittelalterlichen Grundherrschaft
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Landbesitz und Herrschaftsrechten in der frühmittelalterlichen Grundherrschaft. Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit der Grundherr seine Macht willkürlich ausüben konnte oder ob das genossenschaftliche Element seine Herrschaft beschränkte. Analysiert wird das Ausmaß des Ermessensspielraums des Grundherrn bei der Festlegung von Abgaben und Recht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet das System der frühmittelalterlichen Grundherrschaft und das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Grundherr und Grundholden. Sie untersucht die Rolle des Gewohnheitsrechts, analysiert das Hofrecht von Bischof Burchard von Worms als normative Quelle und grenzt Herrschaftsrechte von genossenschaftlichen Elementen ab. Die Auswirkung des Landbesitzes auf die Ausübung von Herrschaft wird ebenfalls untersucht.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Analyse des Systems der frühmittelalterlichen Grundherrschaft und bezieht das Hofrecht von Bischof Burchard von Worms als zeitgenössische normative Quelle mit ein. Weitere Quellen werden in der Einleitung detaillierter beschrieben (z.B. Urbar der Abtei Werden).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung mit Fragestellung und Quellenangabe, ein Hauptkapitel ("Herrschaft und Recht in der Grundherrschaft") und ein Fazit. Das Hauptkapitel analysiert das System der Grundherrschaft, die Rolle des Gewohnheitsrechts und das Hofrecht des Bischofs Burchard von Worms.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit (Zusammenfassung der Kapitel)?
Die Einleitung definiert die Grundherrschaft und formuliert die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis von Landbesitz, Herrschaftsrechten und genossenschaftlichen Elementen. Das Hauptkapitel analysiert die wechselseitige Abhängigkeit zwischen Grundherr und Grundholden, Abgaben, Dienstleistungen, Erbzinsrecht, die Rolle des Schutzes durch den Grundherrn und die bipartite Struktur der Grundherrschaft. Es beleuchtet die unterschiedliche Höhe der Abgaben in verschiedenen Grundherrschaften.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Frühmittelalterliche Grundherrschaft, Herrschaft, Recht, Gewohnheitsrecht, Landbesitz, Abgaben, Dienstleistungen, Grundherr, Grundholde, Hofrecht, Bischof Burchard von Worms, Genossenschaft, Abhängigkeit, Erbzinsrecht, Fronhof, Hufenland.
- Citar trabajo
- Daniel Quadbeck (Autor), 2002, Herrschaft und Recht in der frühmittelalterlichen Grundherrschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8919