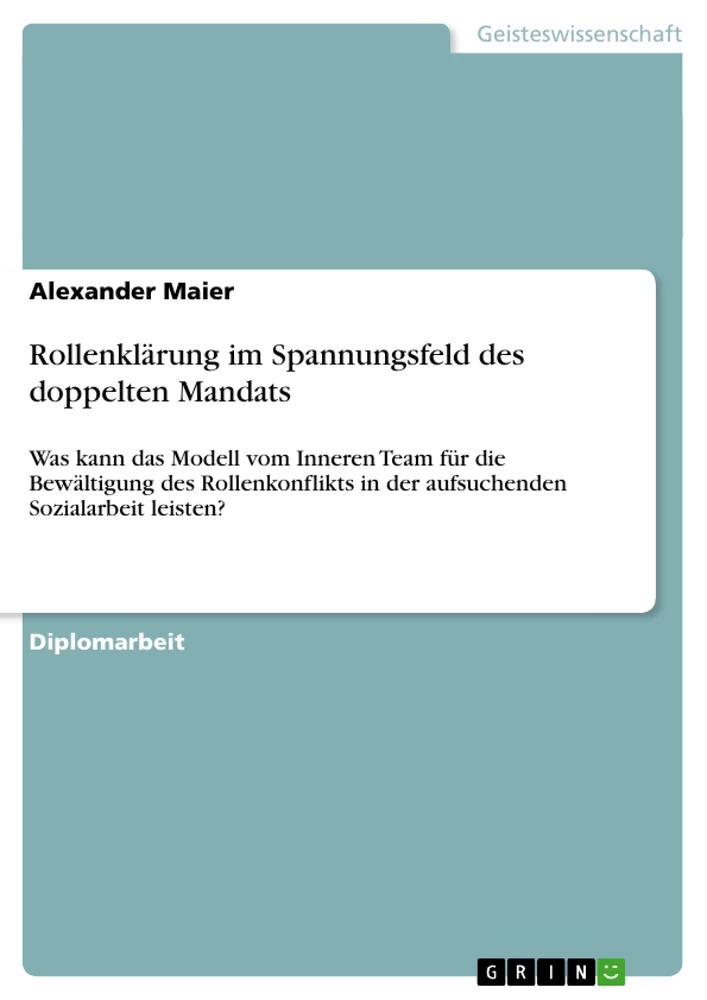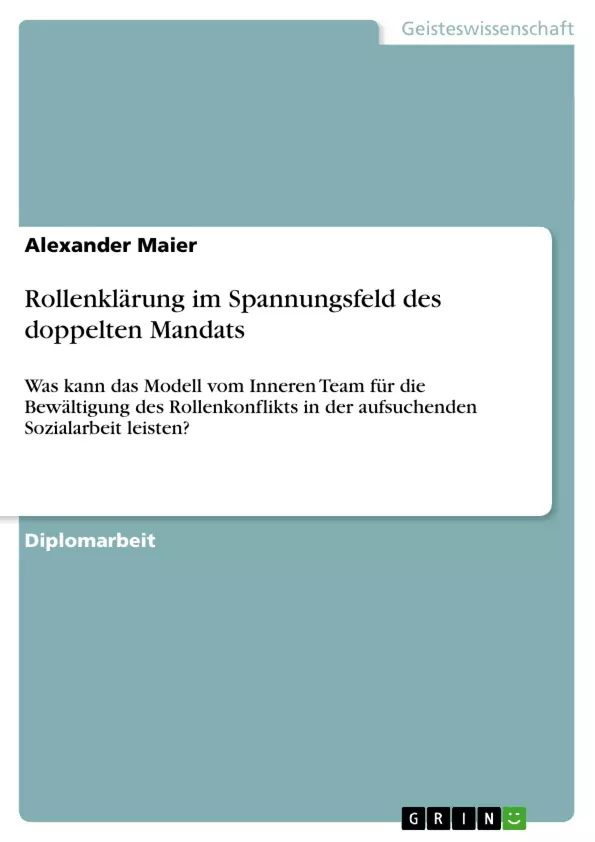„Soziale Arbeit – das ist ja die Paradoxie schlechthin“ (Habermas, zit. n. Rauschenbach, 1999, S.174). Diese Aussage des Soziologen Jürgen Habermas bringt die Dramatik der Widersprüchlichkeit innerhalb des doppelten Mandats auf den Punkt. Dieses ergibt sich, da unterschiedliche Erwartungen an die Berufsrolle des Sozialarbeiters gerichtet werden. Einerseits bestehen diese aus gesellschaftlichen Interessen. Im Lauf der Arbeit wird deutlich werden, dass Sozialarbeit ein institutioneller Beruf ist.
Da diese Institutionen „rechtlich und finanziell von der Gesellschaft getragen“ (Lüssi, 1992, S.124) werden, hat die Gesellschaft einen Anspruch auf Berücksichtigung ihrer Interessen. Andererseits hat der Klient auf Grund seiner sozial benachteiligten Situation ein Interesse an unterstützenden Maßnahmen, welches den gesellschaftlichen Erwartungen möglicherweise entgegensteht. Kurzum, es geht um Hilfe und Kontrolle. Diese ungleichen Erwartungen werden an den Streetworker in seiner Berufsrolle herangetragen. Hierdurch ergibt sich für diesen ein Konflikt, mit dem es sich auseinanderzusetzen gilt. Ist diese Auseinandersetzung unzureichend, so besteht die Gefahr, dass die konflikthafte Situation sämtliche Tatkraft bindet, die folglich nicht mehr dem Arbeitsprozess zufließen kann. Dies könnte sich negativ auf das Arbeitsergebnis auswirken. Darüber hinaus dürfte ein gering geklärtes Spannungsfeld eine Ursache für hohe berufliche Frustration darstellen.
Vor diesem Hintergrund erscheint die Bearbeitung des Rollenkonflikts, für alle am Konflikt Beteiligten – vor allem jedoch für den Streetworker selbst – als besonders lohnenswert.
Die Auswahl des Arbeitsansatzes Streetwork hat zwei Gründe: Aufsuchende Sozialarbeit vollzieht sich im öffentlichen Raum. Da dieser Raum allen Gesellschaftsmitgliedern zur Verfügung steht und von diesen gestaltet werden kann, ist es denkbar, dass die ungleichen Erwartungen des doppelten Mandats dort besonders ausgeprägt an den Streetworker herangetragen werden.
Der zweite Grund ist ein persönlicher. Der Verfasser der vorliegenden Arbeit war eineinhalb Jahre als Streetworker in Brasilien tätig. Die dortige Tätigkeit war von unterschiedlichen Erwartungen an dessen Rolle und verschiedenartigen Versuchen der Konfliktauseinandersetzung geprägt. Die vorliegende Arbeit setzt die Suche nach Möglichkeiten der Bearbeitung des Rollenkonflikts gewissermaßen fort.
Inhaltsverzeichnis
- Erster Teil - Das Modell vom Inneren Team
- Schulz von Thun und das Modell vom Inneren Team
- Innere Pluralität
- Arbeitstechnik des Modells
- Vielfalt der Teammitglieder
- Herkunft der inneren Stimmen
- Wissenschaftliche Grundlage des Modells
- Das Oberhaupt und die Aufgaben der inneren Führung
- Die innere Ratsversammlung.
- Der Führungsstil
- Innere Teamkonflikte_
- Aufdeckung der Konfliktparteien
- Dialog
- Aussöhnung und Verständigung
- Aufbau und Entwicklung der Persönlichkeit
- Die Antipoden oder der Gegenpol der Stammspieler_
- Erste Ausschlussstufe
- Zweite Ausschlussstufe
- Dritte Ausschlussstufe
- Ausschlussstufe und Abwehrmechanismen
- Stammspieler, Antipoden, Persönlichkeit - ein Fazit
- Variationen der inneren Mannschaftsaufstellung_
- Personenbezogene Grundaufstellung
- Themenbezogene Mannschaftsaufstellung
- Inneres Team und Gehalt einer Situation
- Wie lässt sich eine Situation erfassen?
- Die Stimmigkeit als Ideal
- Kritische Auseinandersetzung mit dem Modell
- Zweiter Teil - Streetwork
- Streetwork - eine Einführung
- Streetwork - Anfänge und Begriffsklärung
- Gesetzliche Grundlage und Finanzierung
- Die Zielsetzung von Streetwork
- Die Zielgruppe von Streetwork
- Die Arbeitsprinzipien von Streetwork
- Tätigkeitsbereiche und Angebote von Streetwork
- Rahmenbedingungen von Streetwork
- Spannungen zwischen Auftrag und Wirklichkeit
- Dritter Teil – Das doppelte Mandat
- Die soziale Rolle – Erwartungen und Konflikt
- Das doppelte Mandat in der Sozialen Arbeit
- Der Auftrag des Arbeitgebers
- Der Auftrag des Klienten
- Das doppelte Mandat im Streetwork
- Vierter Teil - Rollenklärung mit Hilfe des Modells
- Klärung des beruflichen Selbstverständnisses mit Hilfe des Modells
- Die innere Ratsversammlung zum beruflichen Selbstverständnis des Streetworkers
- Identifikation und Anhörung der Teammitglieder
- Brainstorming
- Integrierte Stellungnahme
- Praktischer Nutzen des geklärten beruflichen Selbstverständnisses
- Einfluss des beruflichen Selbstverständnisses auf die Wahl der Arbeitsstelle
- Mannschaftsaufstellung und situativer Kontext_
- Mannschaftsaufstellung im klientenbezogenen Kontext
- Mannschaftsaufstellung im institutionsbezogenen Kontext_
- Fazit der Auseinandersetzung mit dem situativen Kontext
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht den Rollenkonflikt, dem Sozialarbeiter in der aufsuchenden Sozialarbeit aufgrund des doppelten Mandats ausgesetzt sind. Ziel der Arbeit ist es, die Möglichkeiten des Modells vom Inneren Team von Schulz von Thun zur Bearbeitung dieses Konflikts zu analysieren.
- Das Modell vom Inneren Team als Instrument zur Rollenklärung
- Das doppelte Mandat in der Sozialen Arbeit
- Die Herausforderungen des Streetwork
- Der Rollenkonflikt in der aufsuchenden Sozialarbeit
- Die Anwendung des Modells im Kontext von Streetwork
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit widmet sich dem Modell vom Inneren Team von Schulz von Thun. Es wird die Arbeitstechnik des Modells erläutert, die Vielfalt der Teammitglieder beschrieben und die wissenschaftliche Grundlage des Modells beleuchtet. Außerdem werden die Aufgaben der inneren Führung und die Bewältigung von inneren Teamkonflikten betrachtet. Im zweiten Teil wird Streetwork als Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit vorgestellt. Es werden die Anfänge und die Begriffsklärung von Streetwork, die rechtliche Grundlage und Finanzierung, die Zielsetzung und Zielgruppe sowie die Arbeitsprinzipien, Tätigkeitsbereiche und Angebote erläutert. Der dritte Teil beschäftigt sich mit dem doppelten Mandat in der Sozialen Arbeit. Es werden die unterschiedlichen Erwartungen des Arbeitgebers und des Klienten an die Rolle des Sozialarbeiters dargestellt und der Konflikt, der durch diese unterschiedlichen Erwartungen entsteht, analysiert. Der vierte Teil der Arbeit zeigt auf, wie das Modell vom Inneren Team zur Klärung des beruflichen Selbstverständnisses von Streetworkern eingesetzt werden kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der Sozialen Arbeit wie dem doppelten Mandat, dem Rollenkonflikt, der aufsuchenden Sozialarbeit (Streetwork) und dem Modell vom Inneren Team von Schulz von Thun. Die Arbeit analysiert die Möglichkeiten dieses Modells zur Klärung des beruflichen Selbstverständnisses und zur Bewältigung des Rollenkonflikts in der Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das "doppelte Mandat" in der Sozialen Arbeit?
Es beschreibt das Spannungsfeld zwischen dem Auftrag der Gesellschaft (Kontrolle/Interessen der Institution) und dem Auftrag des Klienten (Hilfe/Unterstützung).
Wie hilft das Modell vom "Inneren Team" bei Rollenkonflikten?
Das Modell nach Schulz von Thun ermöglicht es Streetworkern, verschiedene innere Stimmen und Erwartungen zu identifizieren, zu ordnen und zu einer stimmigen Berufsrolle zu integrieren.
Warum ist Streetwork besonders von Rollenkonflikten betroffen?
Da Streetwork im öffentlichen Raum stattfindet, prallen dort gesellschaftliche Kontrollansprüche und die Bedürfnisse marginalisierter Gruppen besonders direkt aufeinander.
Welche Aufgaben hat die "innere Führung" im Modell?
Das "Oberhaupt" des inneren Teams moderiert die verschiedenen Stimmen (z.B. den Helfer, den Beamten), um in schwierigen Situationen handlungsfähig und authentisch zu bleiben.
Was sind die Arbeitsprinzipien von Streetwork?
Zu den Kernprinzipien gehören Freiwilligkeit, Anonymität, Parteilichkeit für den Klienten und die Lebensweltorientierung.
- Citation du texte
- Alexander Maier (Auteur), 2007, Rollenklärung im Spannungsfeld des doppelten Mandats, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89133