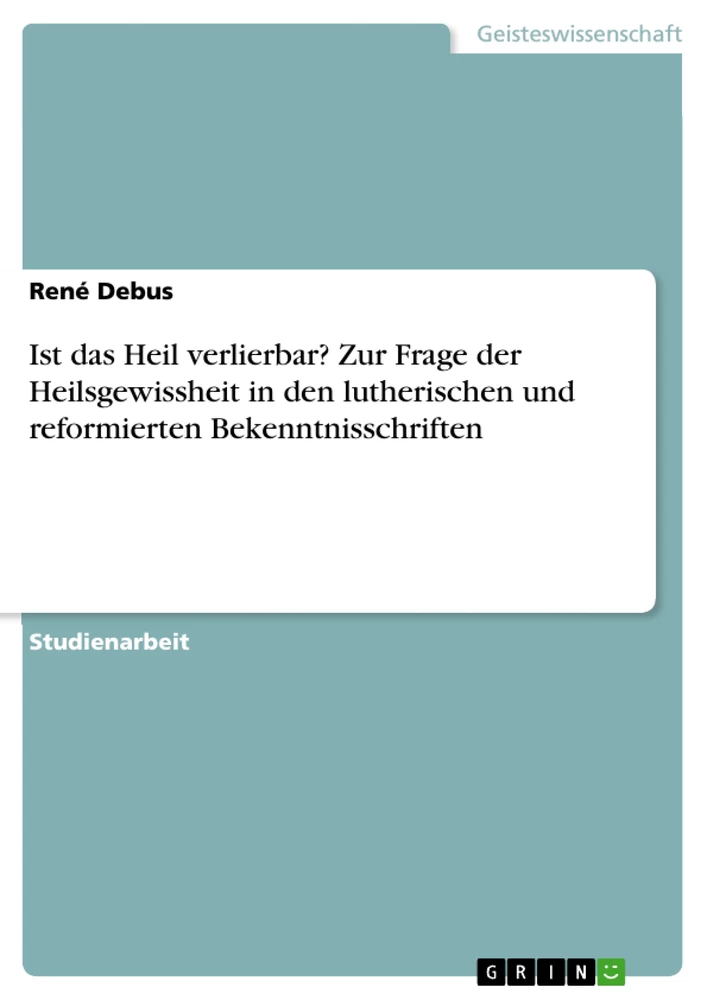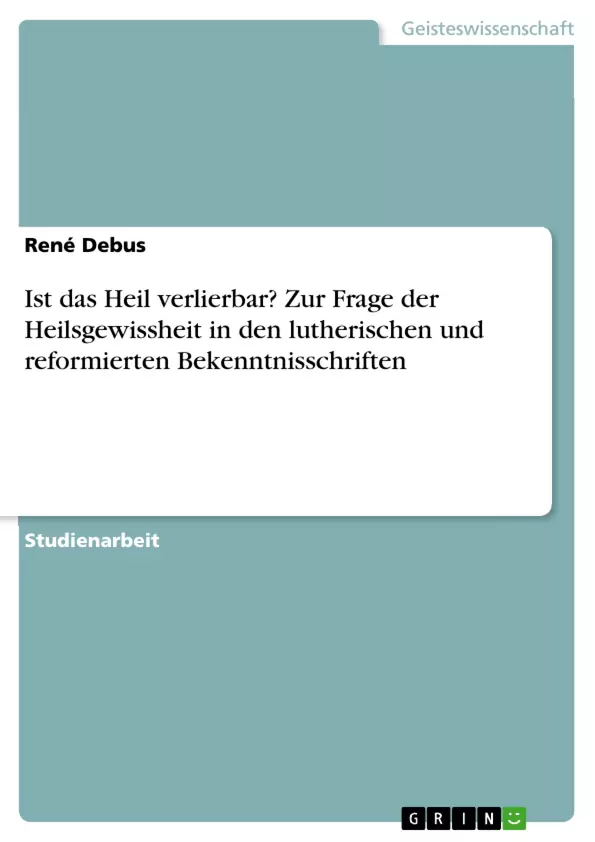Anhand des Gebrauchs des tertius usus legis in den lutherischen und reformierten Bekenntnisschriften soll untersucht werden, was diese beiden großen evangelischen Traditionen zum Thema der Heilsgewissheit zu sagen haben.
Dabei wird vor allem die Zuordnung des theologischen Indikativs und Imperativs in den Bekenntnisschriften untersucht, um von da aus die unterschiedlichen Schlussfolgerungen beider Richtungen zu verstehen.
1 EINLEITUNG:
Die Thematik „Gnadenwahl Gottes und Freiheit des Menschen“ umfaßt eine Vielzahl verschiedener Fragestellungen. Sie ist aufs engste verknüpft mit der Stellung des Menschen zu Gott. Daraus folgt, daß man zunächst kenntlich machen muß, auf welche „Art“ von Mensch man dieses Verhältnis hin untersucht.
Bei ihrer Abhandlung über den „unfreien Willen“ unterscheidet die Konkordienformel zwischen dem Menschen vor dem Sündenfall, nach ihm, nach seiner Rechtfertigung und nach seiner Auferstehung . In dieser Arbeit soll es um den dritten Fall gehen, um die Frage also, wie es um die Verantwortlichkeit des gerechtfertigten Christen gegenüber seiner Erwählung und der damit verbundenen Wirksamkeit Gottes in (und an) ihm bestellt ist. Im Zentrum steht also die menschliche Verantwortung; auf weiterführende Fragen bezüglich der Erwählungslehre, die sich konsequenterweise aus den nachfolgenden Untersuchungen ergeben, kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden.
Dieses Verhältnis zwischen Zuspruch und Anspruch, Gabe und Aufgabe, oder Indikativ und Imperativ ist gekennzeichnet von der Spannung des „schon jetzt“ und des „noch nicht“ im Leben des Christen. Als solcher besitzt er größere Freiheiten und Vorrechte in seinem Handeln als vor seiner Rechtfertigung, aber mit dieser größeren Gabe steht er auch vor einer ganz neuen und ernst zu nehmenden Aufgabe: seiner Heiligung (Hebr.12,14). Dieser menschliche Verantwortungsbereich darf niemals losgelöst von seiner neuen Identität betrachtet werden; der Ruf zum Gehorsam ergeht nicht als „Gebot an ein souveränes, isoliertes Ich, sondern an die Heiligen, d.h. die Christus Gehörigen.“ Wo diese Wechselwirkung nicht beachtet wird, „da wird das Gebot Gottes des Versöhners in der Wurzel verfälscht“ .[...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE NEUE SCHÖPFUNG (EINORDNUNG DES INDIKATIVS)
- DIE RECHTFERTIGUNG ALS GRUNDLAGE..
- DIE FREIHEIT ALS KENNZEICHEN..
- GOTT ALS GEGENÜBER..
- LIEBE ALS MOTIVATION..
- HEILIGUNG ALS VERANLAGUNG....
- DER NEUE GEHORSAM (EINORDNUNG DES IMPERATIVS) ...........
- DAS FRUCHT-MOTIV.
- DAS SOLLENS-MOTIV..
- DIE FRAGE DER HEILSSICHERHEIT.
- BEI CALVIN UND LUTHER…..\n
- PERSÖNLICHE STELLUNGNAHME.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage der Heilsgewissheit im Kontext der lutherischen und reformierten Bekenntnisschriften. Sie untersucht die Auswirkungen des „tertius usus legis“, also den praktischen Vollzug des Gesetzes im Leben des Gerechtfertigten, auf die Verantwortlichkeit des Christen gegenüber seiner Erwählung und die Wirksamkeit Gottes in ihm. Im Zentrum steht die Spannung zwischen dem Zuspruch (Indikativ) und dem Anspruch (Imperativ), der „schon jetzt“ und dem „noch nicht“ im Leben des Christen.
- Die Bedeutung der Rechtfertigung als Grundlage der neuen Schöpfung
- Der neue Gehorsam als Ausdruck der Freiheit und Verantwortung des Christen
- Die Frage nach der Heilsgewissheit in den Positionen von Calvin und Luther
- Die Herausarbeitung einer eigenen Position zur Frage, ob das Heil verlierbar ist
- Die Bedeutung des „tertius usus legis“ für die Soteriologie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und beleuchtet die Verbindung zwischen Gnadenwahl Gottes und der menschlichen Freiheit. Sie erläutert den Fokus auf die Verantwortung des gerechtfertigten Christen und die Relevanz des „tertius usus legis“ für die Thematik.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der „neuen Schöpfung“ des Christen, die durch die Rechtfertigung stattfindet. Hier werden die neuen Lebensbedingungen des Christen betrachtet, darunter die Freiheit, die Beziehung zu Gott und die Motivation zur Liebe.
Im dritten Kapitel wird der „neue Gehorsam“ des Christen betrachtet. Dabei werden das „Frucht-Motiv“ und das „Sollens-Motiv“ des Imperativs beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind die Heilsgewissheit, die Rechtfertigung, der „tertius usus legis“, der Indikativ und Imperativ, die Freiheit und Verantwortung des Christen sowie die Positionen von Calvin und Luther. Die Arbeit fokussiert sich auf die Soteriologie, die Lehre vom Heil, im Kontext der lutherischen und reformierten Bekenntnisschriften.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Heilsgewissheit" in der evangelischen Tradition?
Es beschreibt die Sicherheit des Gläubigen, durch Gottes Gnade gerettet zu sein, und untersucht, wie diese Gewissheit im Alltag aufrechterhalten wird.
Was ist der "tertius usus legis"?
Der "dritte Gebrauch des Gesetzes" bezieht sich auf die Funktion des göttlichen Gesetzes als Richtschnur für das Leben des bereits gerechtfertigten Christen.
Wie unterscheiden sich Luther und Calvin in der Frage der Heilsgewissheit?
Die Arbeit untersucht die Nuancen zwischen der lutherischen und reformierten Auffassung bezüglich der Erwählung und der menschlichen Verantwortung.
Ist das Heil nach lutherischer Lehre verlierbar?
Diese zentrale Frage wird anhand der Spannung zwischen Gottes Zuspruch (Indikativ) und dem menschlichen Gehorsam (Imperativ) in den Bekenntnisschriften analysiert.
Welche Rolle spielt die Heiligung im Leben eines Christen?
Heiligung wird nicht als Voraussetzung für das Heil, sondern als Frucht und Veranlagung der "neuen Schöpfung" nach der Rechtfertigung verstanden.
Was ist das "Frucht-Motiv" im neuen Gehorsam?
Es beschreibt den Gehorsam als natürliches Ergebnis des Glaubens, ähnlich wie ein guter Baum gute Früchte hervorbringt.
- Quote paper
- René Debus (Author), 2003, Ist das Heil verlierbar? Zur Frage der Heilsgewissheit in den lutherischen und reformierten Bekenntnisschriften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/89072