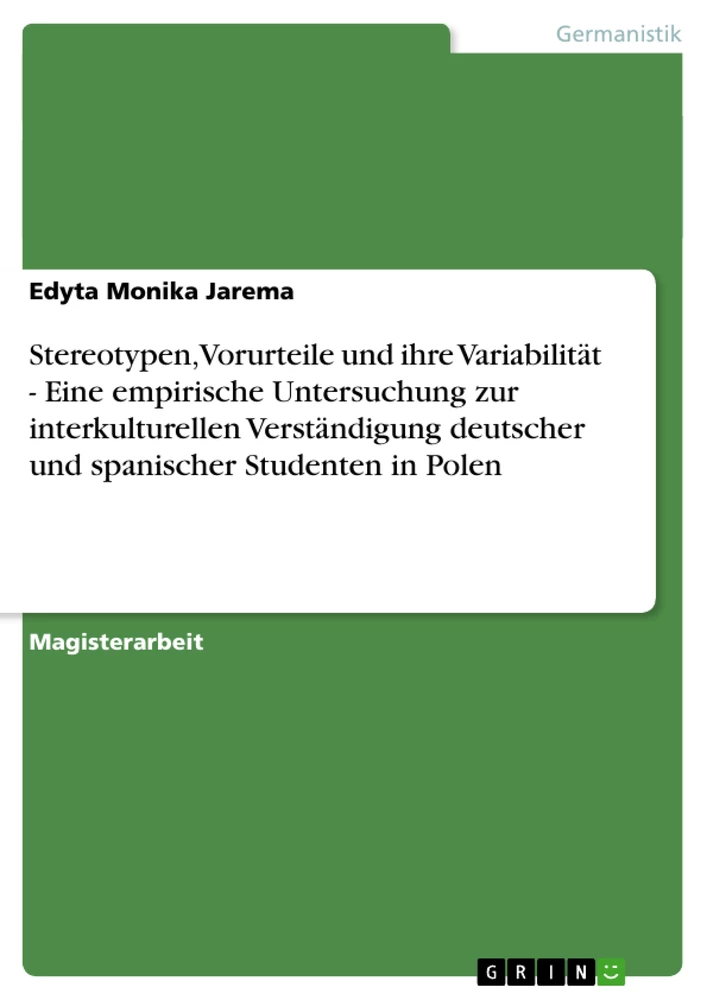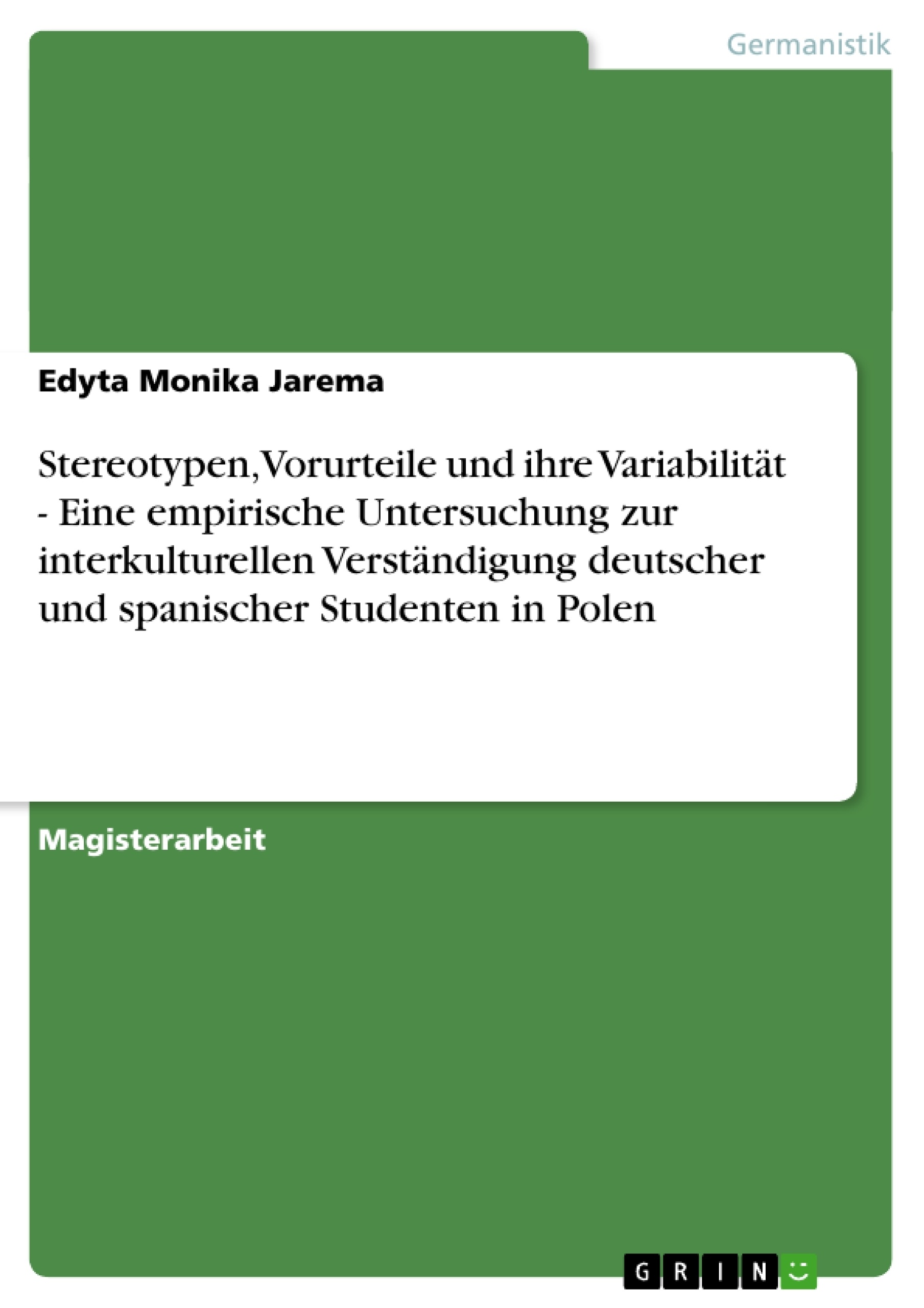Das Ziel meiner Arbeit ist zu beweisen, dass zwischen vielen allgemein bekannten Stereotypen und dem tatsächlichen Bild eines fremden Landes eine große Diskrepanz besteht. Es wird gezeigt, dass Stereotype nach der unmittelbaren Konfrontation mit einem fremden Land an Bedeutung verlieren und Vorurteile abgebaut werden. Diese Arbeit stellt dar, wie Polen und seine Einwohner von den Personen, die eine gewisse Zeit in Polen verbracht haben, wahrgenommen werden.
Außerdem dienen die in dieser Arbeit zusammengefassten Forschungsergebnisse dem Vergleich deutscher und spanischer Stereotypen, Meinungen und Urteile bezüglich Polen.
Im interkulturellen Diskurs dient diese Arbeit der Förderung der polnischen Landeskunde und Vertiefung des Verständnisses zwischen den Menschen verschiedener Herkunft. Sie soll zu einem aufgeklärten Umgang mit Stereotypen und Vorurteilen anregen. Eine kritisch-reflektierende Haltung gegenüber Stereotypen kann der erste Schritt in Richtung ihrer Relativierung und Abschwächung sein.
Den Ausgangspunkt meiner Ausführungen bilden zwei Thesen:
1. Auf Grund seiner psychischen Beschaffenheit ist es unmöglich, den Menschen als ein stereotyp- und vorurteilsfreies Objekt zu betrachten.
2. Durch die unmittelbare Konfrontation mit einem fremden Land können ethnische Vorurteile und Klischees ihre Bedeutung verlieren.
Obwohl die Termini „Stereotyp“ und „Vorurteil“ im alltäglichen Verbrauch meistens beinahe synonymisch verwendet werden, zeigt sich bei einer genaueren semantischen Betrachtung, dass sie sich doch voreinander abheben. Im Rahmen dieser Arbeit wird das Stereotyp als ein Element des Orientierungswissens der Gesellschaft verstanden. Es ist ein Urteil über eine soziale bzw. ethnische Gruppe, das eine positive, negative oder neutrale Bedeutung vornimmt. Mit dem Vorurteil ist dagegen ein gefühlsmäßig unterbautes Urteil gemeint, das eindeutig negative Züge hat.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1.1. Das Konzept des ersten Teils der empirischen Forschung und Auswahlkriterien der Probanden
- 1.2. Das Konzept des zweiten Teils der empirischen Forschung
- II. Einführung in die Problematik der Stereotype und Vorurteile
- 2.1. Terminologische Abgrenzung: „Stereotyp“ und „Vorurteil“
- 2.2. Analyse des Vorurteils
- 2.2.1. Vorurteil. Begriffserklärung
- 2.2.2. Funktionen von Vorurteilen
- 2.3. Analyse des Stereotyps
- 2.3.1. Stereotyp. Begriffserklärung
- 2.3.2. Der Lippmann'sche Stereotypenansatz
- 2.3.3. Funktionen von Stereotypen
- III. Erster Teil der empirischen Forschung: Umfragen
- 3.1. Umfrage Nr. 1: Aspekte des Lebens in Polen (freie Antworten)
- 3.2.1. Erläuterung zu den Umfragekategorien
- 3.2.2. Assoziationskategorie 1: Stereotype und Vorurteile
- 3.2.3. Assoziationskategorie 2: Geschichte
- 3.2.4. Assoziationskategorie 3: Alltagsleben
- 3.2.5. Assoziationskategorie 4: Charaktereigenschaften
- 3.2.6. Assoziationskategorie 5: politische Situation
- 3.2.7. Assoziationskategorie 6: Religion
- 3.2.8. Assoziationskategorie 7: Universitätssystem
- 3.2.9. Zusammenfassung
- 3.3.1. Umfrage Nr. 2: polnische Charaktereigenschaften
- 3.4.1. Umfrage Nr. 3: Aspekte des Lebens in Polen (standarisierter Fragebogen)
- IV. Zweiter Teil der empirischen Forschung: Interviews
- 4.1. Interviews mit Deutschen
- 4.1.1. Interview 1: Corina Ludwig
- 4.1.2. Interview 2: Susanne Kramer-Drużycka
- 4.1.3. Interview 3: Claudia Frehse
- 4.2. Interviews mit Spaniern
- 4.2.1. Interview 1: Roberto Gonzalez
- 4.2.2. Interview 2: Alberto Cerezo Soto
- 4.2.3. Interview 3: Conchi Martinez Soto
- 4.2.4. Interview 4: Oliver Alba
- 4.2.5. Erläuterung zu den durchgeführten Interviews
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Diskrepanz zwischen gängigen Stereotypen und der tatsächlichen Realität eines fremden Landes, in diesem Fall Polen. Sie möchte zeigen, wie die unmittelbare Konfrontation mit einer neuen Kultur dazu führen kann, dass Stereotype an Bedeutung verlieren und Vorurteile abgebaut werden. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Wahrnehmung Polens und seiner Einwohner durch Personen, die eine Zeitlang in Polen verbracht haben, und auf dem Vergleich deutscher und spanischer Stereotypen, Meinungen und Urteile bezüglich Polen.
- Das Konzept der Stereotype und Vorurteile und ihre terminologische Abgrenzung
- Die Analyse von Stereotypen und Vorurteilen und ihre Funktionen
- Die Anwendung empirischer Forschungsmethoden, wie Umfragen und Interviews, zur Erforschung der Stereotypen und Vorurteile
- Der Vergleich der Wahrnehmung Polens durch deutsche und spanische Studenten
- Die Förderung der polnischen Landeskunde und das Verständnis zwischen Menschen verschiedener Herkunft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Stereotype und Vorurteile ein und stellt das Ziel der Arbeit vor: zu beweisen, dass zwischen gängigen Stereotypen und der tatsächlichen Realität eine Diskrepanz besteht. Sie erläutert die Verwendung von empirischen Forschungsmethoden, um die Relevanz von Stereotypen nach der unmittelbaren Konfrontation mit einem fremden Land zu untersuchen. In Kapitel II wird die Problematik der Stereotype und Vorurteile genauer betrachtet, wobei die terminologische Abgrenzung der Begriffe „Stereotyp“ und „Vorurteil“ sowie die Analyse und Funktionen der beiden Konzepte beleuchtet werden. Der Lippmann'sche Stereotypenansatz wird dabei ebenfalls vorgestellt.
Kapitel III befasst sich mit dem ersten Teil der empirischen Forschung: Umfragen. Es werden verschiedene Umfragen, wie z.B. Aspekte des Lebens in Polen und polnische Charaktereigenschaften, vorgestellt und analysiert. Die Zusammenfassung der Ergebnisse aus verschiedenen Kategorien (Stereotype und Vorurteile, Geschichte, Alltagsleben, Charaktereigenschaften, politische Situation, Religion und Universitätssystem) wird ebenfalls dargestellt. Kapitel IV präsentiert den zweiten Teil der empirischen Forschung: Interviews. Es werden Interviews mit deutschen und spanischen Studenten analysiert, die Einblicke in ihre persönliche Wahrnehmung Polens liefern. Die Interviews beleuchten verschiedene Themen, wie z.B. kulturelle Unterschiede, Lebenserfahrungen in Polen und die Rolle von Stereotypen und Vorurteilen.
Schlüsselwörter
Stereotype, Vorurteile, Interkulturelle Verständigung, Empirische Forschung, Umfragen, Interviews, Polen, Deutschland, Spanien, Landeskunde, Kulturvergleich.
- Quote paper
- Edyta Monika Jarema (Author), 2003, Stereotypen, Vorurteile und ihre Variabilität - Eine empirische Untersuchung zur interkulturellen Verständigung deutscher und spanischer Studenten in Polen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88856