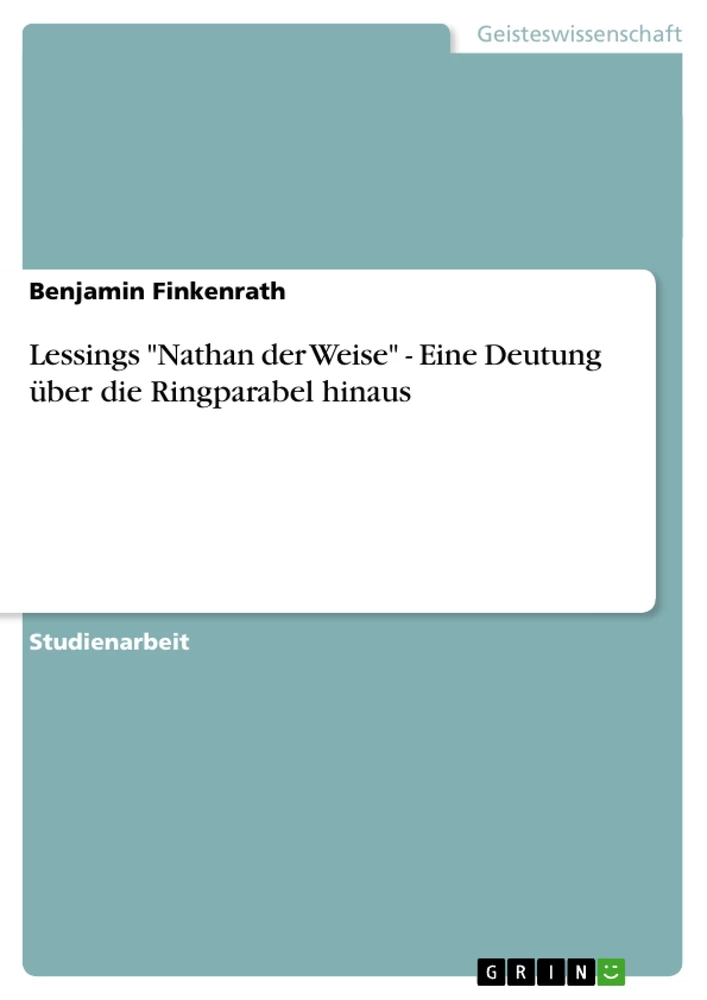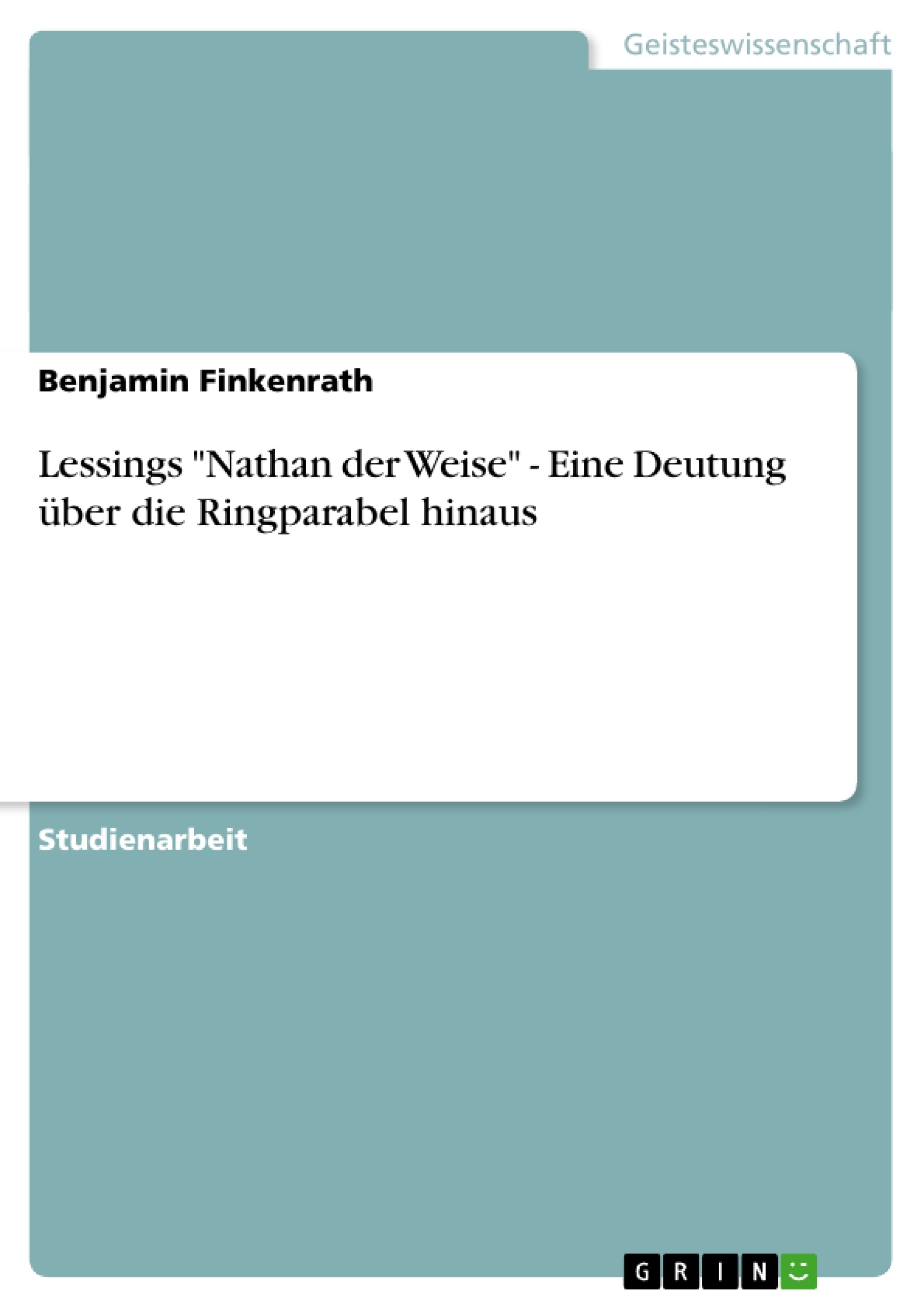Es gibt viele verschiedene Religionen, deren Anhänger überzeugt sind dem wahren Glauben anzugehören. Da es keine objektiven Kriterien gibt, die von allen Gruppen anerkannt werden um zu klären, wer den wahren Glauben besitzt, ist diese Frage nicht zu beantworten. Es bleibt dem Gläubigen nur an die seine zu glauben.
Diese Ungewissheit und die daraus resultierende Intoleranz Andersgläubigen gegenüber führ-ten schon immer zu Konflikten zwischen den Menschen. So gab es z.B. die Kreuzzüge, zu deren Zeit das hier behandelte Bühnenstück spielt; es gibt den Konflikt in Nordirland, die nicht enden wollenden Kämpfe im heutigen Israel und den islamistischen Terror.
Viele der Konflikte sind zwar politischen Ursprungs und wurden erst im Nachhinein als Konflikte der Religionen bezeichnet und "gerechtfertigt". Doch diese "Rechtfertigung" reichte und reicht noch immer aus um die verschiedenen Gläubigen gegeneinander aufzubringen.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem 1779 von Gotthold Ephraim Lessing geschriebenen Stück „Nathan der Weise“. Es handelt von den drei monotheistischen Religionen, ihrem sub-jektivem Wahrheitsanspruch und ihrem Verhältnis zu einander.
Um sich den Aussagen, die Lessing mit seinem Werk vermitteln wollte, anzunähern werden zunächst das Stück und sein Inhalt vorgestellt. Der darauf folgende Abschnitt beschäftigt sich kurz mit Lessing selbst. Im Anschluss daran werde ich die Hauptaussagen und die Wirkungs-geschichte des Dramas herausarbeiten. Dabei ist besonders erwähnenswert, dass Lessing nicht wie die Ringparabel ein harmonisches Nebeneinander der Religionen anstrebt, sondern seine Wunschvorstellung deutlich weiter geht.
Nach der allgemeinen Betrachtung des Stückes folgt eine kurze Vorstellung des Berliner Ensembles und dessen Inszenierung des "Nathan", die am 5. Januar 2002 Premiere feierte und nun seid über sechs Jahren zum Repertoire des Brechtschen Theaters gehört.
Am Ende der Arbeit wird die „Ringparabel“ mit einer dazu gehörigen Interpretation stehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Stück...
- 3. Die Handlung des Stücks
- 4. Die Komposition der Handlung
- 5. Gotthold Ephraim Lessing
- 6. Die Aussage des Stücks..
- 7. Die Geschichte des Stücks
- 8. Das Berliner Ensemble und seine Inszenierung.
- 9. Die Ringparabel..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Lessings Stück „Nathan der Weise“ und untersucht die Darstellung der drei monotheistischen Religionen, ihren subjektiven Wahrheitsanspruch und ihr Verhältnis zueinander. Das Werk wird in Bezug auf seinen historischen Kontext und Lessings Intentionen analysiert. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Lessing ein harmonisches Nebeneinander der Religionen anstrebt oder eine weitergehende Vision verfolgt.
- Religionsverständnis und Toleranz
- Der Konflikt zwischen Vernunft und Glaube
- Die Rolle der Ringparabel im Stück
- Lessings literarisches Werk und seine Bedeutung
- Die Inszenierung von „Nathan der Weise“ durch das Berliner Ensemble
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des religiösen Pluralismus und die damit verbundenen Konflikte dar. Sie führt in Lessings Stück „Nathan der Weise“ ein, das die drei monotheistischen Religionen thematisiert. Kapitel 2 gibt einen Überblick über das Stück und seine Entstehung. Kapitel 3 beschreibt die Handlung des Stückes, während Kapitel 4 die Komposition der Handlung analysiert. Kapitel 5 beleuchtet Lessings Leben und Werk im Kontext der damaligen Zeit. Kapitel 6 beschäftigt sich mit den Hauptaussagen des Dramas und seiner Wirkungsgeschichte. Kapitel 8 präsentiert die Inszenierung von „Nathan der Weise“ durch das Berliner Ensemble. Kapitel 9 erläutert die Ringparabel und ihre Bedeutung im Stück.
Schlüsselwörter
Gotthold Ephraim Lessing, „Nathan der Weise“, Ringparabel, Toleranz, Religionsdialog, Monotheismus, Aufklärung, Vernunft, Glaube, Berliner Ensemble, Theater, Inszenierung.
- Quote paper
- Benjamin Finkenrath (Author), 2008, Lessings "Nathan der Weise" - Eine Deutung über die Ringparabel hinaus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88853