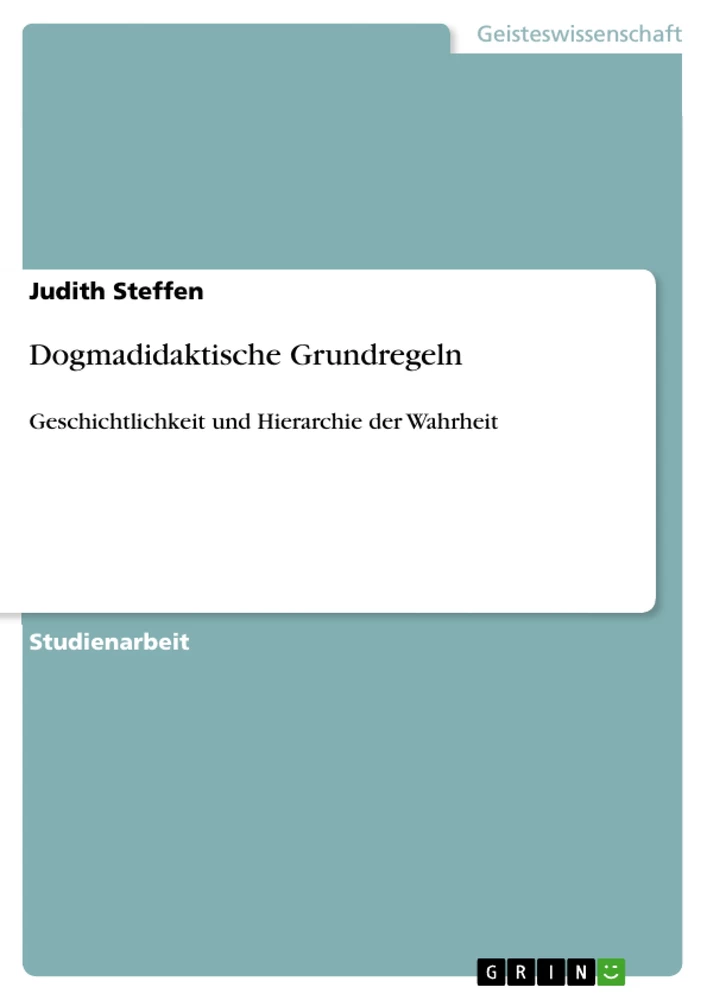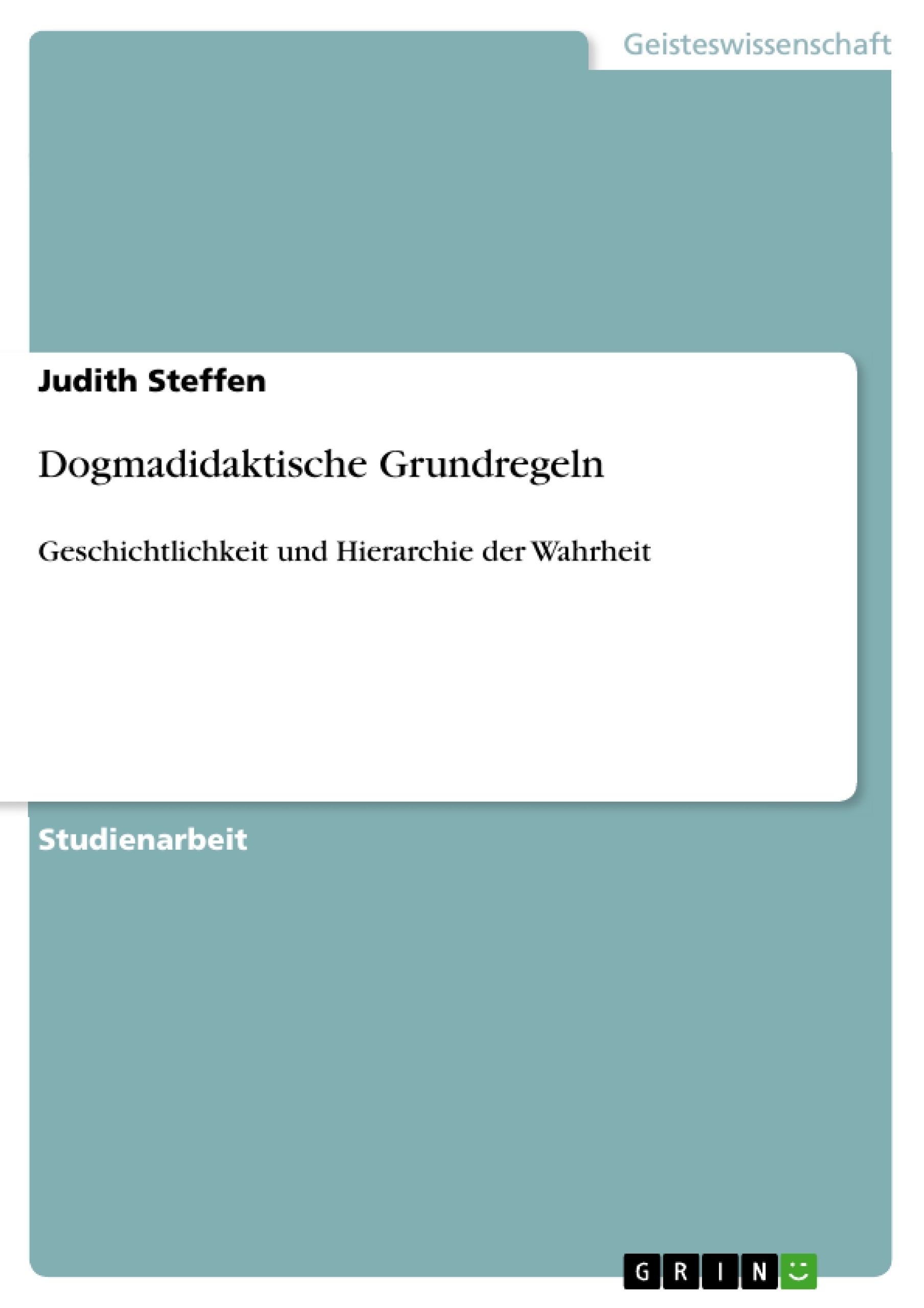Dogmen stellen für die katholische Kirche die absolute Wahrheit dar. Sie sind unanfechtbare Glaubensformeln, die von Stellvertretern Christi verfasst wurden. Die Vermittlung dieser Wahrheiten stellen im Religionsunterricht eine besondere Herausforderung dar. Vielen Schülern erscheinen Dogmen fremdartig und abweisend. Sie sehen in den Glaubenslehren ein starres, unveränderliches Gebilde, dass für ihr Leben keine Bedeutung hat. Sie sehen keinen Zusammenhang zwischen ihrem eigenen Glauben und den vorgegebenen Formeln.
Im Religionsunterricht gilt es, diese Vorurteile abzubauen und die Dogmen den Schülern zugänglich zu machen. Dazu muss die Lebensbedeutsamkeit der Dogmen aufgezeigt, der Hintergrund der Entstehung betrachtet, die Wahrheiten gegeneinander abgewogen, die Glaubenswahrheiten elementarisiert und die richtigen Methoden ausgewählt werden.
In Kapitel zwei gebe ich eine kurze Einführung in die Dogmen der katholischen Kirche. Im
dritten Kapitel beschreibe ich verschiedene Möglichkeiten, Dogmen im Religionsunterricht zu
behandeln. Mit einem Ansatz von Engelbert Groß zur Dogmadidaktik beschäftige ich mich
im ersten Teil des dritten Kapitels. Um die religiösen Bedürfnisse von Kindern geht es im
zweiten Teil dieses Kapitels. Der dritte Teil beleuchtet die Auswirkungen des II. Vatikanischen
Konzils auf die Religionspädagogik. Der Begriff Dogma kommt aus dem Hellenismus und ist mit der Grundbedeutung „was als
richtig erschienen ist“ aus dem griechischen zu übersetzen. Im Neuen Testament wird der
Begriff Dogma in verschiedenen Zusammenhängen erwähnt: zum Einen in der Apostelgeschichte
als Beschlüsse des Apostelkonzils (Apg 16,4), dann als kaiserlicher Befehl (z.B. Lk
2,1) und zudem als durch Christus aufgehobene Satzungen der Tora (z.B. Eph 2,15). In der
alten Kirche wird der Ausdruck vom Christentum zur Kennzeichnung einer verbindlichen
Ordnungsentscheidung rezipiert und steht ab dem 2. Jahrhundert für das verbindliche Ganze
der christlichen Lehre. Der Begriff Dogma behält aber weiterhin seine Mehrdeutigkeit (z.B.:
Weisung Gottes oder der Apostel, menschliche Lehre, Naturgesetz, kaiserlicher Beschluss).
Erst ab dem 18. Jahrhundert wurde der Begriff im heutigen Sinne verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Dogmen
- 2.1 Definition Dogma
- 2.2 Dogmen der Katholischen Kirche
- 3. Dogmatik
- 3.1 Dogmatikdidaktische Grundregeln (nach Engelbert Groß)
- 3.2 Religiöse Bedürfnisse der Kinder (nach Rudolf Englert)
- 3.3 Bedeutung des II. Vatikanums für die Religionspädagogik
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen der Vermittlung von Dogmen im Religionsunterricht. Sie beleuchtet verschiedene Ansätze, Dogmen für Schüler zugänglich und lebensbedeutsam zu machen. Die Arbeit analysiert die Bedeutung des historischen Kontextes, die Abwägung von Wahrheiten und die Auswahl geeigneter Methoden.
- Definition und historische Entwicklung des Begriffs "Dogma"
- Dogmen der Katholischen Kirche und ihre Systematik
- Didaktische Ansätze zur Vermittlung von Dogmen im Religionsunterricht
- Die Rolle religiöser Bedürfnisse von Kindern im Religionsunterricht
- Der Einfluss des II. Vatikanischen Konzils auf die Religionspädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die zentrale Herausforderung, Dogmen im Religionsunterricht verständlich und relevant für Schüler zu vermitteln. Sie hebt die Notwendigkeit hervor, Vorurteile gegenüber Dogmen abzubauen und deren Lebensbedeutsamkeit aufzuzeigen. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die behandelten Themenbereiche, die eine Auseinandersetzung mit der Definition von Dogmen, didaktischen Ansätzen und dem Einfluss des II. Vatikanums umfassen.
2. Dogmen: Dieses Kapitel beginnt mit einer detaillierten Erläuterung des Begriffs "Dogma", seiner historischen Entwicklung und seiner vielschichtigen Bedeutung im Kontext des Neuen Testaments und der alten Kirche. Es analysiert die Eigenschaften eines Dogmas, einschließlich des göttlichen Ursprungs, der Wahrheitsansprüche, der Glaubenspflicht und der Unveränderlichkeit. Im zweiten Unterkapitel werden die Dogmen der Katholischen Kirche in ihren verschiedenen Kategorien und Einteilungsmöglichkeiten behandelt, wobei die Vielschichtigkeit und die hierarchische Struktur des Glaubens hervorgehoben wird. Die Diskussion um die Unveränderlichkeit der Dogmen wird eingeordnet in den Kontext ihrer Entwicklungsfähigkeit und Anpassung an neue Kontexte.
3. Dogmatik: Dieses Kapitel widmet sich verschiedenen didaktischen Ansätzen zur Vermittlung von Dogmen im Religionsunterricht. Es präsentiert den Ansatz von Engelbert Groß zur Dogmatikdidaktik als einen wichtigen Bezugspunkt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Berücksichtigung der religiösen Bedürfnisse von Kindern, um die Dogmen für sie verständlich und relevant zu gestalten. Schließlich wird der Einfluss des II. Vatikanischen Konzils auf die Religionspädagogik und die damit einhergehende Veränderung im Umgang mit Dogmen analysiert. Die Kapitel zeigen auf, wie die Berücksichtigung der kindlichen Perspektive, der historischen Kontextualisierung und des Dialogs zwischen Glauben und Vernunft den Religionsunterricht bereichern können.
Schlüsselwörter
Dogma, Dogmatikdidaktik, Religionspädagogik, Katholische Kirche, II. Vatikanisches Konzil, Glaubensvermittlung, Religiöse Bedürfnisse, Engelbert Groß, Rudolf Englert, Geschichtlichkeit des Dogmas, Wahrheitsanspruch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Vermittlung von Dogmen im Religionsunterricht
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Vermittlung von Dogmen im Religionsunterricht. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, Zielsetzungen und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Herausforderungen der verständlichen und lebensbedeutsamen Vermittlung von Dogmen an Schüler.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt zentrale Aspekte der Dogmenvermittlung, darunter die Definition und historische Entwicklung des Begriffs "Dogma", die Dogmen der Katholischen Kirche und ihre Systematik, didaktische Ansätze zur Vermittlung von Dogmen im Religionsunterricht, die Berücksichtigung religiöser Bedürfnisse von Kindern und den Einfluss des II. Vatikanischen Konzils auf die Religionspädagogik. Es werden auch die Ansätze von Engelbert Groß und Rudolf Englert diskutiert.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in verschiedene Abschnitte gegliedert: Einleitung, ein Kapitel zu Dogmen (inkl. Definition und Dogmen der Katholischen Kirche), ein Kapitel zur Dogmatik (inkl. didaktische Ansätze und Berücksichtigung kindlicher Bedürfnisse sowie Einfluss des II. Vatikanums), und eine Zusammenfassung. Es enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis und eine Liste mit Schlüsselbegriffen.
Welche didaktischen Ansätze werden vorgestellt?
Das Dokument präsentiert den Ansatz von Engelbert Groß zur Dogmatikdidaktik als einen wichtigen Bezugspunkt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Berücksichtigung der religiösen Bedürfnisse von Kindern nach Rudolf Englert, um die Dogmen für sie verständlich und relevant zu gestalten. Der Einfluss des II. Vatikanischen Konzils auf die Religionspädagogik und den Umgang mit Dogmen wird ebenfalls analysiert.
Welche Bedeutung hat das II. Vatikanische Konzil für die Religionspädagogik?
Das Dokument untersucht den Einfluss des II. Vatikanischen Konzils auf die Religionspädagogik und die damit einhergehende Veränderung im Umgang mit Dogmen. Es zeigt auf, wie die Berücksichtigung der kindlichen Perspektive, der historischen Kontextualisierung und des Dialogs zwischen Glauben und Vernunft den Religionsunterricht bereichern können.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Dokument?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Dogma, Dogmatikdidaktik, Religionspädagogik, Katholische Kirche, II. Vatikanisches Konzil, Glaubensvermittlung, Religiöse Bedürfnisse, Engelbert Groß, Rudolf Englert, Geschichtlichkeit des Dogmas, Wahrheitsanspruch.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Zielsetzung des Dokuments ist die Untersuchung der Herausforderungen der Vermittlung von Dogmen im Religionsunterricht und die Beleuchtung verschiedener Ansätze, Dogmen für Schüler zugänglich und lebensbedeutsam zu machen. Es analysiert die Bedeutung des historischen Kontextes, die Abwägung von Wahrheiten und die Auswahl geeigneter Methoden.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Lehrer, Theologen, Religionspädagogen und alle, die sich mit der Vermittlung von Dogmen im Religionsunterricht auseinandersetzen. Es bietet einen wertvollen Einblick in die didaktischen Herausforderungen und möglichen Lösungsansätze.
- Arbeit zitieren
- Judith Steffen (Autor:in), 2007, Dogmadidaktische Grundregeln, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88788