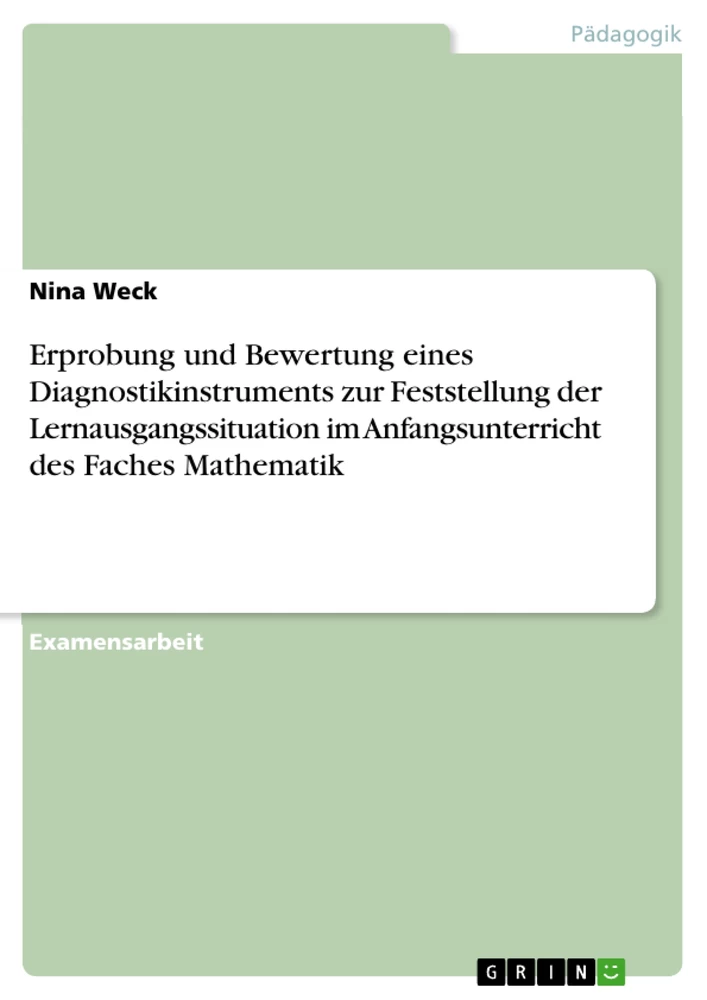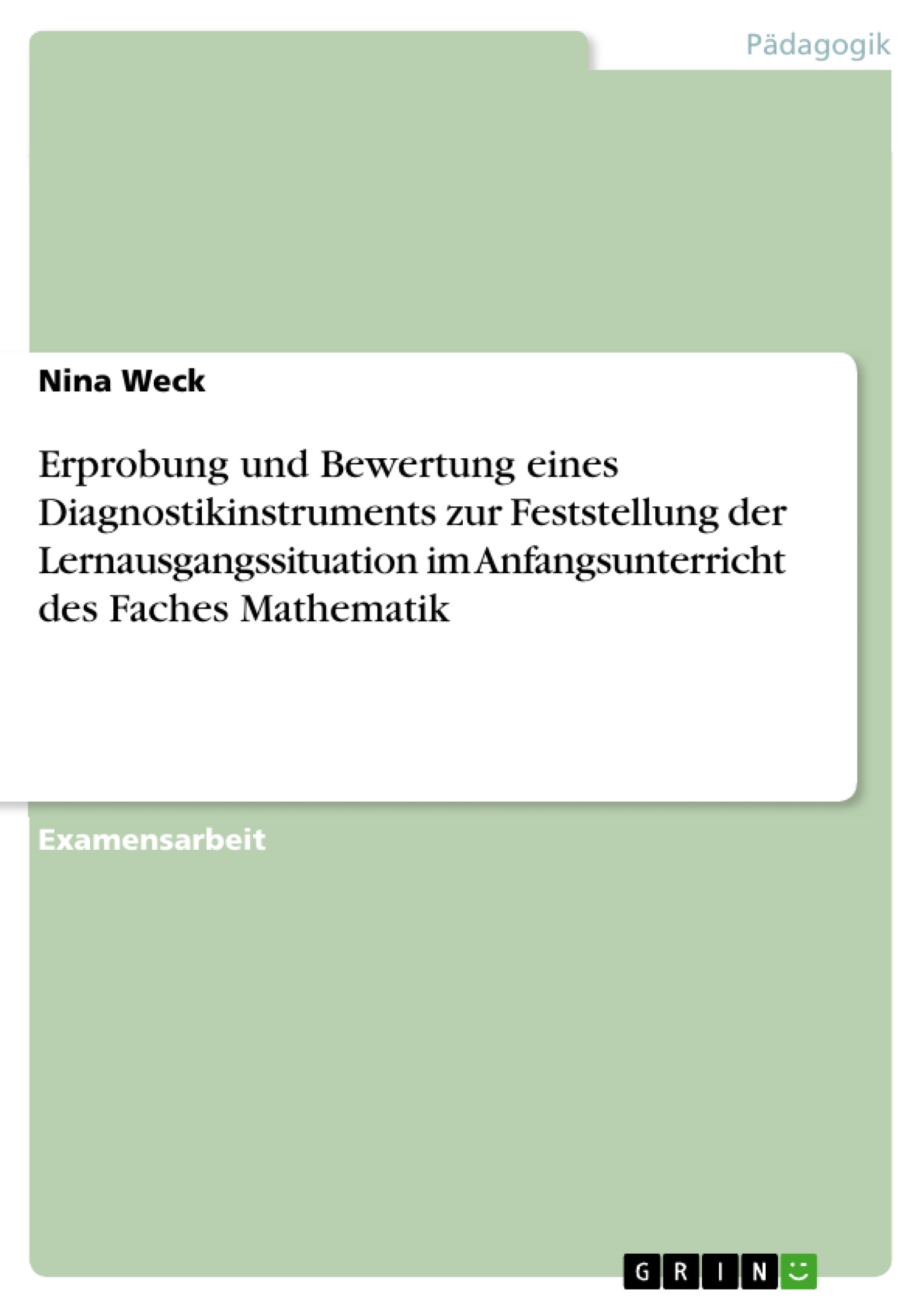Man geht davon aus, dass das mathematische Wissen bei Kindern nicht erst bei Schuleintritt entwickelt wird, sondern aufbaut auf Vorwissen und Fähigkeiten, die im Kleinkind- und Kindergartenalter erworben werden. Kinder verfügen in diesem Alter bereits über ein beträchtliches, zahlenbezogenes Wissen.
Eine differenzierte Erfassung dieser Vorläuferfertigkeiten stellt die Voraussetzung dar für eine mögliche Vorhersage späterer Schulleistung. Außerdem sind diese Untersuchungen über den Stand der Zahlbegriffsentwicklung bei Schulanfängern wichtig und nützlich, zum einen, um falschen oder umständlichen Denkstrukturen von vornherein entgegenzuwirken, zum anderen, um einen Veränderungsprozess beobachten zu können. Hasemann fand in seinen Untersuchungen heraus, dass es auch heute noch eine riesige Bandbreite in den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schulanfänger gibt, die nicht nur einzelne Kinder betreffen sondern auch ganze Schulklassen, sogar solche an der gleichen Schule (vgl.: Hasemann, 2003, S. 2).
Aus diesem Grund ist es unumgänglich, spätestens bei Schuleintritt den Lernstand der Kinder festzustellen, um auf ihren individuellen Leistungsstand im Unterricht von Anfang an eingehen zu können (vgl.: Weinhold Zulauf / Schweiter / von Aster, 2003). Dabei ist nicht nur die Möglichkeit zur Förderung der schwächeren Schüler zu berücksichtigen. Auch begabte Schüler sollten frühzeitig erkannt werden, um ihre Begabung von Beginn an zu fördern. Nicht im Sinne einer elitären Bildung sondern in Form einer optimalen Förderung durch den Lehrer, der so gezielt und individuell auf den Schüler eingehen kann.
Die folgende Arbeit beschäftigt sich zum Einen mit bestehenden Lernstandsdiagnosen wie beispielsweise dem OTZ, ZAREKI und LISUM und vergleicht diese miteinander. Zum Anderen werden die daraus gewonnen Erkenntnisse bei der Entwicklung eines Diagnoseinstruments für die Lernausgangslage von Schulanfängern berücksichtigt und zugrundegelegt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Wie kam ich zu der Arbeit?
- 2. Bestehende Tests zur Lernstandsanalyse
- 2.1 OTZ
- 2.1.1 Beschreibung des Tests
- 2.1.2 Kritik am OTZ
- 2.2 ZAREKI
- 2.2.1 Beschreibung des Tests
- 2.2.2 Kritik an der ZAREKI
- 2.3 LISUM
- 2.3.1 Beschreibung des Tests
- 2.3.2 Kritik an der LISUM
- 3. Der erste Test
- 3.1 Die Stichprobe des ersten Tests
- 3.2 Beschreibung des ersten Tests
- 3.2.1 Farben und Formen
- 3.2.2 Vergleichen
- 3.2.3 Mengen vergleichen
- 3.2.4 Invarianz
- 3.2.5 Zahlen lesen
- 3.2.6 Zahlen ordnen
- 3.2.7 Simultane Zahlerfassung
- 3.3 Zusammenfassung
- 4. Der zweite Test
- 4.1 Die Stichprobe des zweiten Tests
- 4.2 Beschreibung des zweiten Tests
- 4.2.1 Zahlwortreihe
- 4.2.2 Ziffer erkennen
- 4.2.3 Anzahlen erkennen
- 4.2.4 Ziffern <-> Mengen
- 4.2.5 Quasi simultane Zahlerfassung
- 4.2.6 Operationen
- 4.3 Zusammenfassung
- 5. Beurteilung des zweiten Tests durch unterrichtende Lehrer
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die Entwicklung und Evaluierung eines Diagnoseinstruments zur Erfassung der mathematischen Lernvoraussetzungen von Schulanfängern. Ziel ist die Erstellung eines praktikablen Tests, der Lehrkräften detaillierte Einblicke in den individuellen Lernstand ihrer Schüler ermöglicht, ohne einen normativen Vergleich zwischen den Kindern anzustreben.
- Entwicklung eines Diagnoseinstruments für den Mathematikunterricht in der Eingangsphase.
- Analyse bestehender Lernstandserhebungsinstrumente (OTZ, ZAREKI, LISUM).
- Empirische Erprobung des entwickelten Tests an verschiedenen Stichproben.
- Evaluation der Testgüte und Praxistauglichkeit.
- Feedback von erfahrenen Lehrkräften zur Verbesserung des Instruments.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Lernstandserhebung im Mathematikunterricht der Grundschule ein. Sie betont die Bedeutung der Erfassung individueller Lernvoraussetzungen bereits zum Schuleintritt, um einen differenzierten Unterricht zu ermöglichen und sowohl leistungsschwächere als auch begabte Kinder optimal fördern zu können. Der Abschnitt beschreibt die Motivation der Autorin, einen eigenen Test zu entwickeln, begründet durch die unzureichende Literaturlage zu diesem Thema und die Kritik an bestehenden standardisierten Tests, die einen Dialog mit dem Kind und die Beobachtung individueller Lösungsstrategien vernachlässigen.
2. Bestehende Tests zur Lernstandsanalyse: Dieses Kapitel beschreibt drei etablierte Tests zur Lernstandserhebung im mathematischen Anfangsunterricht: den Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung (OTZ), die ZAREKI und die Lernstandsanalyse des LISUM. Für jeden Test werden die Beschreibung, die Durchführung und vor allem die jeweiligen Kritikpunkte ausführlich erläutert. Die Autorin benennt Schwächen wie die Fokussierung auf Richtig/Falsch-Bewertungen, die Vernachlässigung individueller Lösungswege und die mangelnde Praxistauglichkeit. Die Kritik dient als Grundlage für die Entwicklung des eigenen Tests.
3. Der erste Test: Dieses Kapitel dokumentiert die Entwicklung und erste Erprobung eines eigenen Diagnoseinstruments. Der Test umfasst verschiedene Teilbereiche: Farben und Formen, Vergleichen von Mengen und Größen, Zahlen lesen und ordnen sowie simultane Zahlerfassung. Die Autorin beschreibt die Stichprobe, die Durchführung und ausgewählte Schülerantworten. Die detaillierte Analyse der Ergebnisse zeigt, dass der Test in seiner ersten Version Schwachstellen aufweist, insbesondere hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades und der Möglichkeit, individuelle Lösungsstrategien zu erkennen und zu analysieren. Es werden detaillierte Beispiele für Schülerantworten gegeben und die jeweiligen Interpretationsmöglichkeiten diskutiert.
4. Der zweite Test: Dieses Kapitel beschreibt die Überarbeitung des Diagnoseinstruments basierend auf den Erfahrungen mit dem ersten Test. Der Schwerpunkt liegt nun auf dem Erwerb der Zahlwortreihe, dem Erkennen von Ziffern und Anzahlen, dem Mengenvergleich, der simultanen Zahlerfassung und dem operativen Handeln. Die Autorin integriert einen spielerischen Ansatz mit einem Stoffhasen, um die Kinder zu motivieren und detailliertere Informationen über ihre Lösungswege zu erhalten. Die Ergebnisse der zweiten Testreihe werden analysiert, wobei erneut detaillierte Beispiele und Interpretationen von Schülerantworten präsentiert werden. Die Autorin identifiziert weiterhin Bereiche zur Verbesserung des Tests.
5. Beurteilung des zweiten Tests durch unterrichtende Lehrer: Dieses Kapitel präsentiert das Feedback von drei Lehrkräften zur zweiten Testversion. Das Feedback bestätigt die Einschätzung der Autorin bezüglich der benötigten Zeit und der Konzentration der Kinder. Allerdings werden auch Verbesserungsvorschläge zu den Instruktionen und zur Ergänzung weiterer Testbereiche (geometrische Formen, Farben, Problemlösefähigkeiten) geäußert. Die Lehrer bewerten den Test jedoch insgesamt positiv und sehen ihn als hilfreiches Instrument für die individuelle Lernstandserhebung.
Schlüsselwörter
Lernstandsanalyse, Mathematikunterricht, Anfangsunterricht, Diagnoseinstrument, Zahlbegriffsentwicklung, Schulanfänger, Lösungsstrategien, Differenzierung, individuelle Förderung, OTZ, ZAREKI, LISUM, Testentwicklung, Empirie, Qualitative Datenanalyse.
Häufig gestellte Fragen zur wissenschaftlichen Hausarbeit: Entwicklung und Evaluierung eines Diagnoseinstruments zur Erfassung der mathematischen Lernvoraussetzungen von Schulanfängern
Was ist das Thema der wissenschaftlichen Hausarbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und Evaluierung eines Diagnoseinstruments zur Erfassung der mathematischen Lernvoraussetzungen von Schulanfängern. Ziel ist ein praktikabler Test, der Lehrkräften detaillierte Einblicke in den individuellen Lernstand ihrer Schüler ermöglicht, ohne normativen Vergleich.
Welche bestehenden Tests zur Lernstandsanalyse werden untersucht?
Die Arbeit analysiert drei etablierte Tests: den Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung (OTZ), die ZAREKI und die Lernstandsanalyse des LISUM. Ihre Stärken und Schwächen, insbesondere die Vernachlässigung individueller Lösungswege und die mangelnde Praxistauglichkeit, werden kritisch beleuchtet.
Wie wurde der Diagnoseinstrument entwickelt?
Die Entwicklung erfolgte iterativ. Ein erster Test wurde entwickelt und an einer Stichprobe erprobt. Die Ergebnisse führten zur Überarbeitung und einem zweiten Test, der einen spielerischeren Ansatz integrierte und die Erfassung individueller Lösungsstrategien verbesserte. Feedback von Lehrkräften floss in die Weiterentwicklung ein.
Welche Bereiche werden im Diagnoseinstrument abgedeckt?
Der Test umfasst verschiedene Teilbereiche, darunter: Farben und Formen, Mengen- und Größenvergleiche, Zahlen lesen und ordnen, simultane Zahlerfassung, Zahlwortreihe, Ziffernerkennung, Anzahlen erkennen, Ziffern-Mengen-Zuordnung, Quasi-simultanes Zählen und Operationen. Der Fokus liegt auf der Erfassung des individuellen Lernstands und der Analyse von Lösungsstrategien.
Wie wurde der Test evaluiert?
Die Evaluation umfasste die empirische Erprobung an verschiedenen Stichproben, die Analyse der Ergebnisse und das Feedback von erfahrenen Lehrkräften. Die Arbeit präsentiert detaillierte Beispiele von Schülerantworten und deren Interpretationen.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse zeigen, dass der iterativ weiterentwickelte Test ein hilfreiches Instrument zur individuellen Lernstandserhebung darstellt. Das Feedback der Lehrkräfte bestätigt die Praxistauglichkeit, jedoch wurden auch Verbesserungsvorschläge zu Instruktionen und der Erweiterung von Testbereichen (geometrische Formen, Farben, Problemlösefähigkeiten) geäußert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zeigt, dass ein auf individuelle Förderung ausgerichteter Test, der die Analyse individueller Lösungsstrategien ermöglicht, wertvolle Informationen für Lehrkräfte liefert. Die iterative Testentwicklung und die Einbeziehung von Lehrerfeedback sind entscheidend für die Entwicklung eines praktikablen und sinnvollen Diagnoseinstruments.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Lernstandsanalyse, Mathematikunterricht, Anfangsunterricht, Diagnoseinstrument, Zahlbegriffsentwicklung, Schulanfänger, Lösungsstrategien, Differenzierung, individuelle Förderung, OTZ, ZAREKI, LISUM, Testentwicklung, Empirie, Qualitative Datenanalyse.
- Quote paper
- Nina Weck (Author), 2005, Erprobung und Bewertung eines Diagnostikinstruments zur Feststellung der Lernausgangssituation im Anfangsunterricht des Faches Mathematik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88768