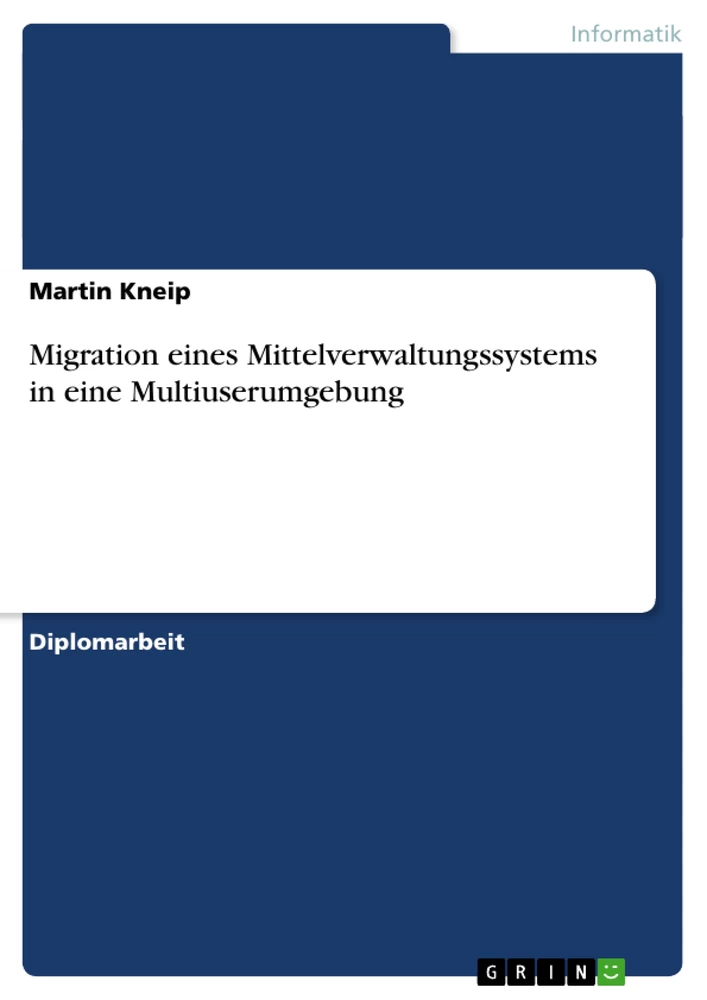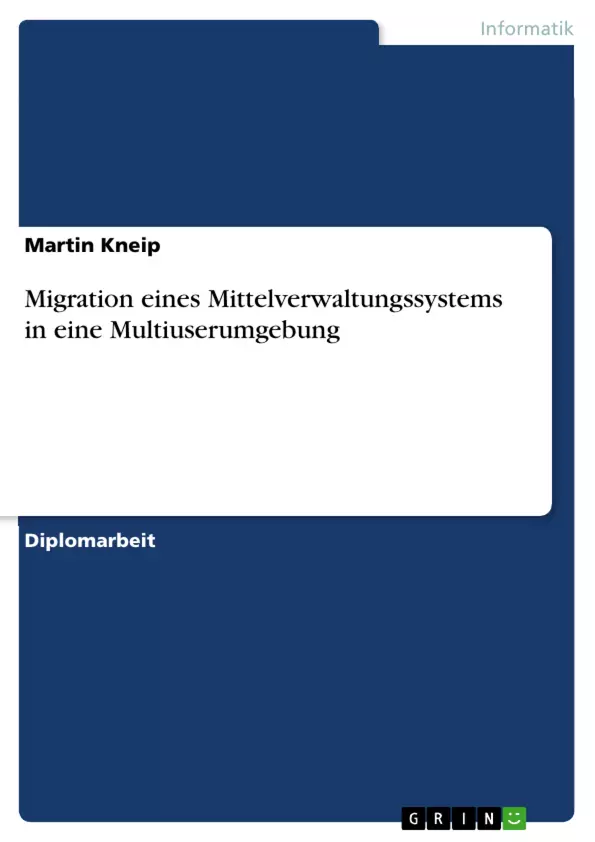Diese Arbeit beschäftigt sich mit einem Teil der betrieblichen Datenverarbeitung des Instituts Physik an der Universität Dortmund: Die Verwaltung der Haushaltsmittel und des Inventars der Einrichtungen, in die sich das Institut untergliedert. Die computergestützte Datenverarbeitung befindet sich in der Situation, daß zwar eine zentrale Datenbank für die Haushaltsmittel und das Inventar existiert, auf diese aber nur von einem PC aus zugegriffen werden kann. Da dieser PC nur von der Institutsverwaltung benutzt werden kann, müssen die Einrichtungen eigene
Lösungen mit redundanten Datenbeständen für ihre Datenverarbeitung verwenden.
Der Anreiz zur Verbesserung dieser Situation ergab sich aus folgenden Gründen. Zu Beginn des Jahres 2006 wurde an den nordrhein-westfälischen Universitäten der Globalhaushalt eingeführt. Neben der Umstellung von der kameralistischen auf die kaufmännische Buchführung, gibt dieser den Instituten und Einrichtungen eine größere Flexibilität bei der Planung ihrer Haushaltsmittel. Gleichzeitig war er jedoch Anlaß zu deutlichen Kürzungen der Haushaltsmittel. In den gleichen Zeitraum fiel der Eintritt des Altersruhestands des für die zentrale Datenverwaltung zuständige Mitarbeiters. Aufgrund der Kürzungen der Haushaltsmittel ergab sich die Notwendigkeit diese Stelle nicht mehr neu besetzen zu können. Daraus entwickelte sich die Aufgabe im Rahmen dieser Diplomarbeit eine neue Software-Lösung für diesen Teil der Mittelverwaltung des Instituts Physik zu entwerfen. Diese soll den neuen Bedürfnissen und den verbesserten technischen Gegebenheiten gerecht wird, welche sich durch die Entwicklung von leistungsfähigeren Rechner-Netzwerken und Datenbank-Technologien ergeben haben.
Die Gliederung der Arbeit orientiert sich primär an den Phasen der Softwareentwicklung. Diesem Kapitel, welches zur Einführung in das Thema und der Darstellung der Vorgehensweise mittels des Software Engineering dient, folgen in den nächsten beiden Kapitel die Erläuterung der wichtigsten Grundlagen von Datenbanken und verteilten Anwendungen. Anschließend wird in den Kapiteln „Analyse“, „Entwurf“, „Implementierung“ und „Abnahme und Einführung“ die Entwicklung der Software im strukturierten Paradigma beschrieben. Abgeschlossen wird die Arbeit mit einer kurzen Zusammenfassung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Software Engineering
- 1.2.1 Aktivitäten beim Software Engineering
- 1.2.2 Prozessmodelle des Software Engineering
- 1.2.3 Paradigmen des Software Engineering
- 1.2.4 Phasenmodell des Datenbankentwurfs
- 1.3 Gliederung
- 2 Datenbanken
- 2.1 Historische Entwicklung
- 2.2 Datenbankkonzept
- 2.2.1 Datenbankarchitektur
- 2.2.2 Datenbankverwaltungssystem
- 2.2.3 Vor- und Nachteile des Datenbankkonzepts
- 2.3 Datenmodelle
- 2.3.1 Grundelemente
- 2.3.2 Hierarchisches Datenmodell
- 2.3.3 Netzwerkartiges Datenmodell
- 2.3.4 Objektorientiertes Datenmodell
- 2.4 Relationales Datenmodell
- 2.4.1 Entity-Relationship-Modell
- 2.4.2 Klassisches Relationenmodell
- 2.4.3 Normalisierung
- 2.4.4 Erweitertes Relationenmodell
- 2.4.5 Codd's Regeln
- 2.5 Datenintegrität
- 2.5.1 Datenkonsistenz
- 2.5.2 Datensicherheit
- 2.5.3 Datenschutz
- 2.6 Datenbanken als Teil eines betrieblichen Informationssystems
- 3 Verteilte Anwendungen
- 3.1 Computernetzwerke
- 3.1.1 Vorteile und Anforderungen
- 3.1.2 Netzwerk-Technologie
- 3.2 Verteilte Systeme
- 3.2.1 Definition und Eigenschaften
- 3.2.2 Architektur
- 3.2.3 Verteilte Anwendungen
- 3.2.4 ODBC
- 3.1 Computernetzwerke
- 4 Analyse
- 4.1 Fachliche Vorstudie
- 4.1.1 Allgemeine Zielsetzung und Anwendungsbereich
- 4.1.2 Beschreibung des Anwendungsbereichs
- 4.1.3 Gegenwärtige Informationsverarbeitung
- 4.1.4 Lösungskonzept
- 4.2 Durchführbarkeitsstudie
- 4.2.1 Auswahl von Computersystem und Standardsoftware
- 4.2.2 Projektkalkulation und Kosten/Nutzen-Analyse
- 4.2.3 Alternative Lösungen
- 4.2.4 Projektrisiken
- 4.3 Pflichtenheft
- 4.4 Fachliches Analysemodell
- 4.4.1 Datenflußmodell
- 4.4.2 Datenmodellierung
- 4.4.3 Analyse der Antwort-Anforderungen
- 4.1 Fachliche Vorstudie
- 5 Entwurf
- 5.1 Datenbankentwurf
- 5.1.1 Softwaretechnische Aspekte der Datenbank-Realisierung
- 5.1.2 Konzeptionelles Schema
- 5.1.3 Externe Schemata
- 5.1.4 Internes Schema
- 5.2 Entwurf des Access-Anwendungsprogramms
- 5.2.1 Softwaretechnische Aspekte der Realisierung
- 5.2.2 Schnittstellen zwischen Datenbank und Anwendungsprogramm
- 5.2.3 Modulkonzept für Microsoft Access
- 5.2.4 Systemarchitektur
- 5.2.5 Objektentwurf
- 5.2.6 Entwurf der Stored Procedures
- 5.2.7 Entwurf der Benutzungsoberfläche
- 5.1 Datenbankentwurf
- 6 Implementierung
- 6.1 Implementierung der Datenbank auf der Server-Entwicklungsmaschine
- 6.2 Realisierung des Anwendungssystems
- 6.2.1 Erste Masterversion: Bestell- und Rechnungswesen
- 6.2.2 Erste Userversion: Bestell- und Rechnungswesen
- 6.2.3 Zweite Masterversion: Benutzerverwaltung
- 6.2.4 Dritte Masterversion: Fehlerbehandlung
- 6.2.5 Dritte Userversion: Fehlerbehandlung
- 6.2.6 Vierte Masterversion: Verwaltung interner Bestellnummern
- 6.2.7 Vierte Userversion: Verwaltung interner Bestellnummern
- 6.2.8 Fünfte Masterversion: Verwaltung des Inventars
- 6.2.9 Fünfte Userversion: Verwaltung des Inventars
- 6.3 Installation und Einrichtung der Server-Basismaschine
- 6.4 Test des Anwendungssystems während der Implementierung
- 7 Abnahme und Einführung
- 7.1 Abnahme
- 7.2 Einführung
- 7.2.1 Inbetriebnahme der Server-Basismaschine
- 7.2.2 Installation und Einrichtung des Softwaresystems auf den Clients
- 7.2.3 Benutzerschulungen
- 7.2.4 Einführungsphase
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Migration eines bestehenden Mittelverwaltungssystems in eine Multiuserumgebung. Ziel ist die Beschreibung des gesamten Prozesses, von der Analyse des bestehenden Systems bis hin zur Implementierung und Einführung der neuen Lösung. Dabei werden sowohl softwaretechnische als auch organisatorische Aspekte berücksichtigt.
- Migration eines bestehenden Systems
- Datenbankdesign und -implementierung
- Software Engineering Prozesse
- Verteilte Anwendungen und Netzwerktechnologien
- Anwendungsentwicklung mit Microsoft Access
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Problemstellung ein, beschreibt den Kontext des Software Engineering und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit.
2 Datenbanken: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über Datenbankkonzepte, verschiedene Datenmodelle (hierarchisch, netzwerkförmig, objektorientiert, relational) und Aspekte der Datenintegrität, -sicherheit und des Datenschutzes. Es legt die theoretischen Grundlagen für den Datenbankentwurf im weiteren Verlauf der Arbeit.
3 Verteilte Anwendungen: Hier werden die Grundlagen verteilter Anwendungen und Computernetzwerke behandelt, einschließlich der Architektur und der Technologie von verteilten Systemen. Dies bildet die Grundlage für die Entwicklung der Multiuser-Lösung.
4 Analyse: Dieses Kapitel beschreibt die fachliche Vorstudie, die Durchführbarkeitsstudie und das Pflichtenheft. Es umfasst die Analyse des bestehenden Systems, die Definition der Anforderungen und die Entwicklung eines Lösungskonzepts. Die Analyse der Antwort-Anforderungen und das Datenmodell werden ebenfalls detailliert betrachtet.
5 Entwurf: Dieses Kapitel detailliert den Entwurf der Datenbank, einschließlich der softwaretechnischen Aspekte, des konzeptionellen und externen Schemas sowie des internen Schemas. Der Entwurf des Access-Anwendungsprogramms wird umfassend beschrieben, inklusive Schnittstellen, Modulkonzept, Systemarchitektur, Objektentwurf und Entwurf der Benutzeroberfläche.
6 Implementierung: Dieses Kapitel dokumentiert die Implementierung der Datenbank und des Anwendungssystems in mehreren Schritten, von der ersten Masterversion bis zur fünften Userversion. Der Prozess der Installation und Einrichtung der Server-Basismaschine sowie das Testen des Systems während der Implementierung werden ebenfalls beschrieben.
7 Abnahme und Einführung: Dieses Kapitel beschreibt den Abnahmeprozess und die Einführung des neuen Systems, einschließlich der Inbetriebnahme der Server-Basismaschine, der Installation auf den Client-Systemen, der Benutzerschulungen und der Einführungsphase.
Schlüsselwörter
Migration, Mittelverwaltungssystem, Multiuserumgebung, Datenbank, relationales Datenmodell, Software Engineering, Verteilte Anwendungen, Microsoft Access, Datenbankentwurf, Implementierung, Anwendungsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Migration eines Mittelverwaltungssystems in eine Multiuserumgebung
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit beschreibt die Migration eines bestehenden Mittelverwaltungssystems in eine Multiuserumgebung. Sie dokumentiert den gesamten Prozess, von der Analyse des bestehenden Systems bis zur Implementierung und Einführung der neuen Lösung, unter Berücksichtigung softwaretechnischer und organisatorischer Aspekte.
Welche Ziele werden in der Arbeit verfolgt?
Das Hauptziel ist die detaillierte Darstellung des gesamten Migrationsprozesses. Es werden sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Umsetzung beleuchtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Migration eines bestehenden Systems, Datenbankdesign und -implementierung, Software Engineering Prozesse, verteilte Anwendungen und Netzwerktechnologien, sowie Anwendungsentwicklung mit Microsoft Access.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Datenbanken, Verteilte Anwendungen, Analyse, Entwurf, Implementierung und Abnahme und Einführung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Migrationsprozesses.
Was wird im Kapitel "Datenbanken" behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über Datenbankkonzepte, verschiedene Datenmodelle (hierarchisch, netzwerkförmig, objektorientiert, relational) und Aspekte der Datenintegrität, -sicherheit und des Datenschutzes. Es bildet die Grundlage für den Datenbankentwurf.
Was wird im Kapitel "Verteilte Anwendungen" behandelt?
Hier werden die Grundlagen verteilter Anwendungen und Computernetzwerke behandelt, einschließlich Architektur und Technologie verteilter Systeme. Dies ist essenziell für die Entwicklung der Multiuser-Lösung.
Was beinhaltet das Kapitel "Analyse"?
Dieses Kapitel beschreibt die fachliche Vorstudie, die Durchführbarkeitsstudie und das Pflichtenheft. Es umfasst die Analyse des bestehenden Systems, die Anforderungsdefinition und die Entwicklung eines Lösungskonzepts, einschließlich Datenflussmodell und Datenmodellierung.
Was wird im Kapitel "Entwurf" detailliert beschrieben?
Der Entwurf der Datenbank (softwaretechnische Aspekte, konzeptionelles und externes Schema, internes Schema) und des Access-Anwendungsprogramms (Schnittstellen, Modulkonzept, Systemarchitektur, Objektentwurf, Benutzeroberfläche) werden hier umfassend behandelt.
Wie wird die Implementierung dokumentiert?
Das Kapitel "Implementierung" dokumentiert die schrittweise Umsetzung der Datenbank und des Anwendungssystems (mehrere Master- und Userversionen), die Installation der Server-Basismaschine und das Systemtesting.
Was beinhaltet das Kapitel "Abnahme und Einführung"?
Dieses Kapitel beschreibt den Abnahmeprozess und die Einführung des neuen Systems, einschließlich Inbetriebnahme der Server-Basismaschine, Installation auf Client-Systemen, Benutzerschulungen und die Einführungsphase.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Migration, Mittelverwaltungssystem, Multiuserumgebung, Datenbank, relationales Datenmodell, Software Engineering, Verteilte Anwendungen, Microsoft Access, Datenbankentwurf, Implementierung und Anwendungsentwicklung.
Welche Software wird in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Anwendungsentwicklung mit Microsoft Access.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studenten, Wissenschaftler und Praktiker im Bereich Software Engineering, Datenbankdesign und Anwendungsentwicklung, insbesondere im Kontext der Migration von Systemen in Multiuserumgebungen.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Phys. Dipl.-Kfm. Martin Kneip (Autor:in), 2007, Migration eines Mittelverwaltungssystems in eine Multiuserumgebung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88676