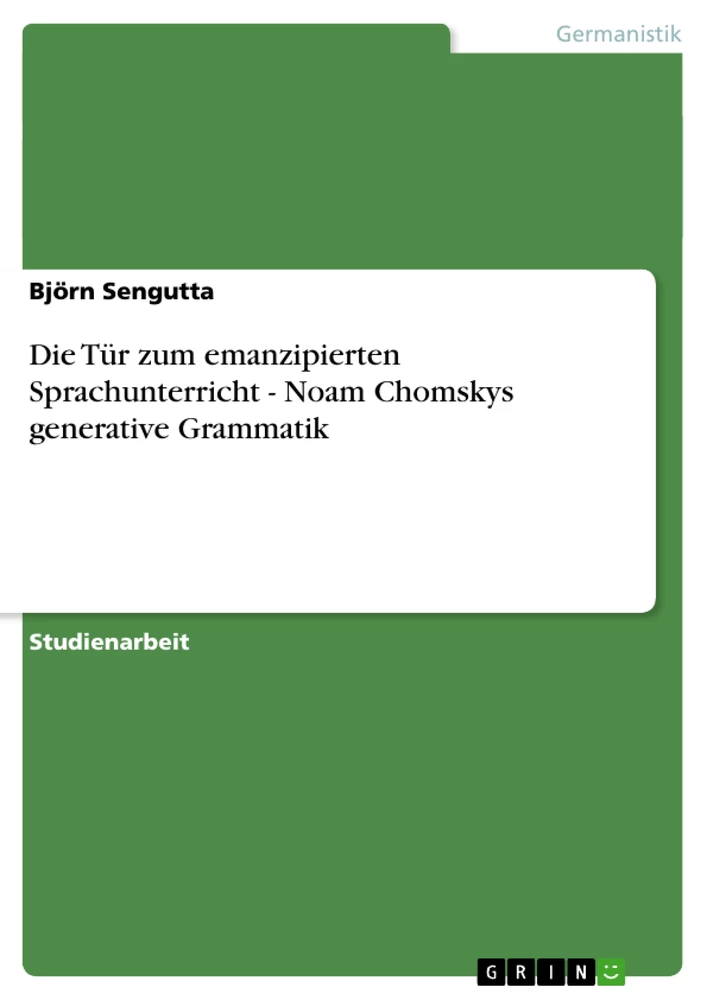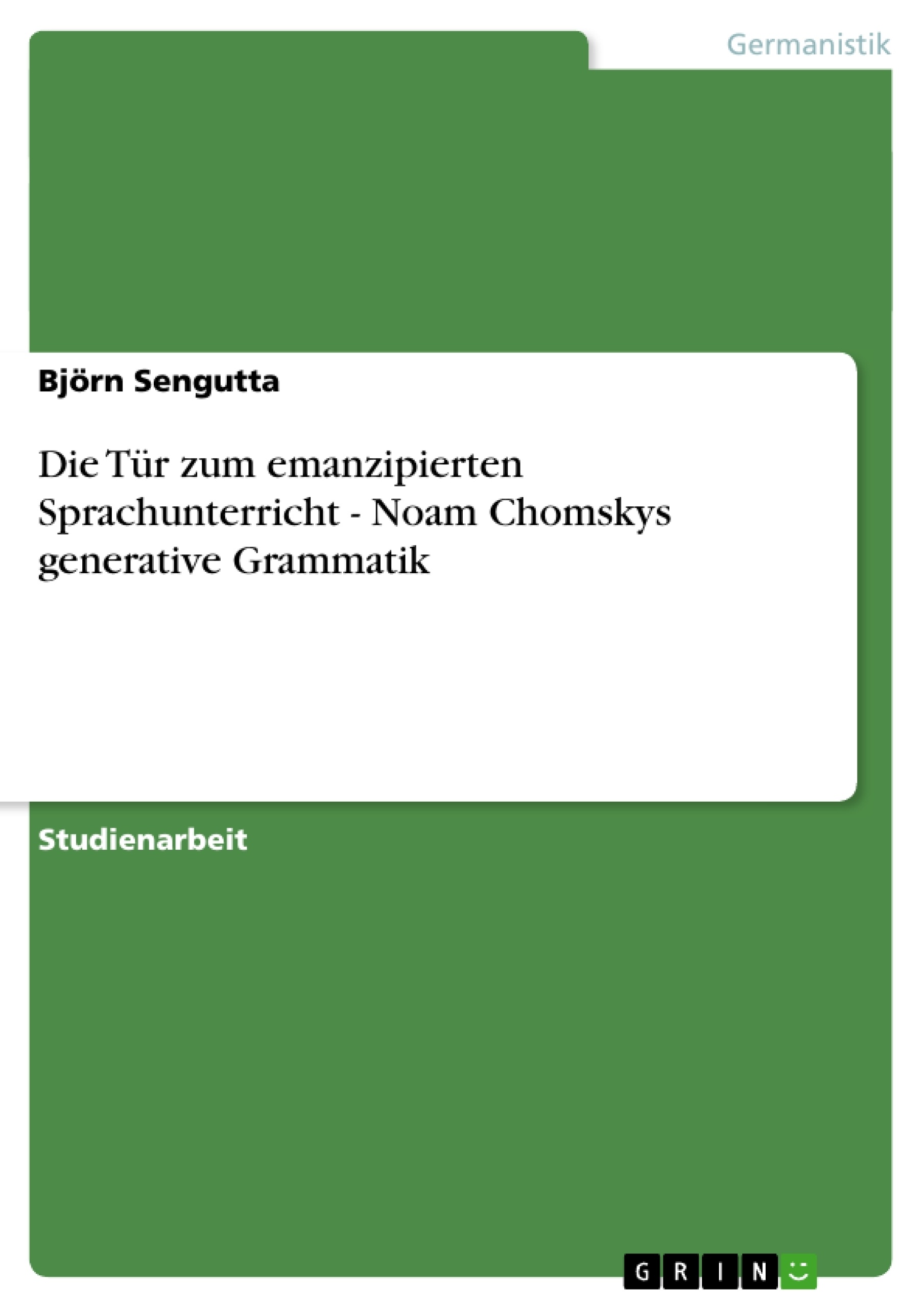Im Zuge meiner universitären Ausbildung zum Deutschlehrer absolvierte ich ein allgemeines Schulpraktikum an einem Gymnasium. Während dieses Praktikums hielt ich eine Deutschstunde in einem Grundkurs der Jahrgangsstufe 11. Das Thema der Stunde lautete „Warum verändert sich Sprache?“. Als ich der Klasse die Frage stellte, wieso man mit Gewissheit sagen könne, ob ein Satz grammatisch oder ungrammatisch ist, da waren sich alle Schüler einig. Man verwies darauf, dass schließlich alle Regeln der deutschen Sprache in der Dudengrammatik verankert seien. Ganz falsch war diese Aussage natürlich nicht. Doch konnte mir niemand sagen, wer diese Regeln denn aufgestellt hatte.
Das grundlegende Problem lag in der Annahme, dass Sprache ein starres System sei, in dem die einzelnen Elemente und die Relationen zwischen den Elementen eine feste zeitlose Position einnehmen. Den Jugendlichen war gar nicht bewusst, dass Sprache von ihnen nicht bloß „konsumiert“, sondern auch mitgestaltet wird. Wenn ich mich jedoch an den Grammatikunterricht meiner eigenen Schulzeit zurückerinnere, dann fällt es nicht schwer zu verstehen, warum Schüler, aber auch Lehrer so denken. Linke (2001, S. 45) schreibt in diesem Zusammenhang:
Zu unserem von der Schule (…) geprägten Alltagskonzept von Grammatik gehört wohl sehr stark die Vorstellung, dass dies ein Lehrgebäude ist, das im Prinzip genauso fest und indiskutabel ist, wie die Urteile fest und indiskutabel scheinen, die man unter Abstützung auf grammatische Regeln über sprachliche Ausdrücke fällen zu glaubt: „Das ist Regel-gerecht, also richtig. – Das verstößt wider die Regel, ist also falsch.“
Aus didaktischer Sicht ist ein solches Verständnis von Grammatik jedoch kaum tragbar. Seit den hessischen Rahmenrichtlinien Deutsch Sekundarstufe I von 1972 bildet „Reflexion über Sprache“ bzw. „Nachdenken über Sprache“ einen wichtigen eigenständigen Bereich in allen Lehrplänen. Schüler sollten damit nicht bloß zum angemessnen Gebrauch von Sprache befähigt werden, sondern diese auch kritisch reflektieren können (vgl. Steets 2003, S. 211). Letztendlich geht es auch darum, in den Schülern ein Sprachbewusstsein zu wecken und dadurch emanzipierte Schreiber und Leser zu gewinnen. Leider konnten „die Ansprüche an einen aufgeklärten, reflektierten Sprachunterricht bisher in der Praxis nicht realisiert werden (…)“ (Steets 2003, S. 211).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Grammatikbegriff
- Präskriptiv oder Deskriptiv?
- Wie,adäquat' ist eine Grammatik?
- Die,Generative Grammatik' nach Noam Chomsky
- Von Prinzipien und Parametern
- Was macht uns zu Experten?
- Primärer Spracherwerb
- Syntaktische Beschreibung von Sprache
- Die Konstituentenstruktur
- Wörter und ihre Selektionseigenschaften
- Die Phrase als Mittel syntaktischer Beschreibung
- Zwei Modelle zur syntaktischen Beschreibung
- Das,Topologische Feldermodell'
- Das X'-Schema
- Von Prinzipien und Parametern
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Verständnis von Grammatik und stellt die „Generative Grammatik“ (GG) von Noam Chomsky vor. Sie zielt darauf ab, die Komplexität der Sprache aufzuzeigen und den Zugang zu einer kritischen Reflexion von Sprache zu ermöglichen. Dabei werden die sprachtheoretischen Grundlagen der GG und ihre Methoden zur syntaktischen Beschreibung von Sprache erläutert.
- Entwicklung und Bedeutung des Grammatikbegriffs
- Differenzierung von präskriptiven und deskriptiven Grammatiken
- Grundlagen der „Generativen Grammatik“ von Noam Chomsky
- Methoden zur syntaktischen Beschreibung von Sprache
- Übertragung der Erkenntnisse der GG auf den Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Text beginnt mit einer persönlichen Erfahrung des Autors während eines Schulpraktikums, die den Mangel an Sprachreflexion in der traditionellen Grammatikunterweisung aufzeigt. Er kritisiert die Vorstellung von Sprache als starres System und plädiert für ein emanzipiertes Verständnis von Sprachgebrauch, das die aktiven Rolle der Sprecher betont.
Der Grammatikbegriff
Der Autor erklärt die Unterschiede zwischen präskriptiven und deskriptiven Grammatiken. Er betont, dass es trotz der scheinbaren Verbindlichkeit von Regeln unterschiedliche Grammatiken gibt, die verschiedene linguistische Ansätze widerspiegeln.
Die,Generative Grammatik' nach Noam Chomsky
Dieses Kapitel führt das linguistische Modell der „Generativen Grammatik“ (GG) von Noam Chomsky ein. Es erläutert die sprachtheoretischen Grundlagen der GG, insbesondere die Prinzipien und Parameter, die den Spracherwerb und die Universalität sprachlicher Strukturen erklären sollen. Des Weiteren werden wichtige Elemente der syntaktischen Beschreibung von Sprache innerhalb der GG vorgestellt.
Schlussbetrachtung
Dieses Kapitel bietet einen Ausblick auf die Bedeutung der GG für ein vertieftes Verständnis von Sprache und die Übertragung ihrer Erkenntnisse auf den Deutschunterricht. Es wird betont, dass die GG dazu beitragen kann, grammatikalische Fakten angemessen zu vermitteln und ein kritisches Sprachbewusstsein bei Schülern zu fördern.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Generative Grammatik, Noam Chomsky, Präskriptiv, Deskriptiv, Syntax, Sprachstruktur, Sprachwandel, Sprachbewusstsein, Sprachdidaktik.
- Quote paper
- Björn Sengutta (Author), 2007, Die Tür zum emanzipierten Sprachunterricht - Noam Chomskys generative Grammatik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88459