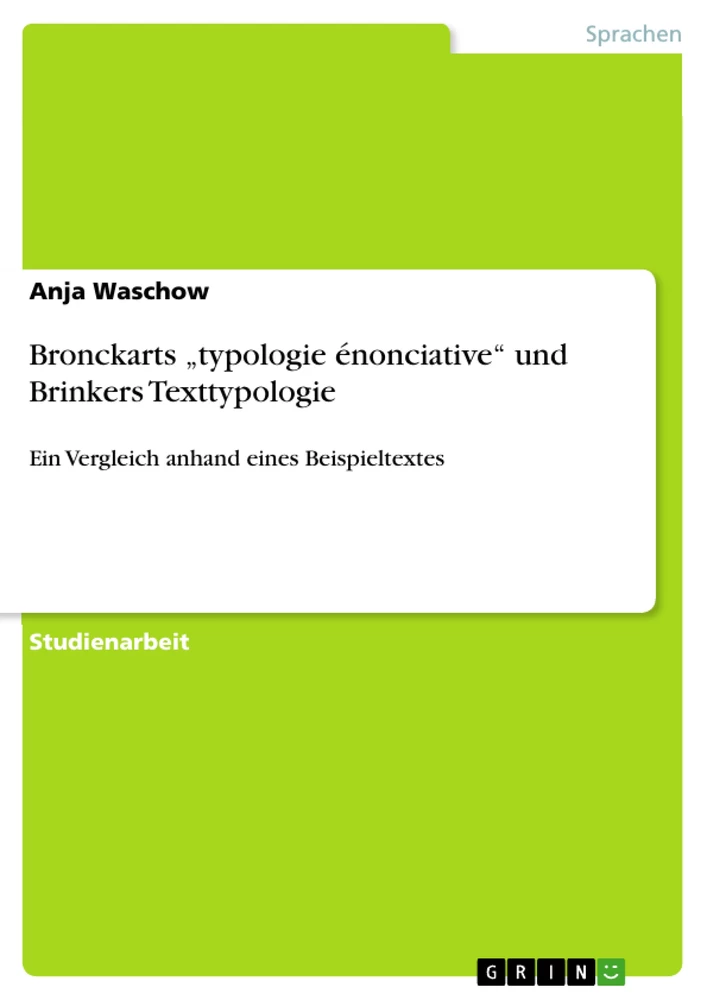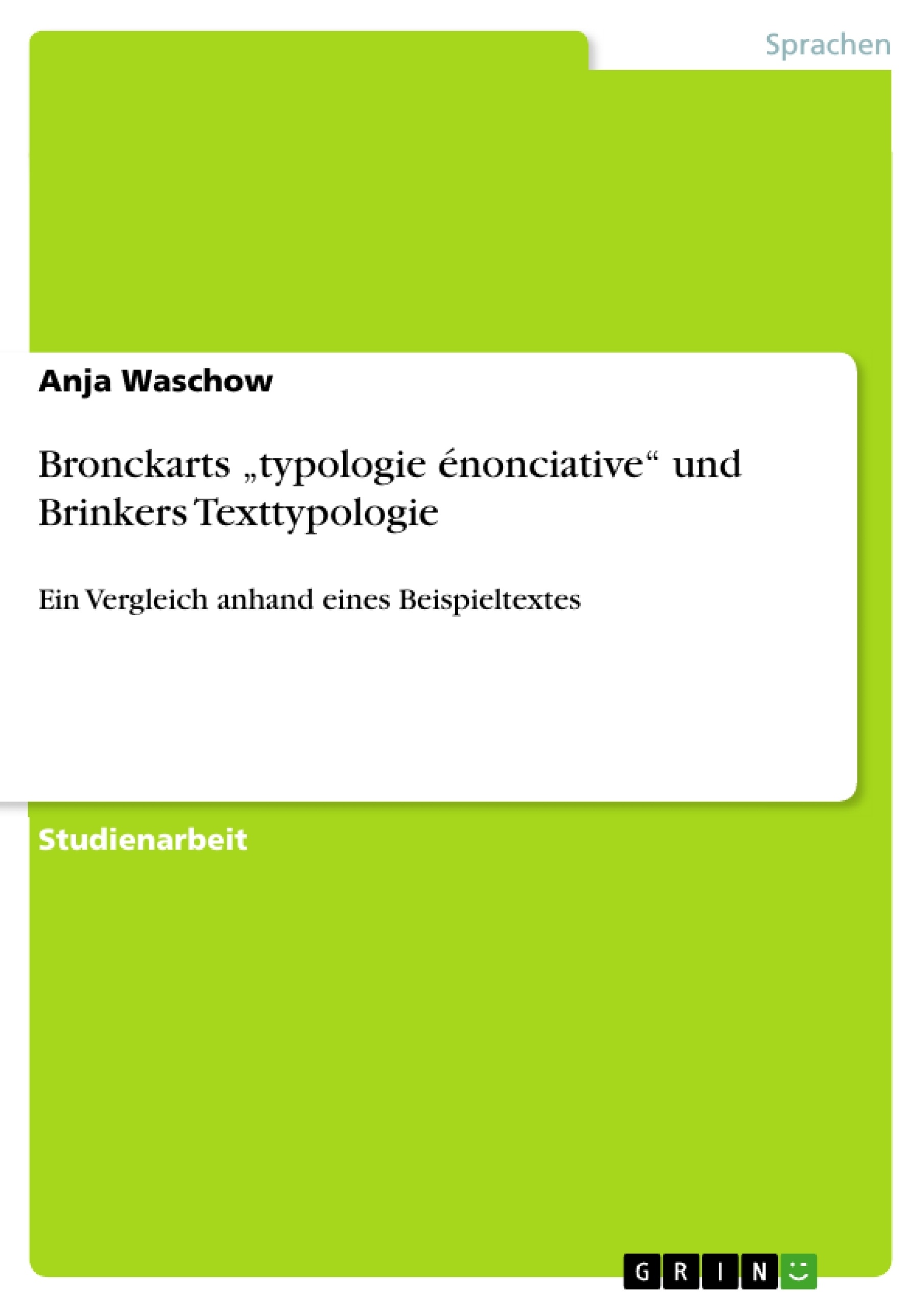1. Einleitung
Das Thema „Texttypologie“ ist nicht neu. Ganz im Gegenteil, in den letzten zwei Jahrzehnten wurde darüber intensiv diskutiert und eine hohe Anzahl an bis jetzt vorgelegten Vorschlägen zur Texttypologie lässt eine erneute Thematisierung zunächst wenig Erfolg versprechend erscheinen, um diese Problematik zu lösen.
Seit die Linguistik den Text als Gegenstand der Forschung in den Blick nahm, gibt es viele Versuche, eine linguistisch fundierte Texttypologie zu erarbeiten, jedoch konnte bisher kein Ansatz als allgemeinverbindlich gelten, da die Problematik der Texttypologie so vielschichtig ist, dass die einzelnen Vorschläge nur jeweils einen Ausschnitt thematisieren können.
[...]
Beispielsweise beherrschen die meisten Sprachteilnehmer die Kompetenz zur Unterscheidung zwischen Texttypen wie die Gebrauchsanweisung, die Reportage oder den privaten Brief.
Eine wissenschaftliche Typologisierung unterscheidet sich von der gerade erläuterten intuitiven zunächst durch ihre Explizitheit.
Des Weiteren ist sie systematisch und versucht demnach durch Klassenbildung eine einheitliche und gleichmäßige Texttypologie zu ermöglichen. Grundlage dafür sind einheitliche Typologisierungsbasen, um die einzelnen Typen vergleichen zu können. Daher ist Homogenität eine wichtige Bedingung.
Brinker als auch Bronckart legen ihrer Texttypologie eine Basis zugrunde, auf welche ich im Laufe der Arbeit eingehen werde.
Eine wissenschaftliche Typologie muss in jedem Fall mit der intuitiven Typologie gemeinsam haben, dass ihre Ergebnisse in konkreten Situationen der Kommunikation anwendbar sein sollten.
Es ist nicht leicht, bestimmte Texte aus der Alltagswelt zu klassifizieren, da diese, wie bereits erwähnt, Eigenschaften mehrerer Texttypen aufweisen können oder aber keiner Klasse einfach zuzuordnen sind.
In dieser Arbeit möchte ich die Texttypologien der Linguisten Klaus Brinker und Jean-Paul Bronckart miteinander vergleichen, an einem Textbeispiel erläutern und schlussfolgern, welche der beiden Theorien linguistisch besser geeignet ist, Texte zu diskriminieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Texttypologie Brinkers vs. „La typologie énonciative“ Bronckarts.
- Ein Beispiel der Texttypologie nach Bronckart.
- La base socio-langagière
- Le lieu social
- L'énonciateur et le destinataire
- Le but langagier
- Le genre du discours de Bakhtine
- Die Einordnung in die vier „architypes discursifs“.
- La base socio-langagière
- Ein Beispiel der Texttypologie nach Brinker
- Textfunktion
- Kommunikationsform und Handlungsbereich
- Lokale und temporale Orientierung des Themas
- Grundform der thematischen Entfaltung und Realisationsform
- Textsortenspezifische sprachliche und ggf. nichtsprachliche Mittel
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Texttypologien von Klaus Brinker und Jean-Paul Bronckart anhand eines Beispieltextes zu vergleichen und zu bewerten, welche der beiden Theorien linguistisch besser geeignet ist, Texte zu klassifizieren. Die Arbeit befasst sich mit dem Thema „Texttypologie“ und der Problematik der vielfältigen und oft unscharfen Termini in der Texttypologieforschung. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Ansätze zur wissenschaftlichen Typologisierung von Texten und stellt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Typologien von Brinker und Bronckart heraus.
- Unterscheidung von Texttypen als allgemein menschliche Fähigkeit und Umgangserfahrung
- Wissenschaftliche Typologisierung im Vergleich zur intuitiven Typologisierung
- Die Bedeutung von Textfunktionen für die Unterscheidung von Textsortenklassen
- Die „base socio-langagière“ in Bronckarts „Typologie énonciative“
- Vergleich der Kategorien von Textfunktionen bei Brinker und Bronckart
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema „Texttypologie“ vor und beleuchtet die Herausforderungen, die mit der Entwicklung einer wissenschaftlich fundierten Texttypologie verbunden sind. Das zweite Kapitel vergleicht die Texttypologien von Klaus Brinker und Jean-Paul Bronckart. Es erläutert Brinkers Ansatz, der auf Textfunktionen als Hauptkriterium für die Unterscheidung von Textsortenklassen setzt, und stellt die fünf Großklassen von Brinkers Texttypologie vor. Anschließend wird Bronckarts „Typologie énonciative“ vorgestellt, die auf einer „base socio-langagière“ basiert. Diese Basis umfasst Aspekte wie den Ort der sozialen Verankerung, den Sender und Empfänger des Textes, das Kommunikationsziel und den Genre des Diskurses. Das dritte Kapitel präsentiert ein Beispiel für die Anwendung der Texttypologie nach Bronckart. Es erläutert die einzelnen Aspekte der „base socio-langagière“ und zeigt, wie sich ein Text in die vier „architypes discursifs“ einordnen lässt.
Schlüsselwörter
Texttypologie, Textsorten, Textfunktionen, Kommunikationsabsichten, „base socio-langagière“, „Typologie énonciative“, „architypes discursifs“, pragmatische Textlinguistik, linguistische Textanalyse.
- Quote paper
- Anja Waschow (Author), 2008, Bronckarts „typologie énonciative“ und Brinkers Texttypologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88148