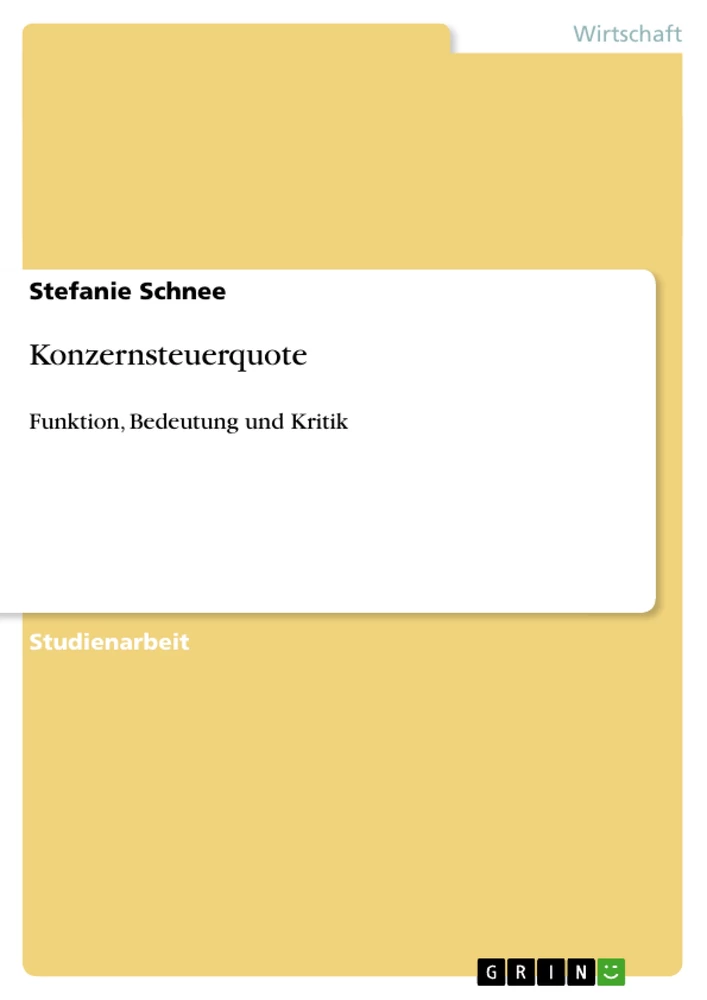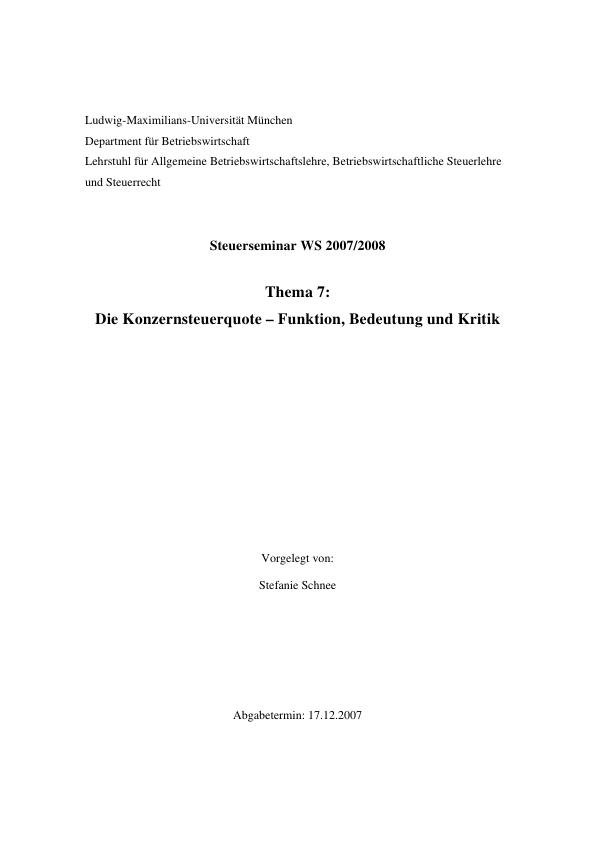Führte die Konzernsteuerquote Ende der neunziger Jahre in Deutschland noch ein Schattendasein in Lehrbüchern zur Bilanzanalyse, so ist deren Bedeutung in der Unternehmenspraxis in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Das liegt vor allem an der zunehmenden Zahl an Unternehmen, die ihre Abschlüsse nach internationalen Rech-nungslegungsstandards (IAS/IFRS) oder nach amerikanischen Bilanzierungsvorschrif-ten (US-GAAP) erstellen. In diesen Regelungskreisen ist – im Gegensatz zu den HGB-Vorschriften - die Veröffentlichung und Herleitung der Konzernsteuerquote im Kon-zernabschluss vorgeschrieben. Insbesondere mit Umsetzung der IAS-Verordnung müssen seit dem Geschäftsjahr 2005 kapitalmarktorientierte Unternehmen ihren Konzernab-schluss nach internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen aufstellen, wodurch die Herleitung der Konzernsteuerquote im Anhang zu einer gesetzlichen Verpflichtung für kapitalmarktorientierte Konzerne wurde.
Die Bedeutung der Konzernsteuerquote hat sich auch durch die zunehmende Kapitalmarktorientierung der Unternehmenspolitik erhöht. Hintergrund dabei ist der Zusam-menhang zwischen der Konzernsteuerquote und der für die Beurteilung von Unterneh-men zentralen Kennzahl Gewinn je Aktie (Earnings per Share). Der Gewinn je Aktie ist eine Nachsteuergröße und damit umso höher, je geringer die Konzernsteuerquote ist. Das bedeutet, dass der auf den Gesellschafter entfallende Gewinn je Aktie umso höher ist, je geringer der Steueraufwand und damit der auf den Fiskus entfallende Teil ist. Damit einhergehend überrascht es nicht, dass sich der Kapitalmarkt für die Konzernsteuerquote und deren dauerhafte Absenkung interessiert und börsennotierte Unter-nehmen in deren Hauptversammlungen zunehmend kritisch mit dieser Kennzahl konfrontiert werden.
Inhalt:
I. Grundlagen der Konzernsteuerquote
1. Gründe für die zunehmende Bedeutung der Konzernsteuerquote
2. Definition und Ermittlung der Konzernsteuerquote
3. Überleitungsrechnung
II. Funktionen der Konzernsteuerquote
1. Funktionen für interne Abschlussinteressenten
2. Funktionen für externe Abschlussinteressenten
III. Bedeutung für die betriebliche Steuerpolitik.
1. Verdrängung klassischer Steuerbilanzpolitik
2. Aktionsfelder einer quotenorientierten Steuerpolitik
IV. Kritik
1. Begrenzte Beeinflussbarkeit der Quote durch die Steuerabteilung
2. Folgen für die betriebliche Steuerpolitik
3. Konzernsteuerquotenvergleich
Inhaltsverzeichnis
- I. Grundlagen der Konzernsteuerquote
- 1. Gründe für die zunehmende Bedeutung der Konzernsteuerquote
- 2. Definition und Ermittlung der Konzernsteuerquote
- 3. Überleitungsrechnung
- II. Funktionen der Konzernsteuerquote
- 1. Funktionen für interne Abschlussinteressenten
- 2. Funktionen für externe Abschlussinteressenten
- III. Bedeutung für die betriebliche Steuerpolitik
- 1. Verdrängung klassischer Steuerbilanzpolitik
- 2. Aktionsfelder einer quotenorientierten Steuerpolitik
- IV. Kritik
- 1. Begrenzte Beeinflussbarkeit der Quote durch die Steuerabteilung
- 2. Folgen für die betriebliche Steuerpolitik
- 3. Konzernsteuerquotenvergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzernsteuerquote, ihre Bedeutung und die ihr anhaftende Kritik. Ziel ist es, die Funktionen der Quote für interne und externe Interessenten zu beleuchten und ihren Einfluss auf die betriebliche Steuerpolitik zu analysieren. Die Arbeit betrachtet auch die Grenzen der Beeinflussbarkeit der Quote.
- Zunehmende Bedeutung der Konzernsteuerquote im Kontext internationaler Rechnungslegungsstandards
- Funktionen der Konzernsteuerquote für interne und externe Stakeholder
- Auswirkungen auf die betriebliche Steuerpolitik
- Kritikpunkte an der Konzernsteuerquote
- Möglichkeiten zur Beeinflussung der Konzernsteuerquote
Zusammenfassung der Kapitel
I. Grundlagen der Konzernsteuerquote: Dieses Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis der Konzernsteuerquote. Es beleuchtet die Gründe für ihre steigende Bedeutung, insbesondere durch die zunehmende Verwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (IAS/IFRS) und US-GAAP, welche im Gegensatz zu HGB-Vorschriften die Veröffentlichung der Quote vorschreiben. Weiterhin wird die Bedeutung im Kontext der Kapitalmarktorientierung und des Zusammenhangs mit der Kennzahl "Gewinn je Aktie" erläutert, wobei ein geringerer Steueraufwand zu einem höheren Gewinn je Aktie führt. Das Kapitel verdeutlicht das wachsende Interesse des Kapitalmarktes an einer dauerhaften Senkung der Quote.
II. Funktionen der Konzernsteuerquote: Dieser Abschnitt analysiert die verschiedenen Funktionen der Konzernsteuerquote. Es wird zwischen den Funktionen für interne und externe Abschlussinteressenten unterschieden. Für interne Interessenten dient die Quote als Steuerungsinstrument für die betriebliche Steuerpolitik und als Indikator für die Effizienz der Steuerplanung. Für externe Interessenten, wie Investoren und Analysten, fungiert sie als wichtige Kennzahl zur Bewertung der Unternehmensperformance und des Risikos. Das Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven und Informationsbedürfnisse der verschiedenen Stakeholder-Gruppen.
III. Bedeutung für die betriebliche Steuerpolitik: Das Kapitel untersucht die Bedeutung der Konzernsteuerquote für die betriebliche Steuerpolitik. Es beschreibt, wie die Fokussierung auf die Quote zu einer Verdrängung der klassischen Steuerbilanzpolitik führt und welche neuen Aktionsfelder sich im Kontext einer quotenorientierten Steuerpolitik ergeben. Die Diskussion umfasst Strategien zur Optimierung der Steuerquote und die Herausforderungen bei deren Umsetzung. Es wird die Komplexität der Interaktion zwischen Steuerplanung und Gesamtstrategie des Unternehmens beleuchtet.
IV. Kritik: Der letzte analysierte Abschnitt befasst sich mit der Kritik an der Konzernsteuerquote. Ein Hauptkritikpunkt ist die begrenzte Beeinflussbarkeit der Quote durch die Steuerabteilung allein, da externe Faktoren wie die Rechtslage und die wirtschaftliche Situation einen erheblichen Einfluss haben. Die Arbeit diskutiert die Folgen dieser begrenzten Beeinflussbarkeit für die betriebliche Steuerpolitik und betrachtet kritisch die Vergleichbarkeit von Konzernsteuerquoten verschiedener Unternehmen aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen.
Schlüsselwörter
Konzernsteuerquote, internationale Rechnungslegungsstandards (IAS/IFRS), US-GAAP, HGB, Gewinn je Aktie, Kapitalmarktorientierung, betriebliche Steuerpolitik, Steuerplanung, Steuerbilanzpolitik, Kennzahlenanalyse, Stakeholder.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Konzernsteuerquote
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die Konzernsteuerquote. Er untersucht ihre Bedeutung, ihre Funktionen für interne und externe Stakeholder, ihren Einfluss auf die betriebliche Steuerpolitik und die ihr anhaftende Kritik. Der Fokus liegt auf der Analyse der Quote als Steuerungsinstrument und Kennzahl, sowie auf den Grenzen ihrer Beeinflussbarkeit.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themenschwerpunkte: Grundlagen der Konzernsteuerquote (Definition, Ermittlung, steigende Bedeutung), Funktionen der Quote für interne und externe Interessenten, Auswirkungen auf die betriebliche Steuerpolitik (Verdrängung klassischer Steuerbilanzpolitik, neue Aktionsfelder), Kritik an der Quote (eingeschränkte Beeinflussbarkeit, Vergleichbarkeitsprobleme) und die Möglichkeiten der Beeinflussung der Quote.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in vier Kapitel: I. Grundlagen der Konzernsteuerquote, II. Funktionen der Konzernsteuerquote, III. Bedeutung für die betriebliche Steuerpolitik und IV. Kritik. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Konzernsteuerquote.
Was sind die Hauptgründe für die zunehmende Bedeutung der Konzernsteuerquote?
Die zunehmende Bedeutung der Konzernsteuerquote resultiert aus der verstärkten Verwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (IAS/IFRS) und US-GAAP, die im Gegensatz zu HGB-Vorschriften die Veröffentlichung der Quote vorschreiben. Die Kapitalmarktorientierung und der Zusammenhang mit der Kennzahl "Gewinn je Aktie" spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Ein geringerer Steueraufwand führt zu einem höheren Gewinn je Aktie, was das Interesse des Kapitalmarktes an einer dauerhaften Senkung der Quote verstärkt.
Welche Funktionen hat die Konzernsteuerquote für interne und externe Interessenten?
Für interne Interessenten dient die Quote als Steuerungsinstrument für die betriebliche Steuerpolitik und als Indikator für die Effizienz der Steuerplanung. Externe Interessenten wie Investoren und Analysten nutzen sie als wichtige Kennzahl zur Bewertung der Unternehmensperformance und des Risikos. Der Text betont die unterschiedlichen Perspektiven und Informationsbedürfnisse der verschiedenen Stakeholder-Gruppen.
Wie beeinflusst die Konzernsteuerquote die betriebliche Steuerpolitik?
Die Fokussierung auf die Konzernsteuerquote führt zu einer Verdrängung der klassischen Steuerbilanzpolitik. Es entstehen neue Aktionsfelder im Kontext einer quotenorientierten Steuerpolitik, die Strategien zur Optimierung der Steuerquote und die Herausforderungen bei deren Umsetzung umfasst. Die Interaktion zwischen Steuerplanung und Gesamtstrategie des Unternehmens wird als komplex dargestellt.
Welche Kritikpunkte werden an der Konzernsteuerquote geäußert?
Ein Hauptkritikpunkt ist die begrenzte Beeinflussbarkeit der Quote durch die Steuerabteilung allein. Externe Faktoren wie die Rechtslage und die wirtschaftliche Situation haben einen erheblichen Einfluss. Die Arbeit diskutiert die Folgen dieser begrenzten Beeinflussbarkeit für die betriebliche Steuerpolitik und die Probleme bei der Vergleichbarkeit von Konzernsteuerquoten verschiedener Unternehmen aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Konzernsteuerquote, internationale Rechnungslegungsstandards (IAS/IFRS), US-GAAP, HGB, Gewinn je Aktie, Kapitalmarktorientierung, betriebliche Steuerpolitik, Steuerplanung, Steuerbilanzpolitik, Kennzahlenanalyse und Stakeholder.
- Quote paper
- Stefanie Schnee (Author), 2007, Konzernsteuerquote, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88125