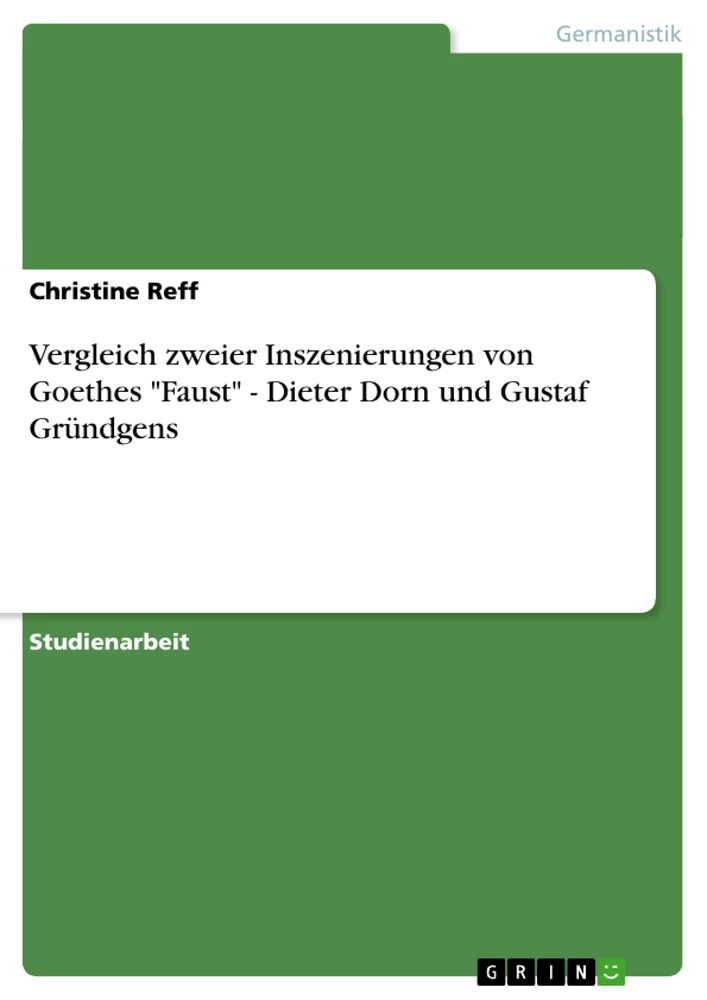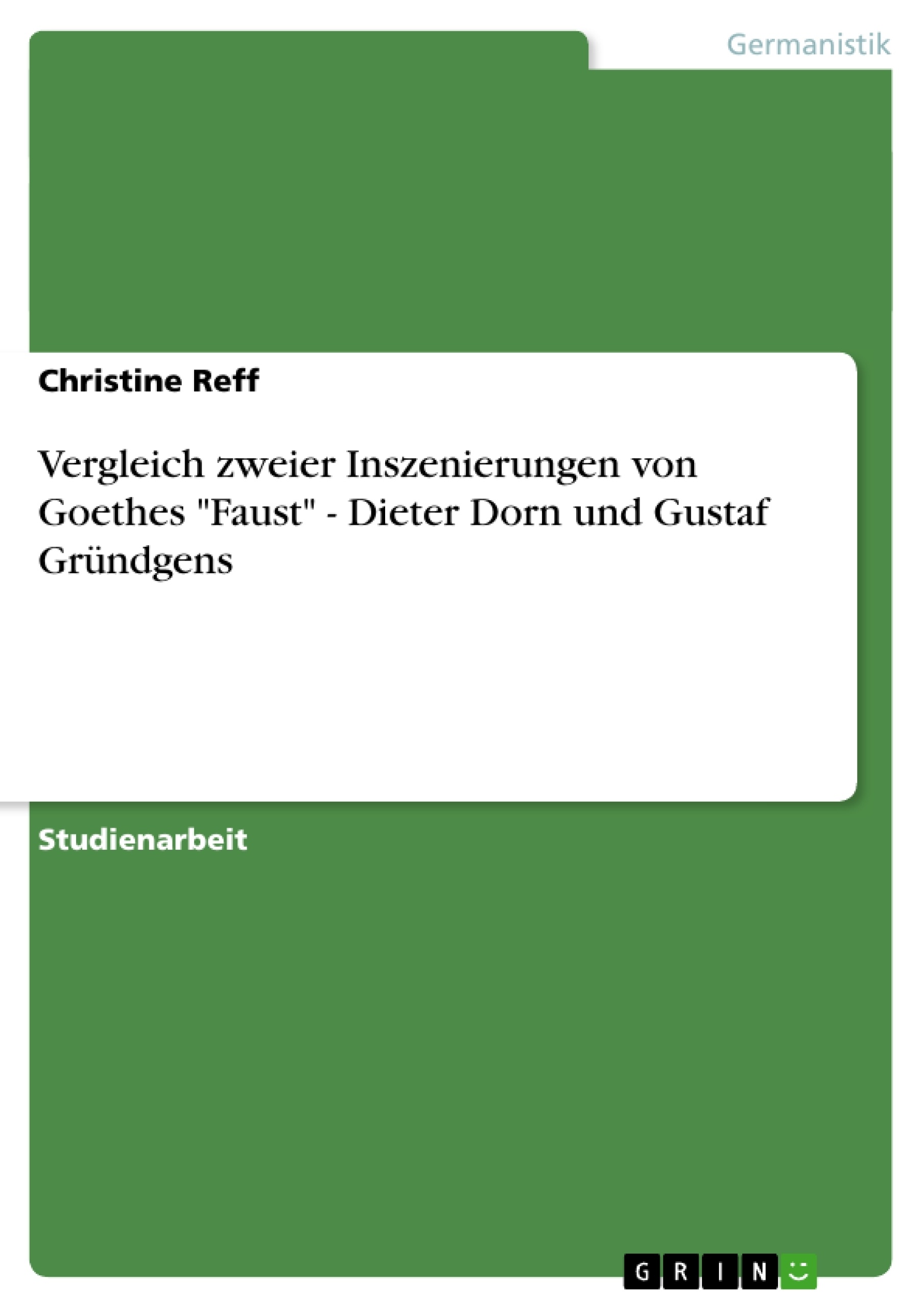Zwei bedeutende Faust-Verfilmungen sollen in dieser Arbeit miteinander verglichen werden, die von Peter Gorski aus dem Jahre 1960, die die Gründgens-Inszenierung von Goethes „Faust“ am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg aus dem Jahr 1960 praktisch „ohne Hinzufügungen und Veränderungen wiedergibt“ , und die von Dieter Dorn, der seine Verfilmung von 1988 eng an seine eigene Inszenierung der Goethe-Vorlage in den Münchner Kammerspielen anlehnte. Dies soll allerdings nicht im Hinblick auf die filmischen Elemente geschehen, wie es beispielsweise Michael Staiger in seinem Aufsatz „Faust verfilmt“ unternimmt, sondern hinsichtlich der Inszenierung, die in beiden Fällen der Verfilmung zugrunde liegt. Ich werde also nicht auf die filmspezifischen Aspekte, wie Kameraführung und Ähnliches eingehen, sondern mich auf das beschränken, was die Inszenierung ausmacht.
Von einem Vergleich mit der Tragödie von Johann Wolfgang von Goethe soll hier, abgesehen von der Untersuchung der Textauswahl der beiden Inszenierungen, weitestgehend abgesehen werden. Dies geschieht im Hinblick auf die Tatsache, dass, wie Michael Staiger bemerkt, „[e]ine Literaturverfilmung (…) nicht als Übersetzung zu verstehen [ist], sondern als Ausdruck einer Interpretation, einer subjektiven Lesart des schriftlich fixierten Textes“ . Dasselbe gilt ja auch schon für die Inszenierung an sich. Es soll also nicht darum gehen, die Inszenierungen von Gründgens und Dorn auf ihre Textnähe hin zu untersuchen, sondern sie als eigenständige Interpretationen aufzufassen, die ihre Vorlage deuten und auslegen, und nicht etwa nur als bloße Wiedergabe, geschweige denn in einem 1:1-Verhältnis. Angesichts dieser Prämisse wird der Vergleich der beiden Inszenierungen zu einem Vergleich von zwei Interpretationen ein und desselben Stoffes.
Da für einen Vergleich der beiden Inszenierungen insgesamt hier der Raum fehlt, soll der Vergleich exemplarisch an einer Szene festgemacht werden, an der Hexenküchen-Szene, deren unterschiedliche Bearbeitung in den beiden Inszenierungen sehr augenfällig ist, und die aufgrund der klaren, leicht erkenntlichen Unterschiede und des zeitlichen Umfangs, den sie in den Inszenierungen einnimmt, meiner Ansicht nach für die Behandlung im Unterricht besonders geeignet ist.
Des Weiteren sollen, im zweiten Teil der Arbeit, Perspektiven für die Interpretation im Unterricht der Sekundarstufe eröffnet werden. Auch dies geschieht im Hinblick auf den Interpretationscharakter der Inszenierungen.
Inhaltsverzeichnis
- Inszenierung als Interpretation
- Vergleich der „Faust“-Inszenierungen von Gustaf Gründgens und Dieter Dorn am Beispiel der Szene „Hexenküche“
- Die szenische Darstellung
- Kulisse
- Die Hauptfiguren
- Mephisto
- Faust
- Die Hexe
- Musik
- Textauswahl
- Die szenische Darstellung
- Der Vergleich der beiden Inszenierungen im Unterricht der Sekundarstufe
- Anhang
- Filmographie und Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht zwei Inszenierungen von Goethes „Faust“, eine von Gustaf Gründgens und eine von Dieter Dorn, anhand der Hexenküche-Szene. Ziel ist es, die unterschiedlichen Interpretationsansätze der beiden Regisseure aufzuzeigen und didaktische Möglichkeiten für den Einsatz im Sekundarunterricht aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der szenischen Gestaltung, der Textauswahl und dem daraus resultierenden Verständnis der jeweiligen Inszenierung als eigenständige Interpretation.
- Vergleich zweier unterschiedlicher Inszenierungen von Goethes „Faust“
- Analyse der szenischen Gestaltung (Kulisse, Kostüme, Musik)
- Untersuchung der Textauswahl und deren Bedeutung für die Interpretation
- Didaktische Überlegungen zum Einsatz im Sekundarunterricht
- Inszenierung als Interpretation des literarischen Originals
Zusammenfassung der Kapitel
Inszenierung als Interpretation: Diese Arbeit vergleicht die Faust-Inszenierungen von Gründgens und Dorn, nicht primär im Hinblick auf filmische Aspekte, sondern auf ihre jeweilige Inszenierung als eigenständige Interpretation von Goethes Werk. Der Vergleich konzentriert sich auf die Hexenküche-Szene aufgrund ihrer deutlichen Unterschiede in beiden Inszenierungen und ihrer Eignung für den Unterricht. Die Arbeit betont, dass eine Inszenierung nicht als bloße Wiedergabe des Textes zu verstehen ist, sondern als subjektive Lesart und Deutung.
Vergleich der „Faust“-Inszenierungen von Gustaf Gründgens und Dieter Dorn am Beispiel der Szene „Hexenküche“: Dieses Kapitel vergleicht die beiden Inszenierungen detailliert anhand der Hexenküche-Szene. Es werden die Unterschiede in der szenischen Gestaltung (Kulisse, Kostüme, Musik) und der Textauswahl analysiert, um die unterschiedlichen Interpretationsansätze von Gründgens und Dorn aufzuzeigen. Gründgens' Inszenierung präsentiert die Hexenküche als einen bunten, skurrilen Ort, während Dorn ein düsteres, unheimliches Ambiente schafft. Die unterschiedliche Textauswahl spiegelt die individuellen Interpretationsansätze wider und bietet Einblicke in die Konzepte der beiden Regisseure.
Der Vergleich der beiden Inszenierungen im Unterricht der Sekundarstufe: Dieser Abschnitt skizziert didaktische Möglichkeiten, um den Vergleich der beiden Inszenierungen im Unterricht der Sekundarstufe zu verwenden. Aufgrund der klaren Unterschiede in der szenischen Gestaltung und der Textauswahl bietet die Hexenküche-Szene ein hervorragendes Beispiel, um Schülern das Verständnis von Interpretation und subjektiver Lesart literarischer Werke zu vermitteln. Der Abschnitt deutet verschiedene didaktische Ansätze an, um die Thematik im Unterricht zu bearbeiten.
Schlüsselwörter
Goethe, Faust, Inszenierung, Gustaf Gründgens, Dieter Dorn, Hexenküche, Interpretation, Theater, Film, Verfilmung, Sekundarstufe, Didaktik, Szenische Gestaltung, Textauswahl.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich der "Faust"-Inszenierungen von Gustaf Gründgens und Dieter Dorn
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht zwei unterschiedliche Inszenierungen der Hexenküche-Szene aus Goethes "Faust", eine von Gustaf Gründgens und eine von Dieter Dorn. Der Fokus liegt auf der Analyse der unterschiedlichen Interpretationsansätze der Regisseure und der didaktischen Möglichkeiten für den Einsatz im Sekundarunterricht.
Welche Aspekte der Inszenierungen werden verglichen?
Der Vergleich umfasst die szenische Gestaltung (Kulisse, Kostüme, Musik), die Textauswahl und die daraus resultierende Interpretation der Szene. Es wird untersucht, wie die unterschiedlichen Entscheidungen der Regisseure zu verschiedenen Lesarten des Textes führen.
Welche Szene aus "Faust" steht im Mittelpunkt des Vergleichs?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Hexenküche-Szene, da diese in beiden Inszenierungen deutlich unterschiedliche Ausgestaltungen aufweist und sich gut für den Unterricht eignet.
Wie unterscheiden sich die Inszenierungen von Gründgens und Dorn?
Gründgens' Inszenierung präsentiert die Hexenküche als einen bunten, skurrilen Ort, während Dorn ein düsteres, unheimliches Ambiente schafft. Auch die Textauswahl unterscheidet sich deutlich, was die individuellen Interpretationsansätze der Regisseure widerspiegelt.
Welche didaktischen Möglichkeiten werden im Zusammenhang mit dem Vergleich der Inszenierungen aufgezeigt?
Die Arbeit skizziert didaktische Ansätze, um den Vergleich der beiden Inszenierungen im Sekundarunterricht zu nutzen. Die deutlichen Unterschiede in der szenischen Gestaltung und Textauswahl bieten Schülern die Möglichkeit, das Verständnis von Interpretation und subjektiver Lesart literarischer Werke zu vertiefen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Faust, Inszenierung, Gustaf Gründgens, Dieter Dorn, Hexenküche, Interpretation, Theater, Film, Verfilmung, Sekundarstufe, Didaktik, Szenische Gestaltung, Textauswahl.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: Inszenierung als Interpretation, Vergleich der "Faust"-Inszenierungen von Gründgens und Dorn (am Beispiel der Hexenküche), Der Vergleich der beiden Inszenierungen im Unterricht der Sekundarstufe, Anhang und Filmographie/Bibliographie.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass eine Inszenierung nicht als bloße Wiedergabe des literarischen Textes verstanden werden sollte, sondern als eine eigenständige, subjektive Interpretation.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Lehrer der Sekundarstufe, Studenten der Germanistik und alle, die sich für die Inszenierung von Goethes "Faust" und die didaktische Arbeit mit literarischen Texten interessieren.
- Quote paper
- Christine Reff (Author), 2005, Vergleich zweier Inszenierungen von Goethes "Faust" - Dieter Dorn und Gustaf Gründgens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88017