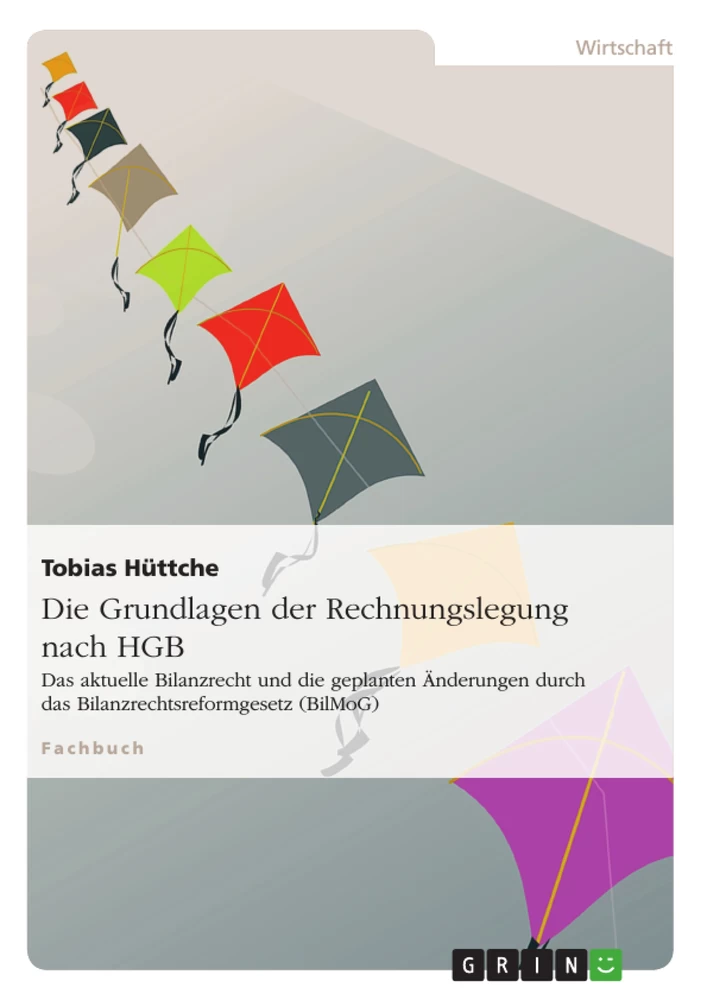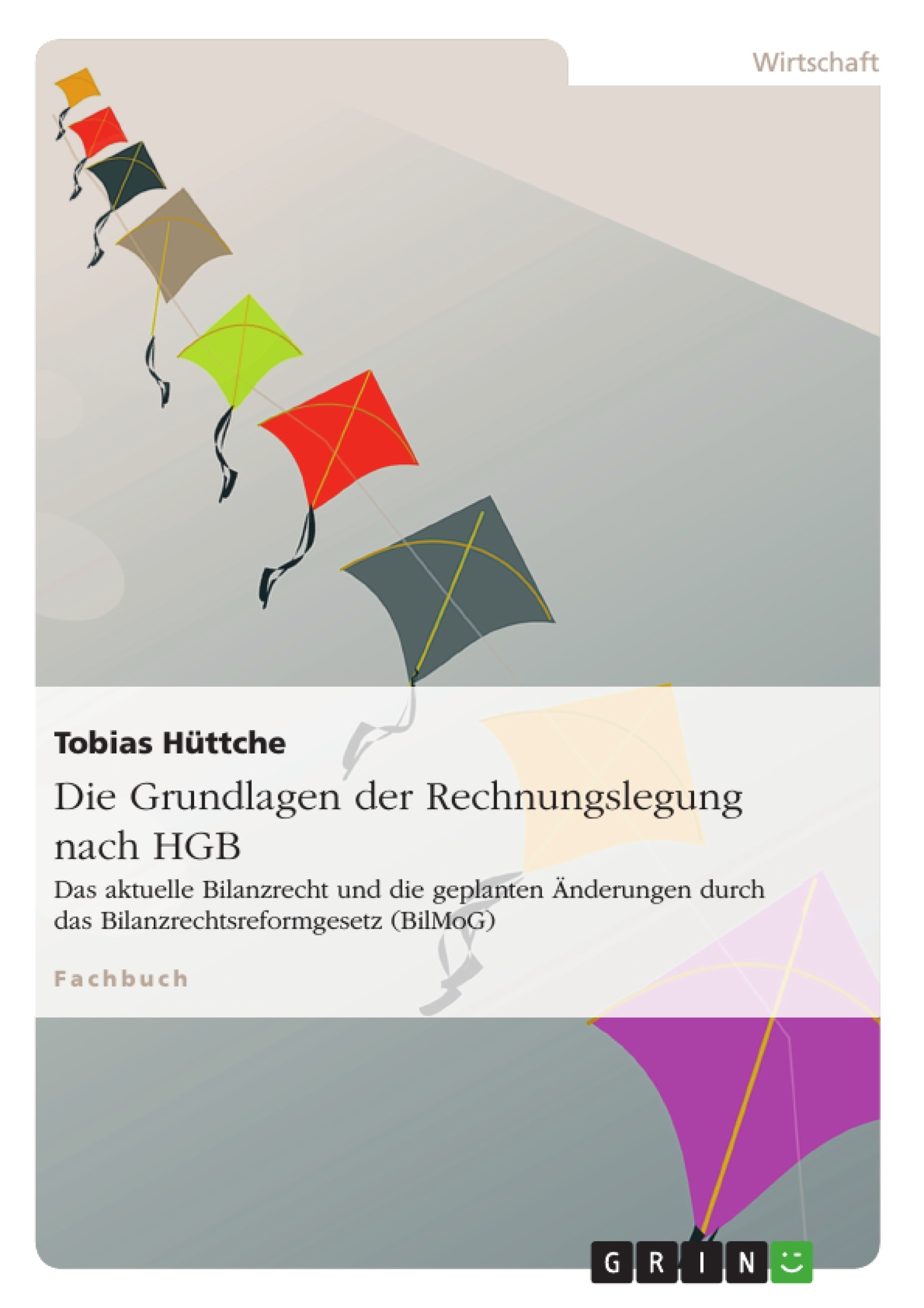Rechnungslegung wird mitunter als die Sprache der Wirtschaft bezeichnet. Finanzielle Informationen werden kommuniziert, dann aufgenommen und müssen schließlich verstanden werden. In Deutschland existiert bezüglich der Rechnungslegung noch eine Zwei-Klassen Gesellschaft: Auf der einen Seite börsennotierte Konzerne, deren Mutterunternehmen spätestens ab dem 1.1.2007 Konzernabschlüsse nach den IFRSs erstellen müssen. Andererseits kleine und mittlere Unternehmen, die unverbunden und regional tätig sind und auch weiterhin nach HGB und Steuerrecht bilanzieren.
Daran wird sich zumindest mittelfristig nichts ändern. Das Handelsrecht bleibt die Referenznorm für das Steuer- und Gesellschaftsrecht. Die Vorschriften über die Kapitalerhaltung und Ausschüttung rekurrieren ebenso auf einen nach handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellten Jahresabschluss, wie die steuerliche Gewinnermittlung. Ein großer Teil der Absolventen betriebswirtschaftlicher Studiengänge wird in Unternehmen tätig sein, deren Rechnungslegung – und damit auch das interne Berichtswesen – nach Handelsrecht erfolgt.
Auch wenn das HGB auf lange Sicht ein „Auslaufmodell“ sein mag, sprechen auch didaktische Gründe für die weitere Beschäftigung. Das HGB liegt uns bereits sprachlich nah. Die in den vergangenen Jahrzehnten erschienene Literatur erleichtert den Zugang und hilft ein tiefes Verständnis für die Grundprinzipien und Grundprobleme der Rechnungslegung zu entwickeln. Es ist wie mit Latein: Erst eine „tote“ Sprache schafft Verständnis und zeigt Strukturen des „lebendigen“ Worts. Da man immer durch Vergleichen lernt, dient das HGB damit auch als Ausgangspunkt und Referenzsystem, wenn es um neue Gesetze oder Standards geht.
Die Ausführungen berücksichtigen den aktuellen Rechtsstand (Januar 2008). Auf den vorliegenden Referentenentwurf eines Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wird in einem gesonderten Kapitel eingegangen und an den entsprechenden Stellen vermerkt, wo sich Änderungen ergeben können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Normative Grundlagen der handelsrechtlichen Rechnungslegung
- 1.1 Gesetzliche Grundlagen
- 1.1.1 Handelsrecht
- 1.1.2 Gesellschaftsrecht
- 1.1.3 Steuerrecht
- 1.2 Standardsetter
- 1.2.2 DRSC
- 1.2.3 IDW
- 1.3 Branchenspezifika
- 1.4 Enforcement
- 2 Grundlagen der Bilanzierung und Bewertung
- 2.1 Funktionen der externen Rechnungslegung
- 2.2 Instrumente der externen Rechnungslegung
- 2.2.1 Bedeutung von Größe und Rechtsform der Unternehmen
- 2.2.1.1 Buchführungspflicht
- 2.2.1.3 Rechtsformunterschiede
- 2.2.1.3 Größenklassen
- 2.2.1.3 Konzernrechnungslegung
- 2.2.2 Bilanz
- 2.2.3 Gewinn-und-Verlust-Rechnung
- 2.2.4 Anhang
- 2.2.5 Lageberichterstattung
- 2.2.6 Ergänzende Instrumente im Konzernabschluss
- 3 Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung
- 3.1 Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
- 3.1.1 Bedeutung und Quellen der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
- 3.1.2 Struktur der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
- 3.1.3 Wesentliche Grundsätze
- 3.1.3.1 Grundsatz der Richtigkeit
- 3.1.3.2 Grundsatz der Klarheit
- 3.1.3.3 Grundsatz der Einzelbewertung
- 3.1.3.4 Grundsatz der Vollständigkeit
- 3.1.3.5 Grundsatz der Vorsicht
- 3.1.3.6 Grundsatz der Bilanzidentität
- 3.1.3.7 Grundsatz der Unternehmensfortführung
- 3.1.3.8 Grundsatz der Bewertungsstetigkeit
- 3.1.3.9 Abweichung von den Grundsätzen der Bilanzierung und Bewertung
- 3.2 Generalnorm des § 264 Abs. 2 HGB
- 4 Abgrenzung des Bilanzinhalts dem Grunde und der Höhe nach
- 4.1 Bilanzierungskonzeption
- 4.1.1 Überblick
- 4.1.2 Abstrakte Bilanzierungsfähigkeit
- 4.1.3 Konkrete Bilanzierungsfähigkeit
- 4.1.3.1 Wirtschaftliches Eigentum
- 4.1.3.2 Besonderheiten bei Personengesellschaften
- 4.1.3.3 Bilanzierungswahlrechte und Bilanzierungsverbote
- 4.2 Erfassung von Erträgen und Aufwendungen
- 4.3 Bewertungskonzeption
- 4.3.1 Erstbewertung
- 4.3.1.1 Anschaffungskosten
- 4.3.1.2 Herstellungskosten
- 4.3.1.3 Bewertungsvereinfachungsverfahren
- 4.3.2 Folgebewertung
- 4.3.2.1 Bewertungssystematik
- 4.3.2.2 Planmäßige Abschreibungen
- 4.3.2.2.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter
- 4.3.2.2.2 Parameter der planmäßigen Abschreibung
- 4.3.2.3 Außerplanmäßige Abschreibungen
- 4.3.2.4 Zuschreibung
- 5 Abbildung der unternehmerischen Tätigkeit im Rechnungswesen
- 5.1 Überblick
- 5.2 Kapitalaufbringung
- 5.2.1 Eigenkapital und Fremdkapital
- 5.2.2 Eigenkapital
- 5.2.2.1 Rechtsformunterschiede
- 5.2.2.2 Vorschriften zur Kapitalausstattung und Kapitalaufbringung
- 5.2.2.3 Veränderungen des gezeichneten Kapitals
- 5.2.2.4 Kapitalrücklagen
- 5.2.2.5 Gewinnrücklagen
- 5.2.2.6 Ausstehende Einlagen
- 5.2.2.7 Rücklage für eigene Anteile
- 5.2.2.8 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
- 5.2.2.9 Sonderposten mit Rücklageanteil
- 5.2.3 Fremdkapital
- 5.2.3.1 Bilanzielles Fremdkapital
- 5.2.3.2 Rückstellungen
- 5.2.3.2.1 Überblick
- 5.2.3.2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
- 5.2.3.2.3 Rückstellung für drohende Verluste
- 5.2.3.2.4 Pensionsrückstellungen
- 5.2.3.2.5 Aufwandsrückstellungen
- 5.2.3.3 Passive Rechnungsabgrenzungsposten
- 5.2.3.4 Verbindlichkeiten
- 5.2.3.5 Vermerkpflichten unter der Bilanz
- 5.2.3.5.1 Haftungsverhältnisse
- 5.2.3.5.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
- 5.3 Kapitalverwendung
- 5.3.1 Abgrenzung von Anlagevermögen und Umlaufvermögen
- 5.3.2 Immaterielle Vermögensgegenstände
- 5.3.3 Sachanlagen
- 5.3.4 Finanzanlagen
- 5.3.5 Umlaufvermögen
- 5.3.5.1 Vorräte
- 5.3.5.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
- 5.3.5.3 Wertpapiere
- 5.3.5.4 Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
- 5.3.6 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
- 5.3.7 Latente Steuern
- 5.3.8 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
- 5.4 Realisierung - Gewinn- und Verlustrechnung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Werk bietet eine umfassende Einführung in die Grundlagen der Rechnungslegung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB). Ziel ist es, ein tiefgreifendes Verständnis der Prinzipien und Methoden der handelsrechtlichen Bilanzierung und Bewertung zu vermitteln, unter Berücksichtigung der geplanten Änderungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG).
- Normative Grundlagen der handelsrechtlichen Rechnungslegung
- Grundlagen der Bilanzierung und Bewertung nach HGB
- Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)
- Abgrenzung des Bilanzinhalts
- Abbildung der unternehmerischen Tätigkeit im Rechnungswesen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Normative Grundlagen der handelsrechtlichen Rechnungslegung: Dieses Kapitel legt die gesetzlichen und regulatorischen Grundlagen der Rechnungslegung nach HGB dar. Es beleuchtet die Rolle des Handelsrechts, des Gesellschaftsrechts und des Steuerrechts, sowie den Einfluss von Standardsetzern wie dem DRSC und dem IDW. Die Bedeutung von Branchenspezifika und die Durchsetzung der Rechnungslegungsvorschriften (Enforcement) werden ebenfalls behandelt. Das Kapitel schafft ein solides Fundament für das Verständnis des gesamten Rahmens der HGB-Rechnungslegung.
2. Grundlagen der Bilanzierung und Bewertung: Dieses Kapitel untersucht die Funktionen der externen Rechnungslegung und die wichtigsten Instrumente, insbesondere Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht. Es analysiert den Einfluss von Unternehmensgröße und Rechtsform auf die Bilanzierung, einschließlich der Konzernrechnungslegung. Der Fokus liegt auf der Vermittlung der grundlegenden Prinzipien und der Anwendung in der Praxis.
3. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung: Hier werden die zentralen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) im Detail erläutert. Es werden die Bedeutung und die Quellen der GoB sowie deren Struktur und wesentliche Einzelgrundsätze (Richtigkeit, Klarheit, Einzelbewertung, Vollständigkeit, Vorsicht, Bilanzidentität, Unternehmensfortführung, Bewertungsstetigkeit) behandelt. Die Generalnorm des § 264 Abs. 2 HGB und mögliche Abweichungen von den Grundsätzen werden ebenfalls besprochen.
4. Abgrenzung des Bilanzinhalts dem Grunde und der Höhe nach: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bilanzierungskonzeption, der Unterscheidung zwischen abstrakter und konkreter Bilanzierungsfähigkeit, sowie der Erfassung von Erträgen und Aufwendungen. Die Bewertungskonzeption wird ausführlich behandelt, einschließlich Erst- und Folgebewertung, Abschreibungsmethoden und Zuschreibungen. Es werden wichtige Aspekte wie das wirtschaftliche Eigentum und Bilanzierungswahlrechte detailliert analysiert.
5. Abbildung der unternehmerischen Tätigkeit im Rechnungswesen: Das Kapitel fokussiert die Abbildung der Kapitalaufbringung und -verwendung im Rechnungswesen. Es beschreibt die Darstellung von Eigen- und Fremdkapital, einschließlich der verschiedenen Arten von Rücklagen und Rückstellungen. Die Unterscheidung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen wird detailliert erklärt und die Behandlung verschiedener Vermögensgegenstände wie immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Finanzanlagen und Vorräte wird beleuchtet. Schließlich wird die Gewinn- und Verlustrechnung als Ergebnis der unternehmerischen Tätigkeit dargestellt.
Schlüsselwörter
Handelsgesetzbuch (HGB), Rechnungslegung, Bilanzierung, Bewertung, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Lagebericht, Konzernrechnungslegung, Eigenkapital, Fremdkapital, Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Abschreibungen, Rückstellungen, Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG).
Häufig gestellte Fragen zum Werk: Grundlagen der Handelsrechtlichen Rechnungslegung
Was sind die behandelten Themengebiete des Buches?
Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Grundlagen der Rechnungslegung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB). Es deckt die normativen Grundlagen, die Prinzipien der Bilanzierung und Bewertung, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), die Abgrenzung des Bilanzinhalts und die Abbildung der unternehmerischen Tätigkeit im Rechnungswesen ab. Besondere Berücksichtigung findet das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG).
Welche Kapitel umfasst das Buch und was ist deren Inhalt?
Das Buch gliedert sich in fünf Kapitel:
Kapitel 1: Normative Grundlagen der handelsrechtlichen Rechnungslegung: Behandelt die gesetzlichen und regulatorischen Grundlagen, die Rolle von Handels-, Gesellschafts- und Steuerrecht sowie die Einflussnahme von Standardsetzern (DRSC, IDW), Branchenspezifika und Enforcement.
Kapitel 2: Grundlagen der Bilanzierung und Bewertung: Erklärt die Funktionen der externen Rechnungslegung und deren Instrumente (Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht) unter Berücksichtigung von Unternehmensgröße und Rechtsform sowie Konzernrechnungslegung.
Kapitel 3: Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung: Detaillierte Erläuterung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), einschließlich ihrer Bedeutung, Quellen, Struktur und wesentlicher Einzelgrundsätze (Richtigkeit, Klarheit, Einzelbewertung, Vollständigkeit, Vorsicht, Bilanzidentität, Unternehmensfortführung, Bewertungsstetigkeit). Die Generalnorm des § 264 Abs. 2 HGB und mögliche Abweichungen werden ebenfalls behandelt.
Kapitel 4: Abgrenzung des Bilanzinhalts dem Grunde und der Höhe nach: Fokus auf Bilanzierungskonzeption, abstrakte und konkrete Bilanzierungsfähigkeit, Erfassung von Erträgen und Aufwendungen, Bewertungskonzeption (Erst- und Folgebewertung, Abschreibungsmethoden, Zuschreibungen), wirtschaftliches Eigentum und Bilanzierungswahlrechte.
Kapitel 5: Abbildung der unternehmerischen Tätigkeit im Rechnungswesen: Behandelt die Darstellung von Kapitalaufbringung und -verwendung, Eigen- und Fremdkapital (inkl. Rücklagen und Rückstellungen), die Unterscheidung von Anlage- und Umlaufvermögen, sowie die Behandlung verschiedener Vermögensgegenstände (immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Finanzanlagen, Vorräte) und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Welche Zielsetzung verfolgt das Buch?
Das Buch zielt darauf ab, ein tiefgreifendes Verständnis der Prinzipien und Methoden der handelsrechtlichen Bilanzierung und Bewertung zu vermitteln. Es soll ein umfassendes Wissen über die Grundlagen der HGB-Rechnungslegung, unter Berücksichtigung des BilMoG, vermitteln.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Buches?
Handelsgesetzbuch (HGB), Rechnungslegung, Bilanzierung, Bewertung, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Lagebericht, Konzernrechnungslegung, Eigenkapital, Fremdkapital, Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Abschreibungen, Rückstellungen, Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG).
Für wen ist dieses Buch geeignet?
Dieses Buch ist für alle geeignet, die sich umfassend in die Grundlagen der handelsrechtlichen Rechnungslegung einarbeiten möchten, einschließlich Studierender der Wirtschaftswissenschaften, Praktiker in der Buchhaltung und Wirtschaftsprüfung sowie alle Interessierten an der Thematik.
- Quote paper
- Prof. Dr. Tobias Hüttche (Author), 2008, Die Grundlagen der Rechnungslegung nach HGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87715