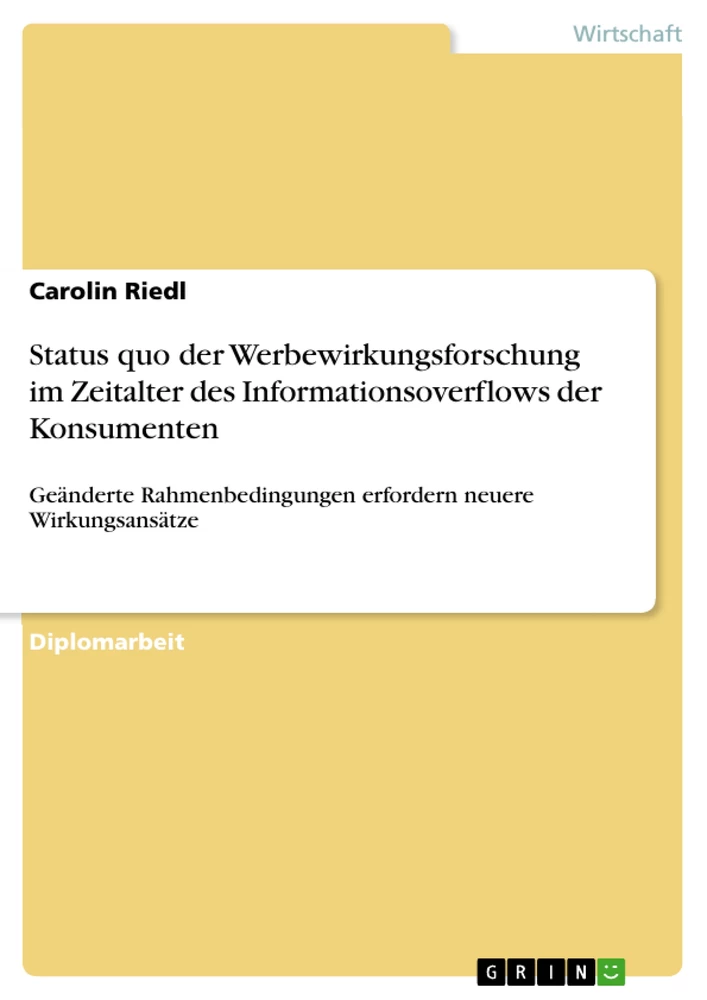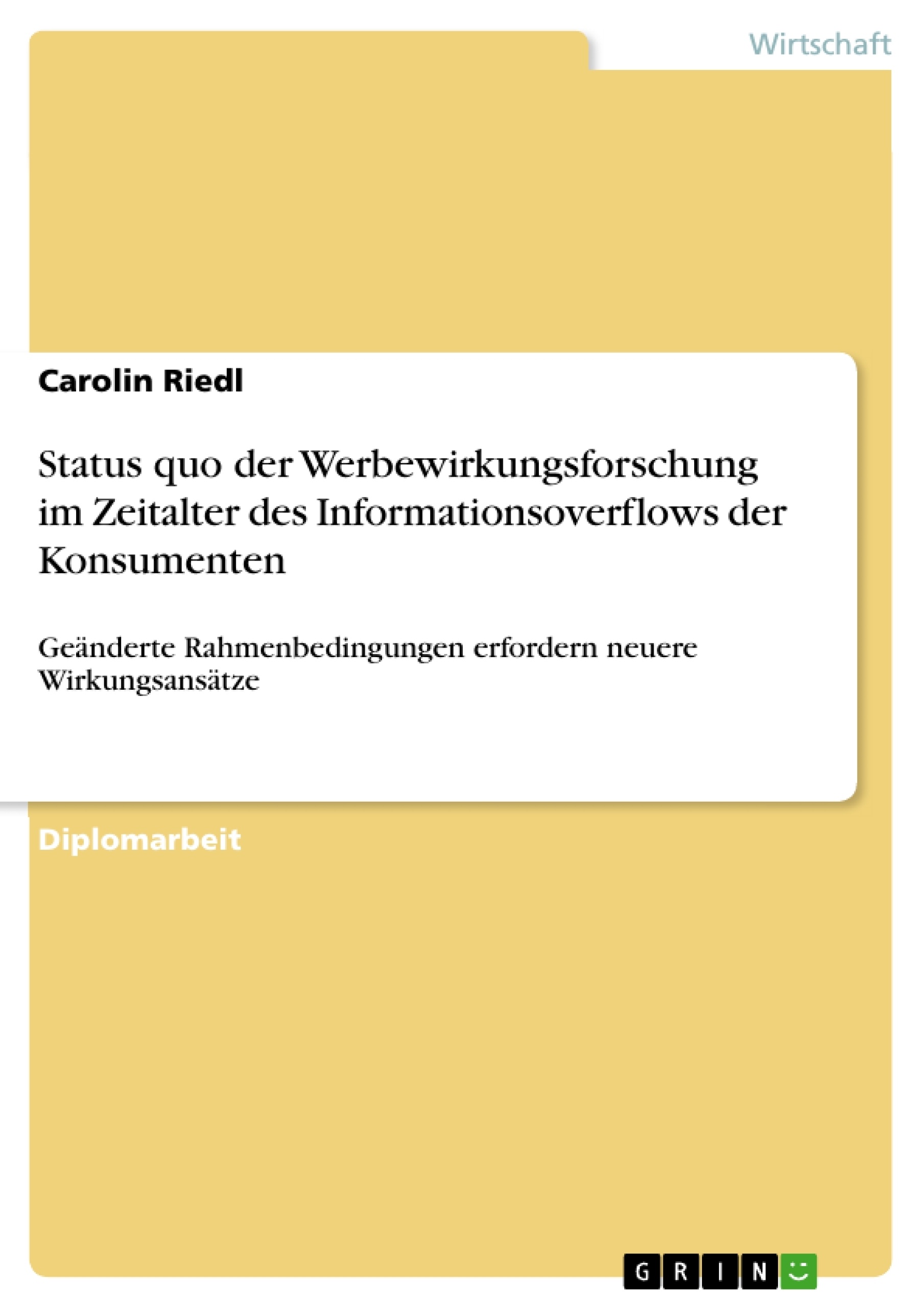Die Anzahl der Veröffentlichungen über die Wirkung von Werbung ist kaum überschaubar. Das große Interesse an der Frage, ob und wie die Werbung auf den Konsumenten wirkt, ist angesichts der rund 30 Milliarden Euro, die Unternehmen jedes Jahr in Deutschland in Werbung investieren, wenig erstaunlich. Der berühmte Satz des amerikanischen Warenhausunternehmers John Wanamaker „Ich weiß, dass die Hälfte meiner Werbeausgaben herausgeschmissenes Geld ist – ich weiß nur nicht welche Hälfte“, charakterisiert nicht nur die Situation seiner Zeit.
Auch heute, nach über 50 Jahren, kann die Frage, welchen Erfolg die getätigten Werbeinvestitionen bringen und was erfolgreiche Werbung ausmacht, nicht ganzheitlich und zufrieden stellend beantwortet werden. In keinem anderen Unternehmensbereich herrscht bei vergleichbarer Investitionshöhe so große Ungewissheit über deren Erfolg. Dabei wird es für die Werbetreibenden angesichts der knapper werdenden Budgets immer wichtiger, die Investitionen effektiv einzusetzen.
Erfolgreiches Werben setzt Kenntnisse der Werbewirkung voraus. Dabei stehen Fragen nach den Wirkungsmechanismen sowie der Messbarkeit von Werbewirkung im Vordergrund.
Werbung gilt als eine Investition in den Wert einer Marke und will neben der Absatzsteigerung vor allem die psychologischen Prozesse im Inneren des Konsumenten beeinflussen. Werbung wirkt zunächst direkt auf die psychologischen Prozesse und erst danach indirekt auf das eigentliche Kaufverhalten. Die psychologischen Werbewirkungen stehen meist im Mittelpunkt der Forschung, da die ökonomischen Wirkungen durch zahlreiche Faktoren beeinflusst werden, was eine Zuordnung des Wirkungszusammenhangs zur Werbung erschwert.
Nahezu jedes Werbewirkungsmodell geht von der Annahme aus, dass Werbung nur wirken kann, nachdem sie vom Konsumenten zunächst wahrgenommen wurde. Nach Kroeber-Riel herrscht in Deutschland durch die Werbung ein Informationsoverflow von etwa 95%. Dieser Umstand bedeutet für ihn, dass lediglich 5% der dargebotenen Werbeinformationen die Empfänger erreichen und die verbleibenden 95% somit unwirksam sind. Jeden Tag überfluten Konsumenten mehr als 3.000 Werbebotschaften, die um seine Aufmerksamkeit konkurrieren und Experten rechnen mit einem weiteren Anstieg.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemdarstellung und Ziel der Arbeit
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Begriffliche Abgrenzung
- 2.1 Werbung
- 2.2 Werbewirkung und Werbeerfolg
- 2.3 Werbewirkungsforschung
- 2.4 Involvement
- 2.5 Informationsoverflow
- 3. Werbeziele
- 3.1 Ökonomische Werbeziele
- 3.2 Psychologische Werbeziele
- 4. Werbewirkungsmodelle und -theorien
- 4.1 Stimulus-Response-Modelle
- 4.2 Stufenmodelle
- 4.3 Involvement-Modelle
- 4.4 Sinus-Milieu-Modell
- 5. Werbewirkungskriterien
- 5.1 Wahrnehmung und Aufmerksamkeit
- 5.1.1 Selektive Wahrnehmung
- 5.1.2 Effekte der Werbewiederholung
- 5.2 Informationsverarbeitung und -speicherung
- 5.3 Werbekenntnis und Markenbekanntheit
- 5.4 Emotionen und Stimmungen
- 5.5 Motivation
- 5.6 Einstellungen und Präferenzen
- 5.7 Kaufabsicht
- 6. Erhebungsmethoden zur Messung der Werbewirkung
- 6.1 Grundlagen
- 6.2 Befragung
- 6.2.1 Persönliche Befragung
- 6.2.2 Schriftliche Befragung
- 6.2.3 Telefonische Befragung
- 6.2.4 Online-Befragung
- 6.2.5 Interaktive Befragung
- 6.2.6 Panelerhebungen
- 6.3 Beobachtung
- 6.4 Inhaltsanalyse
- 6.5 Experiment
- 7. Messung von Werbewirkung
- 7.1 Implizite Messverfahren
- 7.2 Nonverbale Messverfahren
- 7.3 Pretest und Posttest
- 7.4 Copytest
- 7.5 Tracking-Studien
- 7.6 Probleme der Messung von Werbewirkung
- 7.6.1 Wirkungsinterdependenzen
- 7.6.2 Spezifische und grundsätzliche Messprobleme
- 8. Erkenntnisse des Neuromarketing
- 8.1 Pilot und Autopilot
- 8.2 Der Einfluss von Emotionen
- 9. Veränderte Rahmenbedingungen
- 9.1 Entwicklung der Werbeträger und Werbemaßnahmen
- 9.1.1 Direktmarketing
- 9.1.1.1 Direct Mail
- 9.1.1.2 Internetwerbung
- 9.1.1.3 E-Mail-Marketing
- 9.1.1.4 Mobile Marketing
- 9.1.1.5 Faxwerbung
- 9.1.1.6 Telefonmarketing
- 9.1.1.7 Teleshopping
- 9.1.1.8 Kundenclubs
- 9.1.2 Fernsehwerbung
- 9.2 Marktsättigung
- 9.3 Demografischer Wandel
- 9.4 Verändertes Konsumentenverhalten
- 9.4.1 Wertewandel
- 9.4.2 Preissensibilität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Status Quo der Werbewirkungsforschung im Kontext des heutigen Informationsoverflows bei Konsumenten. Ziel ist es, die geänderten Rahmenbedingungen aufzuzeigen und neue Wirkungsansätze zu beleuchten.
- Einfluss des Informationsoverflows auf die Werbewirkung
- Analyse verschiedener Werbewirkungsmodelle und -theorien
- Bewertung unterschiedlicher Methoden zur Messung der Werbewirkung
- Bedeutung des Neuromarketings für die Werbewirkungsforschung
- Herausforderungen und zukünftige Trends in der Werbewirkungsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Werbewirkungsforschung im Zeitalter des Informationsoverflows ein. Sie beschreibt die Problemstellung und das Ziel der Arbeit, welches darin besteht, die Herausforderungen der heutigen Konsumentenlandschaft für die Werbewirkungsforschung zu analysieren und neue Ansätze aufzuzeigen. Der Aufbau der Arbeit wird ebenfalls skizziert.
2. Begriffliche Abgrenzung: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe der Arbeit, darunter Werbung, Werbewirkung, Werbeerfolg und Werbewirkungsforschung. Es werden zudem die Konzepte Involvement und Informationsoverflow definiert und in den Kontext der Werbewirkungsforschung eingeordnet. Die präzise Definition dieser Begriffe legt die Grundlage für die weitere Analyse.
3. Werbeziele: Hier werden ökonomische und psychologische Werbeziele unterschieden und detailliert beschrieben. Die Unterscheidung ist wichtig, um die verschiedenen Perspektiven und Messgrößen der Werbewirkung zu verstehen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der unterschiedlichen Ziele, die mit einer Werbekampagne verfolgt werden können.
4. Werbewirkungsmodelle und -theorien: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Modelle und Theorien der Werbewirkung, wie Stimulus-Response-Modelle, Stufenmodelle und Involvement-Modelle, sowie das Sinus-Milieu-Modell. Es analysiert ihre Stärken und Schwächen und zeigt auf, wie sie sich im Kontext des Informationsoverflows bewähren.
5. Werbewirkungskriterien: In diesem Kapitel werden zentrale Kriterien zur Messung der Werbewirkung erläutert, von Wahrnehmung und Aufmerksamkeit über Informationsverarbeitung und -speicherung bis hin zu Emotionen, Motivation, Einstellungen, Präferenzen und Kaufabsicht. Die detaillierte Darstellung der Kriterien bietet einen umfassenden Überblick über die Messbarkeit der Werbewirkung.
6. Erhebungsmethoden zur Messung der Werbewirkung: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Methoden zur Erhebung von Daten zur Werbewirkung, wie Befragungen (persönlich, schriftlich, telefonisch, online, interaktiv), Beobachtung, Inhaltsanalyse und Experimente. Die verschiedenen Methoden werden im Hinblick auf ihre Vor- und Nachteile im Kontext der Werbewirkungsforschung verglichen.
7. Messung von Werbewirkung: Hier werden verschiedene Verfahren zur Messung der Werbewirkung vorgestellt, einschließlich impliziter und nonverbaler Messmethoden, Pretests und Posttests, Copytests und Tracking-Studien. Die Kapitel beleuchtet auch die Probleme der Werbewirkungs-Messung, wie Wirkungsinterdependenzen und spezifische Messprobleme.
8. Erkenntnisse des Neuromarketing: Dieses Kapitel befasst sich mit den Erkenntnissen des Neuromarketings für die Werbewirkungsforschung. Es werden die Konzepte „Pilot und Autopilot“ und der Einfluss von Emotionen auf Kaufentscheidungen erläutert. Die Integration neurowissenschaftlicher Erkenntnisse in die Werbewirkungsforschung wird diskutiert.
9. Veränderte Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel analysiert die Veränderungen im Werbeumfeld, wie die Entwicklung der Werbeträger und Werbemaßnahmen (einschließlich Direktmarketing, Internetwerbung, E-Mail-Marketing, Mobile Marketing, etc.), Marktsättigung, demografischer Wandel und das veränderte Konsumentenverhalten (Wertewandel, Preissensibilität). Die Analyse der Veränderungen im Kontext der Werbewirkungsforschung bildet den Kern des Kapitels.
Schlüsselwörter
Werbewirkungsforschung, Informationsoverflow, Konsumentenverhalten, Werbemodelle, Werbewirkungskriterien, Messmethoden, Neuromarketing, Direktmarketing, Internetwerbung, Marktsättigung, Wertewandel.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Werbewirkungsforschung im Informationszeitalter
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Arbeit untersucht den aktuellen Stand der Werbewirkungsforschung, insbesondere im Kontext des heutigen Informationsüberflusses bei Konsumenten. Sie analysiert die sich verändernden Rahmenbedingungen und beleuchtet neue Ansätze zur Wirkungsanalyse.
Welche Ziele werden in der Arbeit verfolgt?
Die Diplomarbeit hat zum Ziel, die Herausforderungen des Informationsoverflows für die Werbewirkungsforschung aufzuzeigen und neue Wirkungsansätze zu beleuchten. Konkret werden der Einfluss des Informationsoverflows, verschiedene Werbewirkungsmodelle, Messmethoden, die Bedeutung des Neuromarketings und zukünftige Trends untersucht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss des Informationsoverflows auf die Werbewirkung, der Analyse verschiedener Werbewirkungsmodelle und -theorien, der Bewertung unterschiedlicher Methoden zur Messung der Werbewirkung, der Bedeutung des Neuromarketings und den Herausforderungen sowie zukünftigen Trends in der Werbewirkungsforschung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Einleitung, Begriffliche Abgrenzung, Werbeziele, Werbewirkungsmodelle und -theorien, Werbewirkungskriterien, Erhebungsmethoden zur Messung der Werbewirkung, Messung von Werbewirkung, Erkenntnisse des Neuromarketings und Veränderte Rahmenbedingungen. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Werbewirkungsforschung im Kontext des Informationsüberflusses.
Wie werden die zentralen Begriffe definiert?
Das zweite Kapitel widmet sich der genauen Definition zentraler Begriffe wie Werbung, Werbewirkung, Werbeerfolg, Werbewirkungsforschung, Involvement und Informationsoverflow. Diese präzisen Definitionen bilden die Grundlage für die gesamte Analyse.
Welche Werbewirkungsmodelle und -theorien werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert verschiedene Werbewirkungsmodelle, darunter Stimulus-Response-Modelle, Stufenmodelle, Involvement-Modelle und das Sinus-Milieu-Modell. Ihre Stärken und Schwächen werden im Kontext des Informationsoverflows bewertet.
Welche Kriterien zur Messung der Werbewirkung werden erläutert?
Das fünfte Kapitel beschreibt detailliert die Kriterien zur Messung der Werbewirkung, beginnend bei Wahrnehmung und Aufmerksamkeit bis hin zu Emotionen, Motivation, Einstellungen, Präferenzen und Kaufabsicht.
Welche Erhebungsmethoden werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Methoden zur Datenerhebung, wie Befragungen (persönlich, schriftlich, telefonisch, online, interaktiv), Beobachtung, Inhaltsanalyse und Experimente. Die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methoden werden im Kontext der Werbewirkungsforschung verglichen.
Wie wird die Werbewirkung gemessen?
Kapitel sieben beschreibt verschiedene Messverfahren, darunter implizite und nonverbale Messmethoden, Pretests und Posttests, Copytests und Tracking-Studien. Es werden auch die Probleme der Werbewirkungs-Messung, wie Wirkungsinterdependenzen und spezifische Messprobleme, beleuchtet.
Welche Rolle spielt das Neuromarketing?
Die Arbeit untersucht die Erkenntnisse des Neuromarketings für die Werbewirkungsforschung, insbesondere die Konzepte „Pilot und Autopilot“ und den Einfluss von Emotionen auf Kaufentscheidungen.
Welche veränderten Rahmenbedingungen werden analysiert?
Das letzte Kapitel analysiert Veränderungen im Werbeumfeld, wie die Entwicklung der Werbeträger und Werbemaßnahmen (Direktmarketing, Internetwerbung etc.), Marktsättigung, demografischer Wandel und veränderte Konsumentenverhalten (Wertewandel, Preissensibilität).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Werbewirkungsforschung, Informationsoverflow, Konsumentenverhalten, Werbemodelle, Werbewirkungskriterien, Messmethoden, Neuromarketing, Direktmarketing, Internetwerbung, Marktsättigung, Wertewandel.
- Quote paper
- Carolin Riedl (Author), 2007, Status quo der Werbewirkungsforschung im Zeitalter des Informationsoverflows der Konsumenten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87653