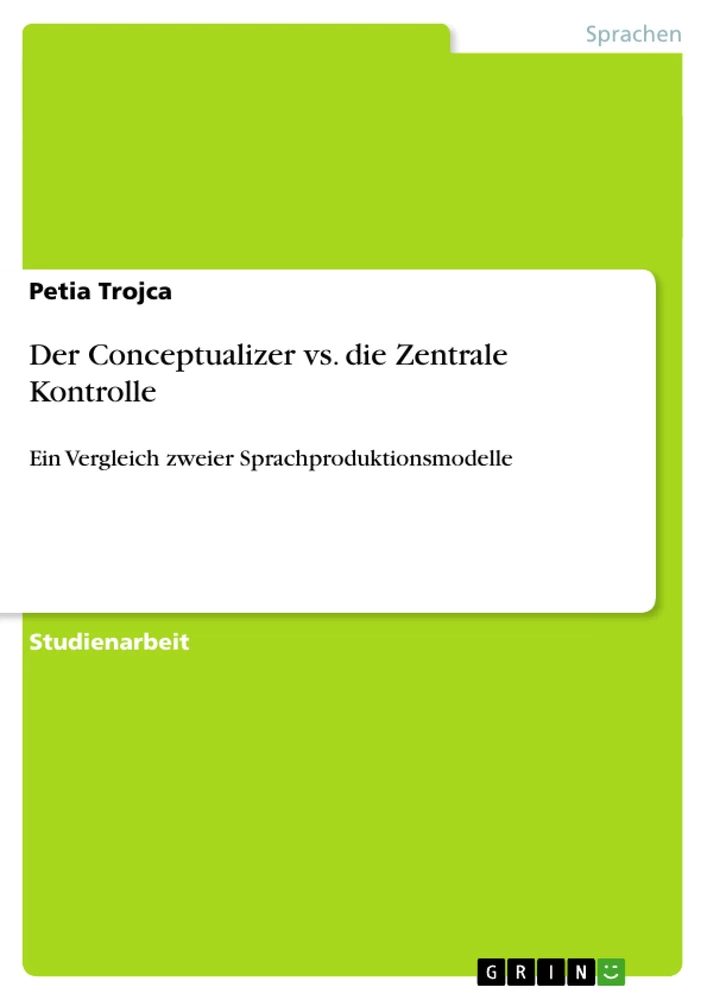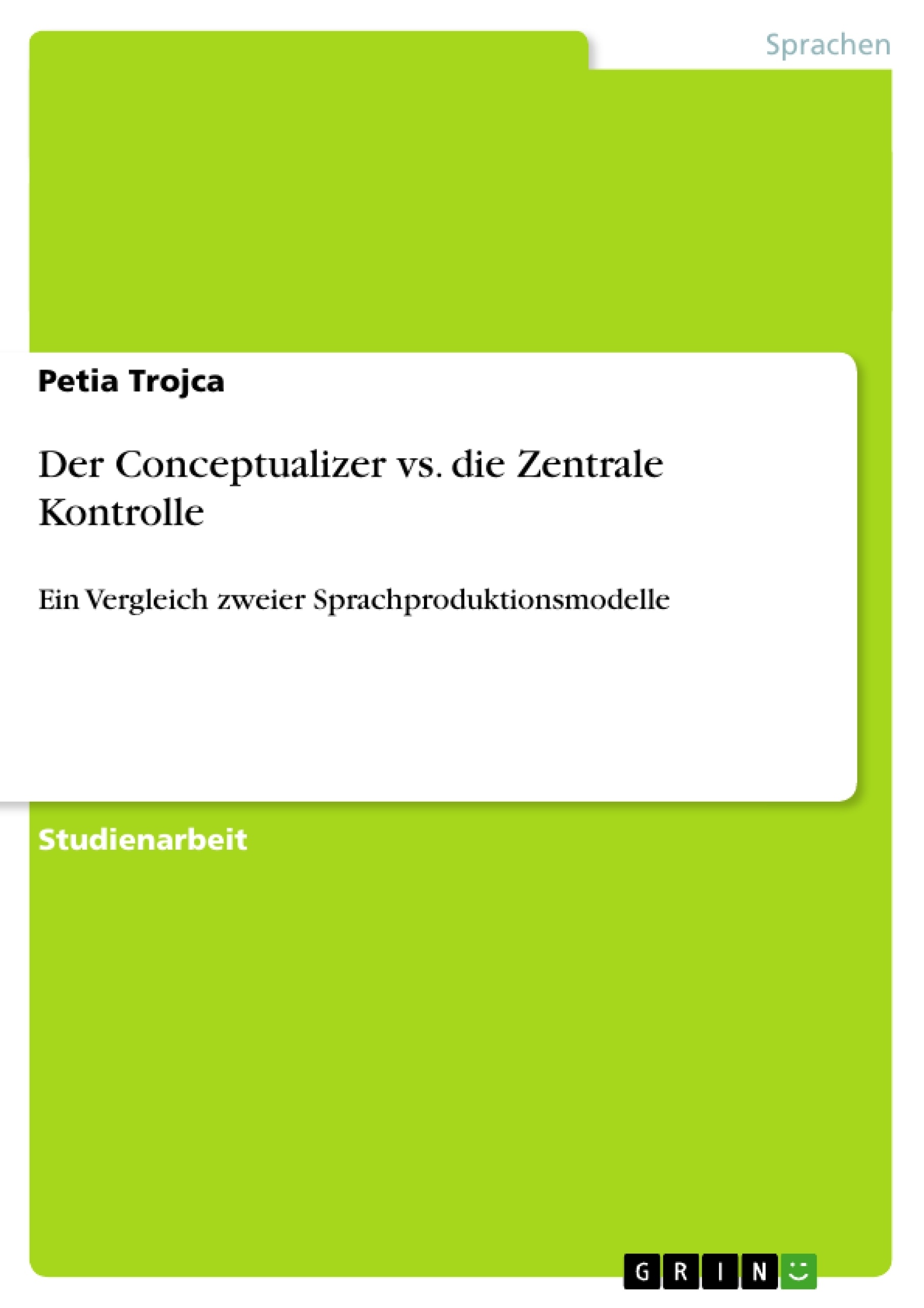Sprachproduktion ist ein Teilgebiet der Psycholinguistik und gilt im Vergleich z.B. zur Sprachrezeption als ein relativ unterentwickeltes Forschungsgebiet. Dies hängt damit zusammen, dass die kognitiven Vorgänge, die bei der Produktion von Sprache eine Rolle spielen, sich experimentell nur schwer erforschen lassen. Sprachliches Planen ist ein mentaler Vorgang und als solcher ist er der direkten Beobachtung nicht zugänglich. Aus diesem Grund stützt sich die Sprachproduktionsforschung auf der Analyse von Versprechern, Aphasien und Pausen beim Sprechen. Dies hat auch zur Folge, dass es verschiedene Meinungen darüber gibt wie genau die einzelnen Teilprozesse auf den unterschiedlichen Ebenen der Sprachproduktion ablaufen.
Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit werde ich zum Zwecke der Vollständigkeit versuchen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der bisher entwickelten Sprachproduktionsmodelle kurz aufzuzeigen, sowie in groben Zügen die einzelnen Ebenen des Sprachproduktionsprozesses darzustellen. Das zweite und dritte Kapitel beschäftigen sich mit dem zentralen Gegenstand dieser Arbeit, der ersten Ebene der Sprachproduktion. Ich werde anhand der konkurrierenden Modelle von Levelt (1989) und Herrmann und Grabowski (1994) die einzelnen Prozesse, die auf dieser Ebene stattfinden beschreiben und werde versuchen die Unterschiede aufzuzeigen, die sich beim Vergleich der beiden Modelltypen ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Modelle der Sprachproduktion
- Die konzeptuelle Ebene im Sprachproduktionsmodell von Levelt
- Makroplanung
- Selektion
- Linearisierung
- Mikroplanung
- Makroplanung
- Die konzeptuelle Ebene in der Mannheimer Regulationstheorie der Sprachproduktion von Herrmann und Grabowski
- Die Zentrale Kontrolle
- Der Fokusspeicher
- Die Zentrale Exekutive
- Selektion der Fokusinformation
- Aufbereitung der Fokusinformation
- Linearisierung der Fokusinformation
- Die Hilfssysteme
- Die Zentrale Kontrolle
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der ersten Ebene der Sprachproduktion, der sogenannten konzeptuellen Ebene, und analysiert zwei konkurrierende Modelle: das von Levelt (1989) und das von Herrmann und Grabowski (1994). Die Arbeit hat zum Ziel, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Modelle zu beleuchten und einen Überblick über die Prozesse zu geben, die auf der konzeptuellen Ebene stattfinden.
- Vergleich von Sprachproduktionsmodellen: Conceptualizer vs. Zentrale Kontrolle
- Analyse der Makroplanung und Mikroplanungsprozesse im Modell von Levelt
- Untersuchung der Zentrale Kontrolle und ihrer Hilfssysteme im Modell von Herrmann und Grabowski
- Zusammenhang von konzeptueller Ebene und Kommunikationssituation
- Die Rolle von Feedback und Monitoring in der Sprachproduktion
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Text stellt Sprachproduktion als ein relativ unterentwickeltes Forschungsgebiet vor und erläutert die Herausforderungen, die sich aus der experimentellen Erforschung der kognitiven Prozesse ergeben. Die Einleitung führt außerdem die beiden zentralen Modelle dieser Arbeit, Levelt (1989) und Herrmann und Grabowski (1994), ein.
- Modelle der Sprachproduktion: Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über verschiedene Sprachproduktionsmodelle und ihre unterschiedlichen Ansätze zur Modellierung der Sprachproduktion. Dabei werden verschiedene Kriterien zur Unterscheidung der Modelle vorgestellt, wie z.B. die Frage nach der Autonomie vs. Kontextsensitivität der Modelle.
- Die konzeptuelle Ebene im Sprachproduktionsmodell von Levelt: Dieses Kapitel befasst sich mit der konzeptuellen Ebene im Modell von Levelt, welches in Makroplanung und Mikroplanung unterteilt ist. Die beiden Teilprozesse werden im Detail vorgestellt und analysiert.
- Die konzeptuelle Ebene in der Mannheimer Regulationstheorie der Sprachproduktion von Herrmann und Grabowski: Der vierte Abschnitt präsentiert die konzeptuelle Ebene im Modell von Herrmann und Grabowski. Hierbei liegt der Fokus auf der Zentrale Kontrolle mit ihren Bestandteilen Fokusspeicher und Zentrale Exekutive. Die Hilfssysteme des Modells werden ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf Sprachproduktion, Sprachmodelle, Conceptualizer, Zentrale Kontrolle, Makroplanung, Mikroplanung, Selektion, Linearisierung, Fokusinformation, Kommunikationssituation, Feedback, Monitoring, Levelt, Herrmann, Grabowski.
- Quote paper
- Petia Trojca (Author), 2007, Der Conceptualizer vs. die Zentrale Kontrolle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87223