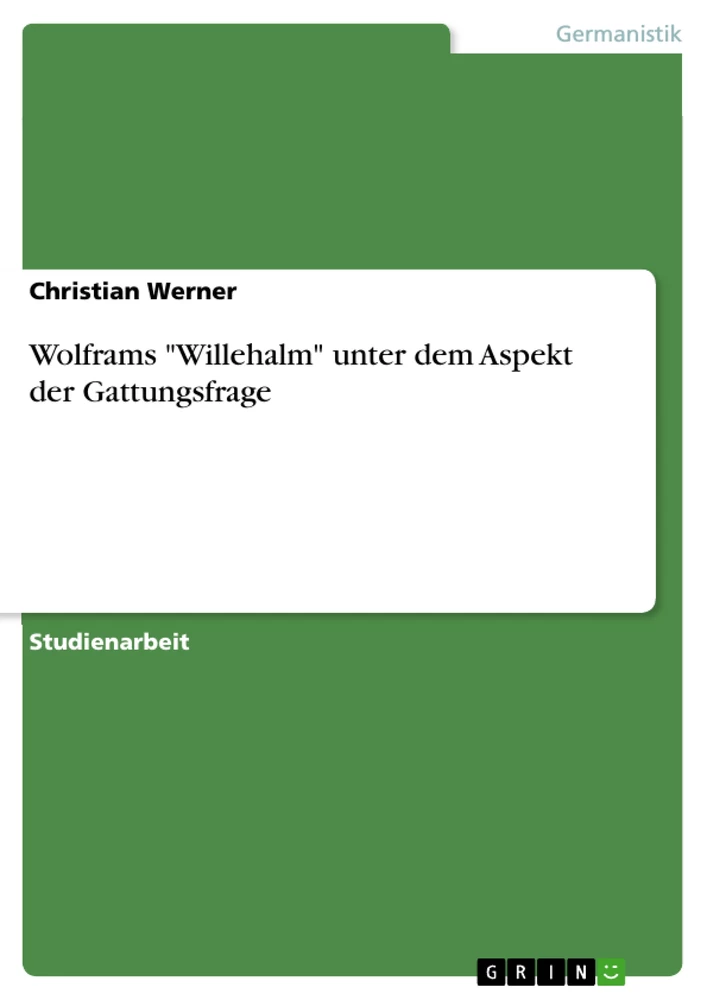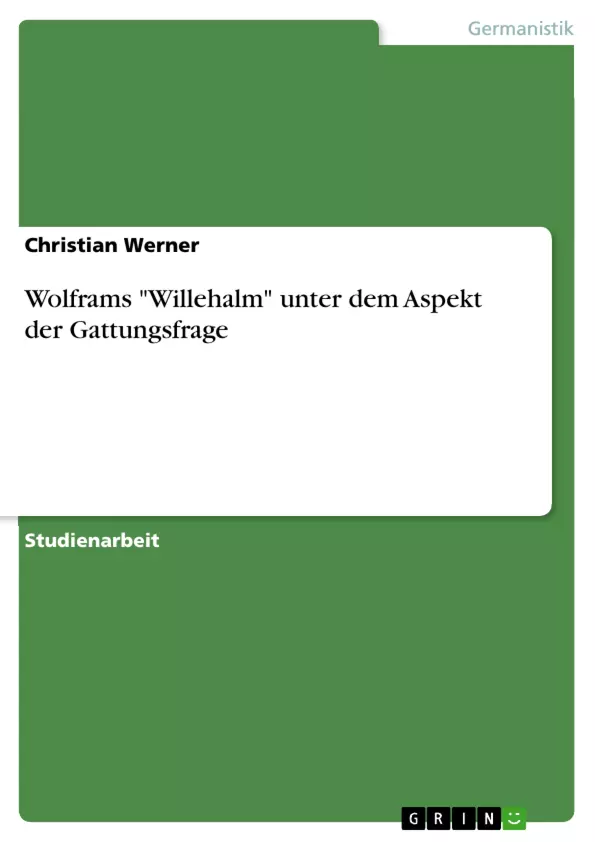Nicht immer hat die Wolfram-Forschung dem Willehalm so viel Beachtung geschenkt, wie es heute der Fall ist. Erst in den letzten Jahrzehnten hat sich die Auseinandersetzung mit diesem Text zu einem Thema des Mainstreams altgermanistischer Forschung entwickelt. Dies ist wohl nicht zuletzt auf die mannigfaltigen Schwierigkeiten, die sich dem Willehalm-Interpreten bieten, zurückzuführen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere der fragmentarische Charakter der Dichtung und das damit einhergehende offene Ende hervorzuheben, welcher Deutungsversuche hinsichtlich der ungeklärten Gattungsfrage erschwert. Infolge der Gattungsdiskussion haben sich mit der Zeit unterschiedliche Standpunkte herauskristallisiert. Bis heute wird häufig die Meinung vertreten, dass der Willehalm als Legende zu lesen sei. Ein entschiedener Verfechter dieser Sichtweise ist Friedrich Ohly, dessen Interpretation sich hauptsächlich auf das initiale Gebet an den Heiligen Geist (1,1-5,14) beruft. Diesem Ansatz folgend hat in jüngerer Zeit auch Franziska Wessel-Fleinghaus eine umfangreiche Interpretation des Wolfram’schen Textes vorgelegt, welchen sie aufgrund des innovativen Umgangs des Dichters mit der theologischenKernproblematik als Problemlegende qualifiziert. Demgegenüber sieht Werner Schröder im Willehalm einen „tragischen Roman“; seine Argumentation stützt sich dabei auf den Versuch
des Dichters, den ursprünglich im Umkreis der chanson de geste angesiedelten Aliscans-Stoff in romanesker Manier zu überformen. Schließlich hat es auch nicht an Versuchen gefehlt, das Werk in die Tradition der Heldenepik respektive der französischen chanson de geste zu verorten. Hierfür plädiert besonders dezidiert Walter Haug4, der den heldenepischen Duktus der Dichtung herausstellt, der mit einer verneinten höfischen aventiure-Welt kontrastiert.
Inhaltsverzeichnis
- Die Forschungslage zur Gattungsfrage
- Mittelalterliches Gattungsbewusstsein
- Aspekte der Legende im Willehalm
- Aspekte der Chanson de geste im Willehalm
- Aspekte des Höfischen Romans im Willehalm
- Schlussgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text analysiert Wolframs von Eschenbachs Willehalm unter dem Aspekt der Gattungsfrage. Die Arbeit erörtert die Herausforderungen, die sich aus der fragmentarischen Natur des Textes und dem offenen Ende ergeben, und untersucht die unterschiedlichen Interpretationsansätze zur Gattungszuordnung. Die Arbeit beleuchtet die historischen Bezüge zu verschiedenen Gattungen wie Legende, Chanson de geste und höfischer Roman und analysiert die Integration von Elementen dieser Gattungen im Willehalm.
- Die Forschungsgeschichte zur Gattungsfrage des Willehalm
- Das mittelalterliche Gattungsbewusstsein und die Klassifikation literarischer Werke
- Die Integration von Elementen der Legende, der Chanson de geste und des höfischen Romans im Willehalm
- Wolframs bewusster Umgang mit Gattungsnormen und seine innovative Textgestaltung
- Die Frage nach Wolframs Intention, sein Werk innerhalb einer bestimmten Gattung zu konzipieren
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen des Willehalm im Hinblick auf die Gattungsfrage und die sich daraus ergebenden Debatten in der Forschung. Es werden verschiedene Positionen vorgestellt, darunter die Einordnung des Werkes als Legende, tragischer Roman und höfische Epik. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Gattungsverständnis im Mittelalter und untersucht die Frage, ob sich eine klare und eindeutige Gattungszuordnung im Kontext der damaligen Zeit überhaupt erreichen lässt.
Schlüsselwörter
Willehalm, Wolfram von Eschenbach, Gattungsfrage, Legende, Chanson de geste, Höfischer Roman, Mittelalterliches Gattungsbewusstsein, Gattungsdiskussion, Gattungsverständnis, Opus mixtum, Fragmentarität, Offenes Ende, Gattungsindizierende Merkmale.
Häufig gestellte Fragen
Welcher Gattung lässt sich Wolframs „Willehalm“ zuordnen?
Die Gattungsfrage ist umstritten; diskutiert werden Einordnungen als Legende, Chanson de geste, höfischer Roman oder tragischer Roman.
Warum ist die Gattungsbestimmung beim „Willehalm“ so schwierig?
Die Schwierigkeit resultiert vor allem aus dem fragmentarischen Charakter der Dichtung und dem damit einhergehenden offenen Ende.
Was versteht man unter einem „Opus mixtum“ in diesem Kontext?
Es beschreibt Wolframs innovative Textgestaltung, bei der er bewusst Elemente verschiedener Gattungen kombiniert und mit Gattungsnormen spielt.
Welche Position vertritt Friedrich Ohly zur Gattungsfrage?
Ohly plädiert dafür, den Willehalm als Legende zu lesen, wobei er sich primär auf das initiale Gebet an den Heiligen Geist stützt.
Wie unterscheidet sich das mittelalterliche vom modernen Gattungsbewusstsein?
Die Arbeit untersucht, ob im Mittelalter überhaupt klare Gattungsklassifikationen existierten oder ob die Grenzen fließender waren als heute angenommen.
- Quote paper
- Christian Werner (Author), 2007, Wolframs "Willehalm" unter dem Aspekt der Gattungsfrage, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87222