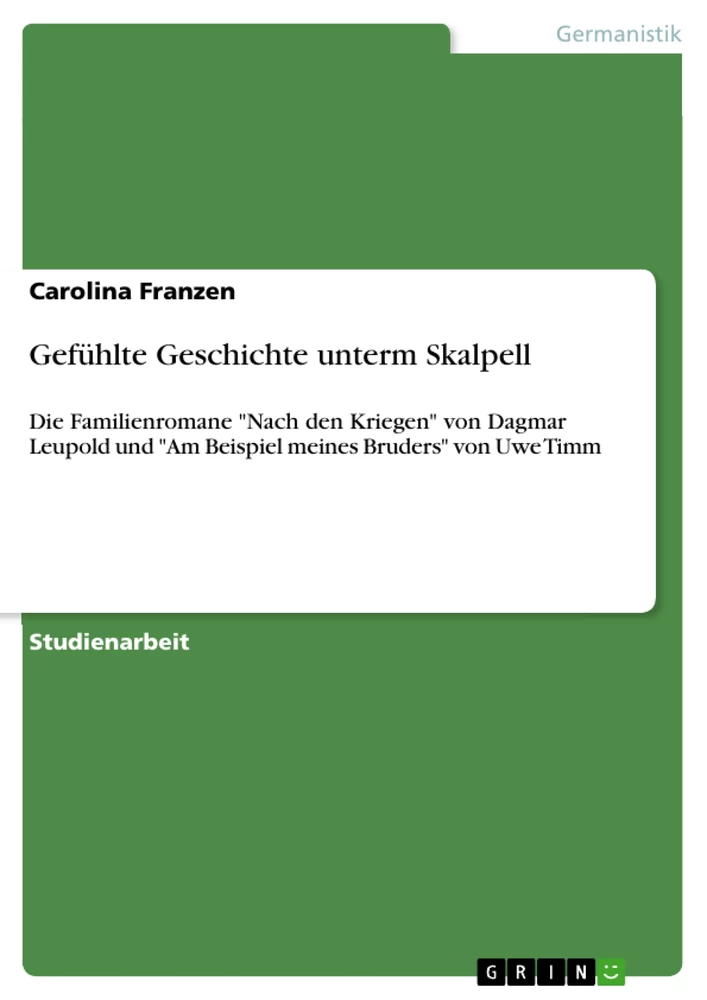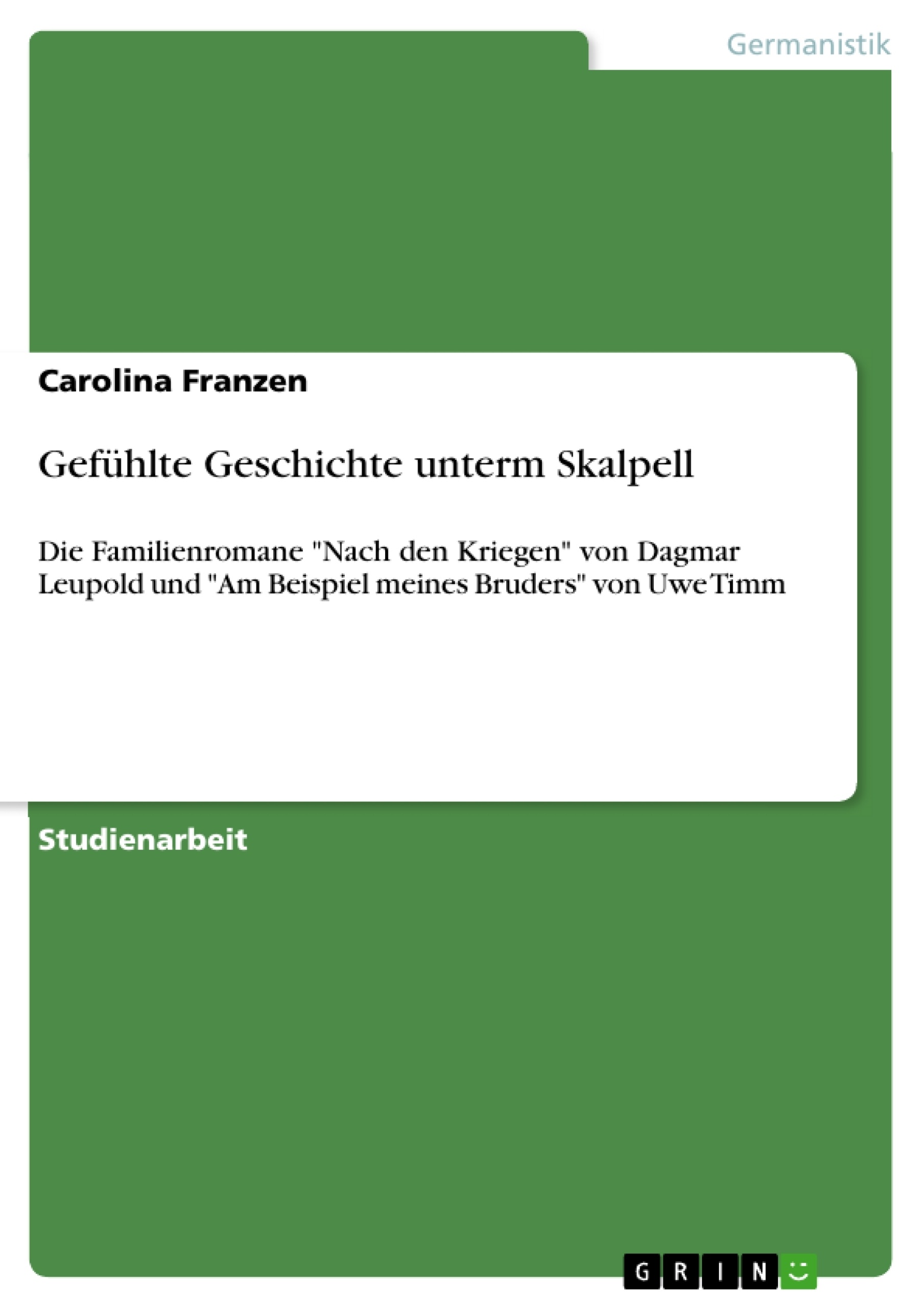Der vorliegende Aufsatz zeigt an zwei Familienromanen, Uwe Timms "Am Beispiel meines Bruders" (2003)und Dagmar Leupolds "Nach den Kriegen" (2004), wie kritisch und distanziert zeitgenössische Autoren mit den Wünschen nach Genealogie und den damit aufkommenden Problemen umgehen. Analysiert wird die den Werken immanente Sicht der Autoren auf die eigene Familie und der Diskurs über Täter und Täterschaft im dritten Reich.
Inhaltsverzeichnis
- Deutsche Reflexion.
- Gefühlte Geschichte erkennen
- Der Krieg nach den Kriegen
- Belebende Tode......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz analysiert zwei Familienromane, Uwe Timms "Am Beispiel meines Bruders" und Dagmar Leupolds "Nach den Kriegen", um zu zeigen, wie Autoren kritisch mit dem Wunsch nach Genealogie und den damit verbundenen Problemen umgehen. Der Fokus liegt dabei auf der differenzierten Sicht der Autoren auf ihre Familien und deren Beitrag zum Diskurs über Täter und Täterschaft.
- Die "gefühlte Geschichte" der Deutschen und deren Einfluss auf die Familienromane
- Die Rolle der Tätergeneration in der Literatur
- Die Ambivalenz und der psychologische Selbstbetrug von Täterfiguren in den Romanen
- Die Bedeutung von Literatur als Geschichtsschreibung
- Das Missverhältnis zwischen dem Wunsch nach Genealogie und der Wahrheit über den eigenen Vater
Zusammenfassung der Kapitel
Deutsche Reflexion.
Der Essay beginnt mit einer Analyse der Reflexionsdebatte in Deutschland im Kontext der Fußball-WM 2006. Die Diskussion um Nationalismus und die Suche nach einer Identität führten dazu, dass jeder Deutscher über seine eigene Beziehung zur Nation reflektieren musste. Der Aufsatz stellt fest, dass sich auch in der Literatur die Perspektive auf den Nationalsozialismus und die Kriegsgeneration gewandelt hat. Familienromane wie "Am Beispiel meines Bruders" von Uwe Timm und "Nach den Kriegen" von Dagmar Leupold versuchen, die Handlungen und Entscheidungen der Kriegsgeneration zu reflektieren und zu analysieren, anstatt sie zu verurteilen.
Gefühlte Geschichte erkennen
Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Konzept der "gefühlten Geschichte", wie es Harald Welzer in seinen Analysen der Familienromane beschreibt. Welzer argumentiert, dass diese Romane die private Erinnerung der Familien in den Vordergrund stellen, die vom Leiden der Angehörigen im Krieg, vom Überleben in schlechten Zeiten und von der persönlichen Integrität geprägt ist. Der Essay argumentiert, dass Welzers These zwar psychologisch plausibel ist, jedoch den gesamten literarischen Diskurs übermalt. Es gibt Autoren, die sich nicht nur mit der "gefühlten Geschichte" auseinandersetzen, sondern auch die Tätergeneration kritisch beleuchten und ein differenziertes Bild ihrer Handlungen zeichnen.
Der Krieg nach den Kriegen
Das Kapitel analysiert Dagmar Leupolds Roman "Nach den Kriegen" und zeigt auf, wie Leupold das Missverhältnis zwischen dem Wunsch nach Genealogie und der Wahrheit über den eigenen Vater darstellt. Der Vater, ein bilingualer und mathematisch hochbegabter Mann, wollte seine Vergangenheit verschleiern, indem er einen Stempel mit einer institutionellen Absegnung seiner Lebensgeschichte anfertigen ließ. Die symbolische Bedeutung des Stempels wird im Kontext der "gefühlten Geschichte" analysiert, die die Wunschvorstellungen und die Realität der Familie auseinanderdrängt.
Schlüsselwörter
Familienromane, Deutsche Reflexion, "gefühlte Geschichte", Täter und Täterschaft, Kriegsgeneration, Genealogie, Ambivalenz, psychologische Selbstbetrug, Literatur als Geschichtsschreibung, Dagmar Leupold, Uwe Timm, Harald Welzer.
- Quote paper
- Carolina Franzen (Author), 2007, Gefühlte Geschichte unterm Skalpell, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87135