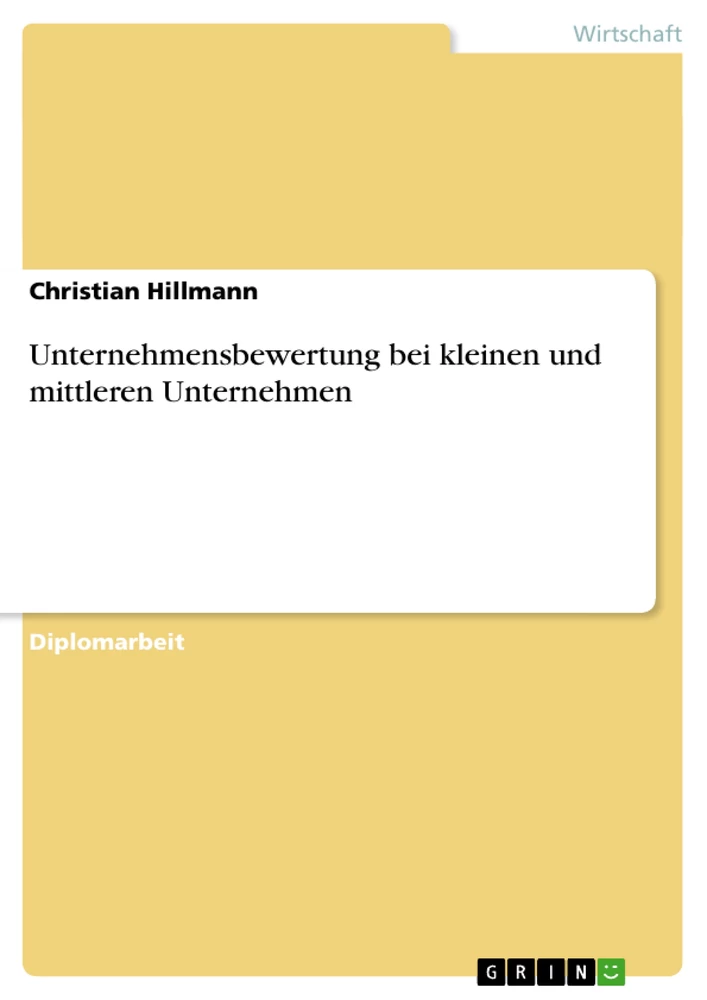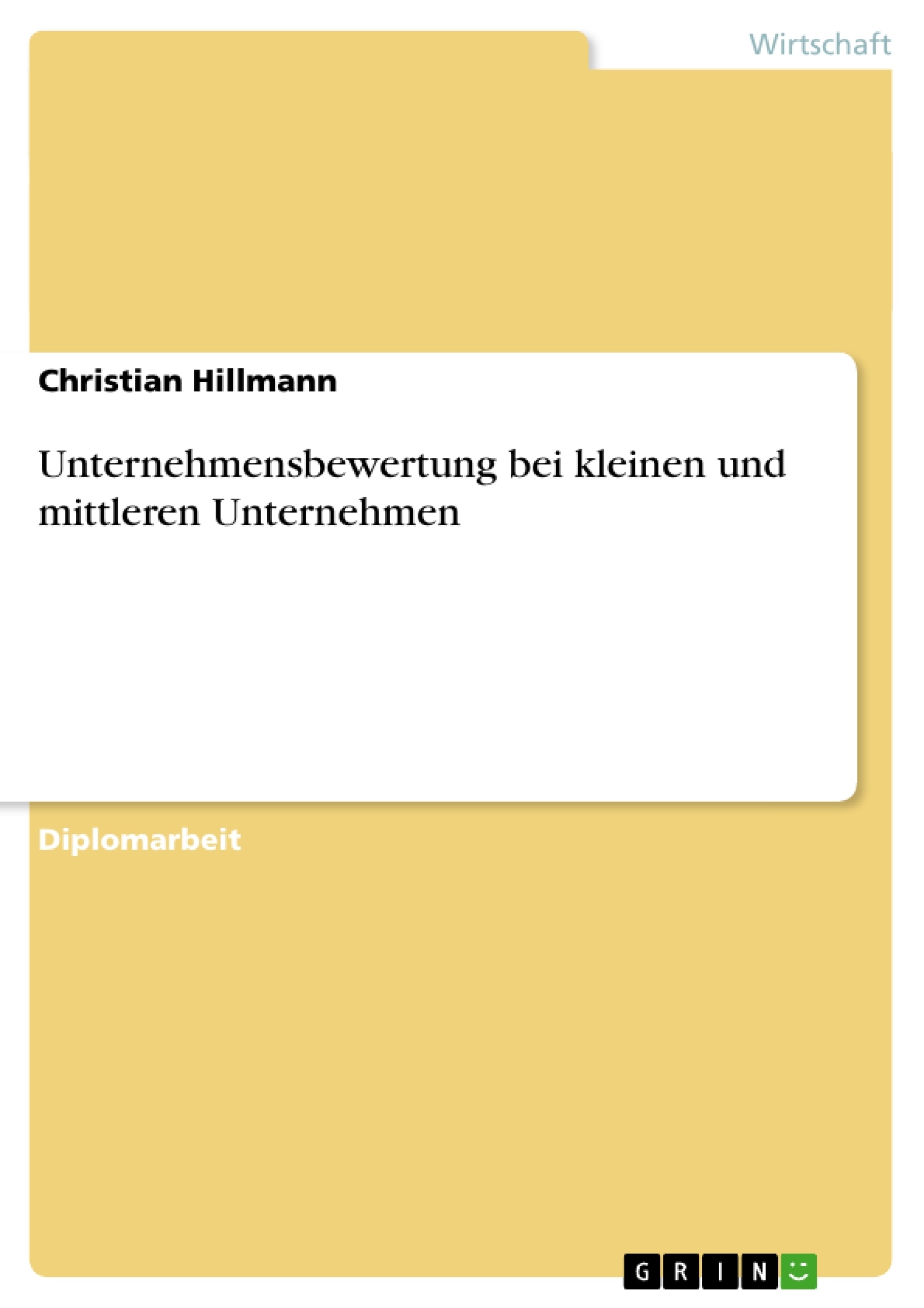Einer Studie des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn zufolge, stehen in Deutschland aktuell mehr als 70.000 übergabereife Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens 50.000 Euro mit insgesamt annähernd 700.000 Mitarbeitern vor der Frage einer Unternehmensnachfolge.1 Auf diesen Umstand wies ebenfalls Peemöller hin und nennt hier ca. 76.000 Unternehmen mit annähernd 1 Million Arbeitnehmern.2
Betroffen hiervon sind in der überwiegenden Mehrzahl kleine und mittlere Unternehmen.
Das IfM Bonn geht ferner davon aus, dass aufgrund der ungelösten Nachfolgefrage die jährlichen Betriebsschließungen signifikant steigen werden und Unternehmen aufgrund der Nachfolge deutlich verstärkt veräußert werden, statt diese familienintern zu übergeben.3 In Anbetracht der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der Entwicklung dieser Gruppe, nicht nur für Wirtschaft, sondern auch für Politik, gewinnt die Ermittlung eines angemessenen Unternehmenswertes als Entscheidungsgrundlage in einem Verhandlungsprozess zunehmend an Relevanz.
Die in der Bewertungsliteratur üblichen Bewertungsverfahren konzentrieren sich auf große, börsennotierte Unternehmen und vernachlässigen die bei der Bewertung aufgrund der Besonderheiten von Klein- und Mittelbetrieben erforderlichen spezifischen Behandlungsweisen.4 Im Widerspruch dazu wird in der Praxis auf sehr vereinfachende Verfahren zur Preisfindung für Unternehmen mit Abstand am häufigsten zurückgegriffen. 5 Im Hinblick auf die quantitativ herausgehobene Stellung von KMU in der Unternehmensstruktur Deutschlands, erscheint es nicht nachvollziehbar, dass diese Problematik in der betriebswirtschaftlichen Literatur bisher weitestgehend vernachlässigt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung der Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- Kennzeichen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
- Quantitative Abgrenzung von KMU
- Qualitative Abgrenzung von KMU
- Arbeitsdefinition KMU
- Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung von KMU
- Grundlagen der Unternehmensbewertung
- Wert und Preis eines Unternehmens
- Objektive Werttheorie
- Subjektive Werttheorie
- Funktionale Werttheorien
- Hauptfunktionen und ihre Wertarten
- Beratungsfunktion
- Vermittlungsfunktion
- Argumentationsfunktion
- Nebenfunktionen und ihre Wertarten
- Mischverfahren
- Funktionslehre des IDW
- Bewertungsanlässe
- Dominierte Bewertungsanlässe
- Nicht dominierte Bewertungsanlässe
- Prozess der Unternehmensbewertung
- Informationsbeschaffung
- Vergangenheitsanalyse
- Analyse des wettbewerblichen Umfelds
- Prognose der Zukunftswerte
- Plausibilitätsbeurteilung
- Bewertungsgutachten
- Abgrenzung zu Due Diligence
- Gesamtbewertungsverfahren
- Ertragswert- und DCF Verfahren
- Market Approach (Vergleichsverfahren)
- Comparative-Company-Approach
- Market Multiples
- Einzelbewertungsverfahren
- Substanzwertverfahren auf Basis von Rekonstruktions-werten
- Substanzwertverfahren auf Basis von Liquidationswerten
- Bewertungszwecke und Bewertungsverfahren
- Die Wahl des Bewertungsverfahrens in der Praxis
- Ertragswertverfahren
- Abgrenzung der Erfolgsgrößen
- Ermittlung der Erfolgsgrößen
- Bestimmung des Kapitalisierungszinssatzes
- Basiszinssatz
- Berücksichtigung des Risikos
- Betafaktor
- Marktrisikoprämie
- Berücksichtigung der Ertragssteuern
- Berücksichtigung von Inflation und Wachstum
- Anwendungsbeispiel der Ertragswertsmethode
- Kapitalisierungszinssatz bei subjektiver Unternehmensbewertung
- DCF-Verfahren
- Unterscheidung der DCF-Ansätze
- Entity-Ansätze
- Weighted Average Cost of Capital-Ansatz (WACC-Ansatz)
- Adjusted Present Value-Ansatz (APV-Ansatz)
- Equity-Ansatz
- Bestimmung der bewertungsrelevanten Cash-Flows
- Ermittlung der Kapitalkosten
- Ermittlung der Fremdkapitalkosten
- Ermittlung der Eigenkapitalkosten
- Basiszinssatz
- Berücksichtigung des Risikos
- Berücksichtigung von Inflation und Wachstum
- Berücksichtigung von Steuern
- Ewige Rente
- Gegenüberstellung Ertragswert- und DCF-Verfahren
- Anwendbarkeit verschiedener Bewertungsverfahren
- Fallbeispiel
- Unternehmensanalyse
- Planung und Prognose der Cash-Flows
- Bestimmung der Diskontierungsfaktoren
- DCF-Bewertung
- Betrachtung der Ergebnisse
- Schlussbetrachtung
- Charakterisierung von KMU und deren Bedeutung für die Wirtschaft
- Grundlagen der Unternehmensbewertung und deren theoretische Ansätze
- Analyse verschiedener Bewertungsverfahren, insbesondere Ertragswert- und DCF-Methoden
- Praktische Anwendung der Bewertungsmethoden anhand eines Fallbeispiels
- Diskussion der Herausforderungen und Grenzen der Unternehmensbewertung im Kontext von KMU
- Einleitung: Das Kapitel führt in das Thema der Diplomarbeit ein, beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit.
- Kennzeichen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU): Dieses Kapitel definiert den Begriff "KMU" und analysiert die quantitative und qualitative Abgrenzung von KMU. Weiterhin wird die gesamtwirtschaftliche Bedeutung von KMU beleuchtet.
- Grundlagen der Unternehmensbewertung: In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Unternehmensbewertung erläutert, wobei verschiedene Werttheorien und deren Anwendung vorgestellt werden.
- Gesamtbewertungsverfahren: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Gesamtbewertungsverfahren, insbesondere die Ertragswert- und DCF-Methoden, und erläutert deren Einsatzmöglichkeiten und -grenzen.
- Die Wahl des Bewertungsverfahrens in der Praxis: Dieses Kapitel diskutiert die Auswahl des geeigneten Bewertungsverfahrens für KMU und berücksichtigt die Besonderheiten der Unternehmensstruktur und der Bewertungsanlässe.
- Ertragswertverfahren: Das Kapitel fokussiert auf die Anwendung des Ertragswertverfahrens und erläutert die Ermittlung der Erfolgsgrößen, die Bestimmung des Kapitalisierungszinssatzes und die praktische Anwendung der Methode.
- DCF-Verfahren: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Discounted Cash Flow-Verfahren, stellt verschiedene Ansätze und Methoden vor und diskutiert die Ermittlung der bewertungsrelevanten Cash-Flows sowie der Kapitalkosten.
- Gegenüberstellung Ertragswert- und DCF-Verfahren: Die Kapitel stellt die Vor- und Nachteile der Ertragswert- und DCF-Methoden gegenüber und diskutiert deren Einsatzmöglichkeiten und -grenzen im Kontext von KMU.
- Fallbeispiel: Dieses Kapitel zeigt die praktische Anwendung der Bewertungsmethoden anhand eines konkreten Unternehmensbeispiels.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Unternehmensbewertung im Kontext kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Ziel der Arbeit ist es, eine umfassende Analyse verschiedener Bewertungsverfahren und deren Anwendung in der Praxis zu liefern. Dabei liegt der Fokus auf der Ermittlung des Unternehmenswerts aus der Sicht eines potenziellen Investors.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit behandelt zentrale Themen der Unternehmensbewertung im Kontext kleiner und mittlerer Unternehmen. Relevante Schlüsselwörter sind unter anderem: Unternehmensbewertung, KMU, Ertragswertverfahren, DCF-Verfahren, Kapitalisierungszinssatz, Cash-Flow-Prognose, Bewertungsanlässe, Bewertungszwecke, Risikobetrachtung, Due Diligence.
- Citar trabajo
- Christian Hillmann (Autor), 2007, Unternehmensbewertung bei kleinen und mittleren Unternehmen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87001