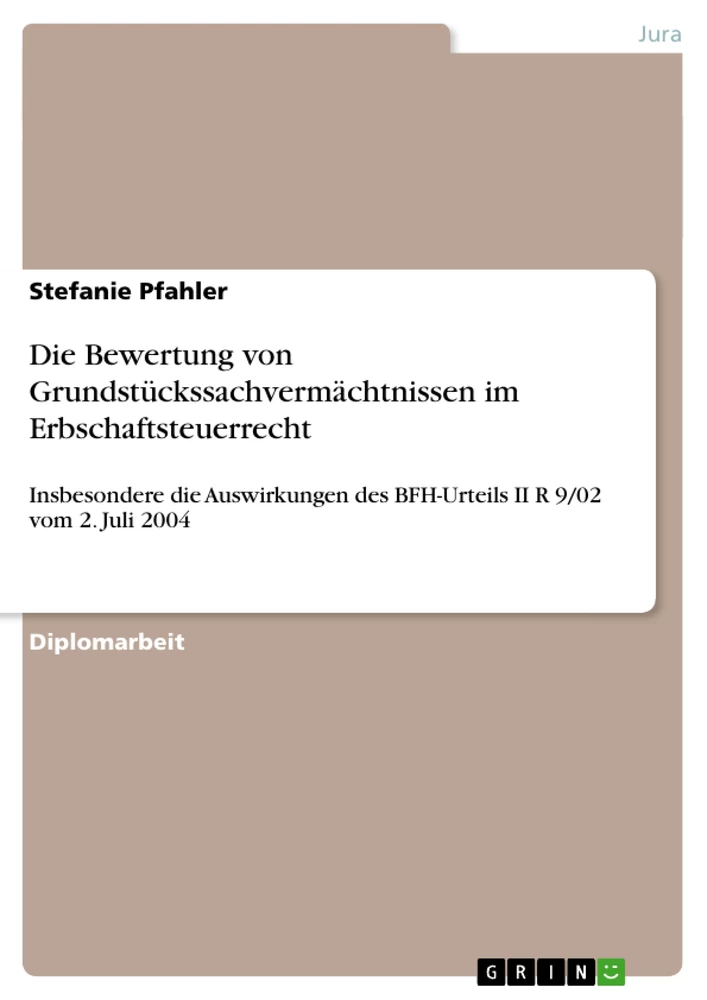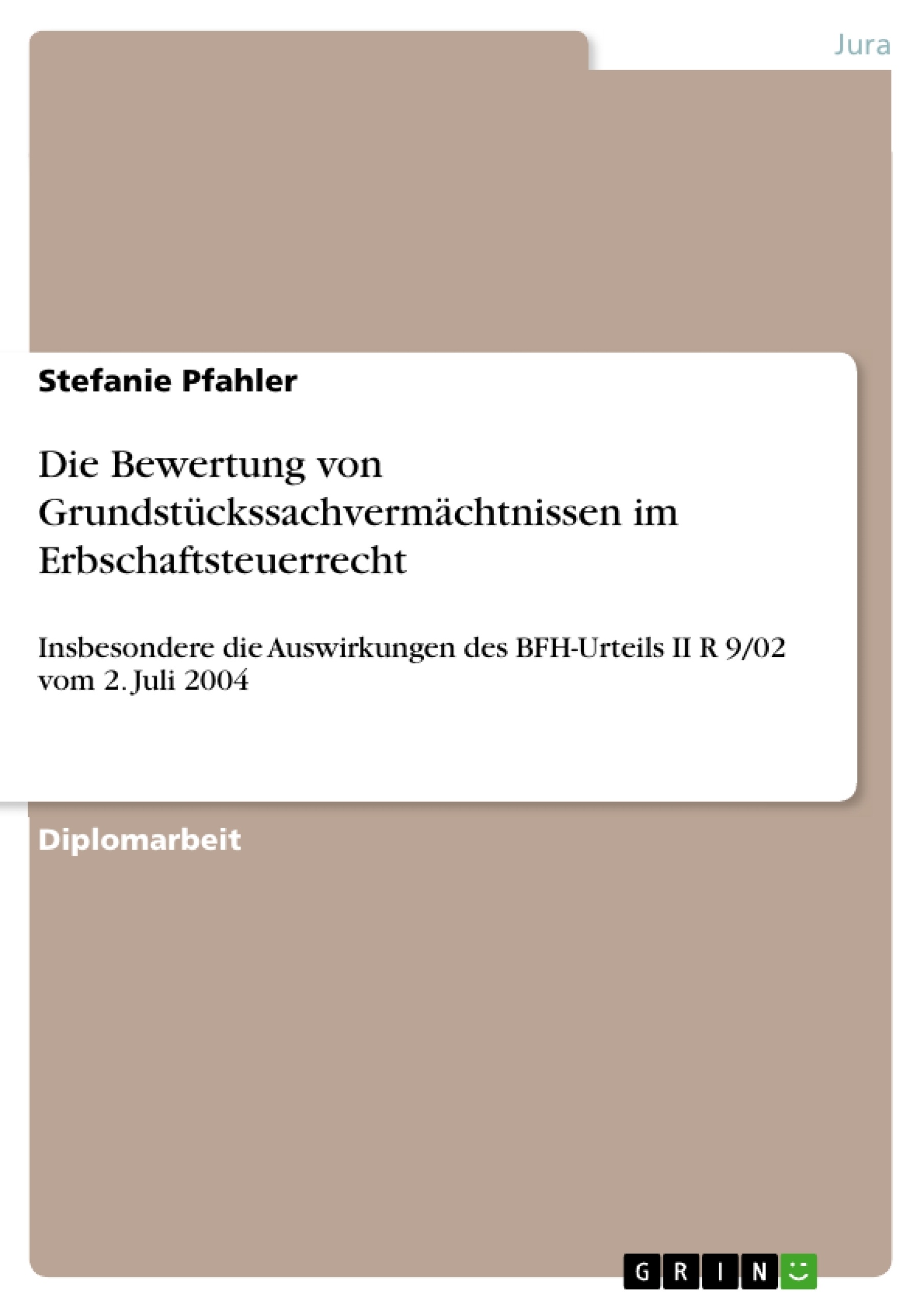Die erbschaftsteuerliche Übertragung von Grundstücken wurde in der Vergangenheit und wird auch bisher noch privilegiert, was sich insbesondere durch einen günstigen Bewertungsansatz ausdrückt. Grundstücksvermächtnisse stellen dabei ein beliebtes Gestaltungsmittel dar, um einzelne Grundstücke an bestimmte Personen insbesondere Nichtfamilienmitgliedern zu übertragen, oder um eine Erbengemeinschaft zu vermeiden.
Bislang galt die privilegierende Bewertung von Grundstücken auch für Grundstücksvermächtnisse. Der BFH hat in einem obiter dictum angekündigt, dass er seine Rechtsprechung hinsichtlich der Bewertung von Grundstücksvermächtnissen ändern will. Dies hätte zur Folge, dass eine Vielzahl von Testamentsgestaltungen mit Vermächtnissen überdacht und gegebenenfalls geändert und angepasst werden müsste.
Grundlage dieser Arbeit bilden die unterschiedlichen Bewertungsmöglichkeiten von Grundvermögen und deren Wirkungsweise. Ziel dieser Arbeit ist es, die Problematik, die durch die angekündigte Rechtsprechungsänderung entsteht, aufzuzeigen. Dabei soll dargelegt werden, wie es zu einer Privilegierung von Grundstücksvermächtnissen kam, wie diese gegebenenfalls gerechtfertigt werden kann und inwiefern sie auch in Zukunft noch haltbar sein wird.
Inhaltsverzeichnis
- § 1 Einführung
- A. Problemstellung
- B. Ziel der Arbeit
- C. Aufbau der Arbeit
- § 2 Der Begriff des Vermächtnisses im Erbrecht
- A. Die Vermächtnisanordnung
- B. Der Vermächtnisanspruch
- I. Schuldrechtlicher Anspruch
- II. Bedachter und Beschwerter
- III. Anfall, Fälligkeit und Erfüllung des Anspruchs
- C. Der Vermächtnisgegenstand
- D. Zusammenfassung
- § 3 Das Vermächtnis im Erbschaftsteuerrecht
- A. Ansatz des Vermächtnisses
- I. Ansatz beim Vermächtnisnehmer
- II. Ansatz beim Beschwerten
- III. Zusammenfassung
- B. Bewertung von Grundstückssachvermächtnissen
- I. Bewertungsstichtag
- II. Bewertung von einseitigen Sachleistungsansprüchen
- III. Bewertung mit dem Grundbesitzwert
- 1. Ursprüngliche Einheitswertbewertung
- 2. Begriff des Grundbesitzwerts
- 3. Ermittlung des Grundbesitzwerts für Grundstücke
- a) Unbebaute Grundstücke
- b) Bebaute Grundstücke
- aa) Bewertung nach § 146 BewG
- bb) Bewertung nach § 147 BewG
- 4. Kritik an den Bewertungsverfahren
- a) Unbebaute Grundstücke
- b) Bebaute Grundstücke
- c) Unterschiedliche Bewertung innerhalb des Grundbesitzes
- 5. Kritik am Bewertungsmaßstab: Ertragswert versus gemeiner Wert
- a) Der Begriff des „gemeinen Werts“
- b) Zusammenhang zwischen gemeinem Wert, Verkehrswert und Ertragswert
- c) Natur der Erbschaftsteuer
- d) Gemeiner Wert oder Ertragswert als Bemessungsgrundlage
- aa) Unterscheidung nach dem Gesetzeszweck
- bb) Unterscheidung nach dem Besteuerungsanlass
- cc) Besonderheiten des Grundvermögens
- dd) Ergebnis
- 6. Verfassungrechtliche Gesichtspunkte der Ertragswertbewertung
- aa) Eigentumsfreiheit
- bb) Gleichheitssatz
- cc) Ergebnis
- C. Neuere Tendenzen der Rechtsprechung in der Bewertung von Grundstückssachvermächtnissen
- I. Die Rechtsprechung des BFH zu Sachleistungsansprüchen
- II. Obiter dictum des Urteils des BFH vom 02.07.2004
- III. Direkte Auswirkung auf Vermächtnisnehmer und Beschwerten
- IV. Kritik am Obiter dictum des BFH
- 1. Unleichbehandlung von Erbe und Vermächtnisnehmer
- a) Anknüpfung an das Zivilrecht
- b) Neutralität der Erbschaftsteuer
- c) Bereicherungs- und Leistungsfähigkeitsprinzip
- d) Korrespondenzprinzip
- 2. Zusammenfassung
- 3. Teilweise Steuerbefreiung
- a) Gründe vor 1996
- b) Unterbewertung als teilweise Steuerbefreiung
- aa) Unterbewertung von unbebauten Grundstücken
- bb) Unterbewertung von bebauten Grundstücken
- cc) Anwendbarkeit von § 10 Abs. 6 ErbstG auf Unterbewertungen
- dd) Zusammenfassung
- c) Wirtschaftlicher Zusammenhang
- d) Widerspruch zur Rechtsprechung
- e) Ergebnis
- 4. Weitere Gesichtspunkte
- a) „Durch“ und „aufgrund“
- b) Das Grundstückssachvermächtnis als zu bewertender einseitiger Sachleistungsanspruch
- 5. Ergebnis
- 1. Unleichbehandlung von Erbe und Vermächtnisnehmer
- V. Auswirkungen auf die Praxis
- 1. Auswirkungen auf Grundstückssachvermächtnisse: Gestaltungsmodelle
- a) Rollentausch-Modell
- b) Auflagen-Modell
- c) Miterben-Modell
- d) Ausschlagungs-Modell
- e) Schenkung
- f) Ergebnis
- 2. Auswirkung auf Abfindungs-Leistungen
- 3. Auswirkungen auf sonstige einseitige Sachleistungsansprüche
- a) Auswirkung auf Sachschenkungversprechen
- b) Ergebnis
- 1. Auswirkungen auf Grundstückssachvermächtnisse: Gestaltungsmodelle
- D. Auswirkung aktueller Gesetzesvorhaben
- I. Auswirkungen des Jahressteuergesetzes 2007
- 1. Tatsächliche Wertverhältnisse
- a) Änderung
- b) Auswirkung
- 2. Bewertung bebauter Grundstücke
- a) Änderung
- b) Auswirkung
- 3. Wegfall der ausdrücklichen Typisierung
- a) Änderung
- b) Auswirkung
- 1. Tatsächliche Wertverhältnisse
- II. Auswirkungen des Gesetzes zur Erleichterung der Unternehmensnachfolge
- 1. Änderung
- 2. Auswirkung
- I. Auswirkungen des Jahressteuergesetzes 2007
- § 4 Schlussbetrachtung
- A. Ansatz des Vermächtnisses
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bewertung von Grundstückssachvermächtnissen im Erbschaftsteuerrecht, insbesondere die Auswirkungen des BFH-Urteils II R 9/02 vom 2. Juli 2004. Ziel ist es, die verschiedenen Bewertungsmethoden und ihre rechtlichen Grundlagen zu analysieren und die praktische Relevanz der Rechtsprechung aufzuzeigen.
- Bewertung von Grundstückssachvermächtnissen im Erbschaftsteuerrecht
- Auswirkungen des BFH-Urteils II R 9/02 vom 2. Juli 2004
- Vergleich verschiedener Bewertungsmethoden (Ertragswert, gemeiner Wert)
- Verfassungsrechtliche Aspekte der Bewertung
- Gestaltungsmöglichkeiten für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
§ 1 Einführung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein, beschreibt die Problemstellung der Bewertung von Grundstückssachvermächtnissen und benennt das Ziel der Arbeit, nämlich die Analyse der Rechtslage und der praktischen Auswirkungen des BFH-Urteils. Der Aufbau der Arbeit wird skizziert, um dem Leser eine Orientierung zu bieten.
§ 2 Der Begriff des Vermächtnisses im Erbrecht: Dieses Kapitel legt die erbrechtlichen Grundlagen für die spätere steuerrechtliche Betrachtung dar. Es definiert den Begriff des Vermächtnisses, beschreibt die Vermächtnisanordnung und den Vermächtnisanspruch, differenziert zwischen Schuldrechtlichem Anspruch und den beteiligten Parteien (Bedachter und Beschwerter) und erläutert den Anfall, die Fälligkeit und die Erfüllung des Anspruchs. Der Vermächtnisgegenstand wird definiert und das Kapitel endet mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Punkte.
§ 3 Das Vermächtnis im Erbschaftsteuerrecht: Dieses zentrale Kapitel behandelt die steuerrechtliche Bewertung von Grundstückssachvermächtnissen. Es untersucht den Ansatz des Vermächtnisses beim Vermächtnisnehmer und beim Beschwerten, beleuchtet verschiedene Bewertungsstichtage und Methoden, wie die Bewertung mit dem Grundbesitzwert, einschließlich der Kritik an den Bewertungsverfahren nach § 146 und § 147 BewG. Der Vergleich zwischen Ertragswert und gemeinem Wert als Bemessungsgrundlage wird ausführlich diskutiert, ebenso wie verfassungsrechtliche Gesichtspunkte wie Eigentumsfreiheit und Gleichheitssatz. Die Rechtsprechung des BFH, insbesondere das Urteil vom 02.07.2004, wird kritisch analysiert, inklusive der Auswirkungen auf die Praxis und Gestaltungsmöglichkeiten wie Rollentausch-, Auflagen-, Miterben- und Ausschlagungsmodelle. Die Auswirkungen aktueller Gesetzesvorhaben werden ebenfalls berücksichtigt. Der Fokus liegt auf der umfassenden Darstellung der komplexen Rechtslage und der Herausforderungen für die Praxis.
Schlüsselwörter
Grundstückssachvermächtnis, Erbschaftsteuerrecht, BFH-Rechtsprechung, Bewertung, Ertragswert, gemeiner Wert, Grundbesitzwert, BewG, § 146 BewG, § 147 BewG, Vermächtnisnehmer, Beschwerter, Gestaltungsmöglichkeiten, Steueroptimierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Bewertung von Grundstückssachvermächtnissen im Erbschaftsteuerrecht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Bewertung von Grundstückssachvermächtnissen im deutschen Erbschaftsteuerrecht, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen des BFH-Urteils II R 9/02 vom 2. Juli 2004. Sie untersucht verschiedene Bewertungsmethoden und deren rechtliche Grundlagen und zeigt die praktische Relevanz der Rechtsprechung auf.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: die Bewertung von Grundstückssachvermächtnissen im Erbschaftsteuerrecht, die Auswirkungen des BFH-Urteils vom 2. Juli 2004, den Vergleich verschiedener Bewertungsmethoden (Ertragswert, gemeiner Wert), verfassungsrechtliche Aspekte der Bewertung und Gestaltungsmöglichkeiten für die Praxis.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Abschnitte (§§ 1-4). §1 beinhaltet die Einleitung mit Problemstellung, Zielsetzung und Aufbau. §2 erläutert den Begriff des Vermächtnisses im Erbrecht. §3 bildet den Kern der Arbeit und behandelt das Vermächtnis im Erbschaftsteuerrecht, einschließlich der verschiedenen Bewertungsmethoden, der Kritik an diesen und der Analyse der Rechtsprechung des BFH. §4 enthält die Schlussbetrachtung.
Welche Bewertungsmethoden werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Bewertungsmethoden, insbesondere den Ertragswert und den gemeinen Wert im Kontext des Grundbesitzwerts (§§ 146 und 147 BewG). Es wird ein detaillierter Vergleich der Methoden durchgeführt und deren Vor- und Nachteile diskutiert.
Welche Rolle spielt das BFH-Urteil vom 2. Juli 2004?
Das BFH-Urteil II R 9/02 vom 2. Juli 2004 steht im Zentrum der Analyse. Die Arbeit untersucht dessen Auswirkungen auf die Bewertung von Grundstückssachvermächtnissen, kritisiert bestimmte Aspekte des Urteils und zeigt die Konsequenzen für die Praxis auf.
Welche verfassungsrechtlichen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet verfassungsrechtliche Aspekte der Bewertung, insbesondere im Hinblick auf die Eigentumsfreiheit und den Gleichheitssatz.
Welche Gestaltungsmöglichkeiten für die Praxis werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für die Praxis, um die steuerlichen Auswirkungen von Grundstückssachvermächtnissen zu optimieren. Dazu gehören Modelle wie der Rollentausch, Auflagen, Miterben- und Ausschlagungsmodelle.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Grundstückssachvermächtnis, Erbschaftsteuerrecht, BFH-Rechtsprechung, Bewertung, Ertragswert, gemeiner Wert, Grundbesitzwert, BewG, § 146 BewG, § 147 BewG, Vermächtnisnehmer, Beschwerter, Gestaltungsmöglichkeiten, Steueroptimierung.
Wie ist der Begriff des Vermächtnisses im Erbrecht definiert?
Die Arbeit definiert den Begriff des Vermächtnisses im Erbrecht detailliert, einschließlich der Vermächtnisanordnung, des Vermächtnisanspruchs (Schuldrechtlicher Anspruch), der beteiligten Parteien (Bedachter und Beschwerter) sowie des Anfalls, der Fälligkeit und Erfüllung des Anspruchs. Der Vermächtnisgegenstand wird ebenfalls definiert.
Welche Auswirkungen haben aktuelle Gesetzesvorhaben auf die Bewertung?
Die Arbeit berücksichtigt die Auswirkungen aktueller Gesetzesvorhaben, wie z.B. des Jahressteuergesetzes 2007 und des Gesetzes zur Erleichterung der Unternehmensnachfolge, auf die Bewertung von Grundstückssachvermächtnissen.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Pfahler (Autor:in), 2006, Die Bewertung von Grundstückssachvermächtnissen im Erbschaftsteuerrecht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85832