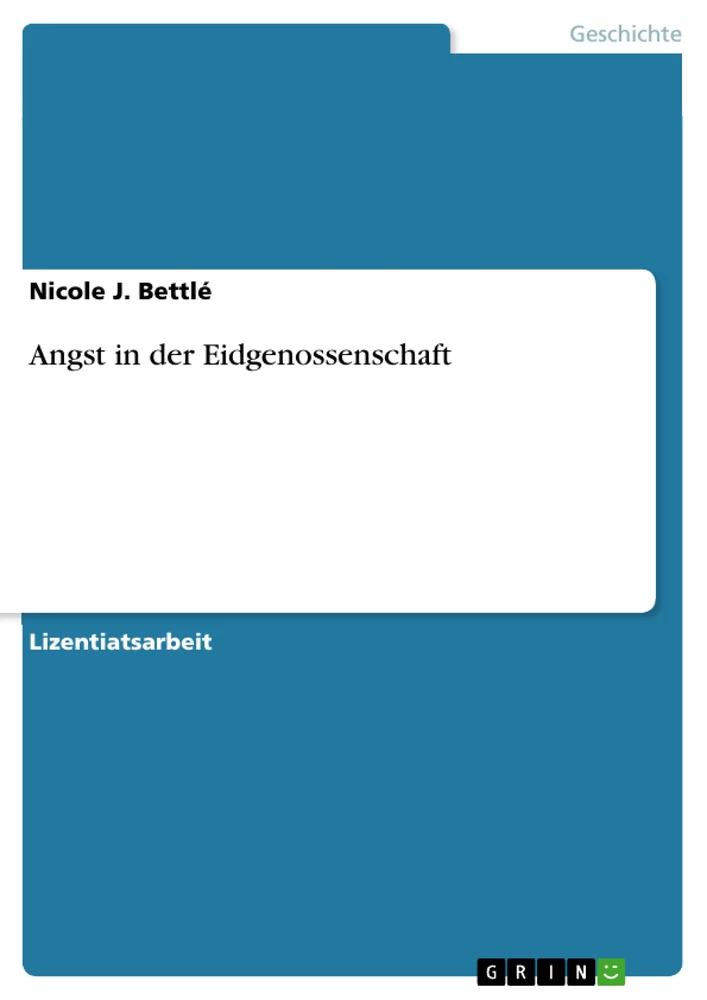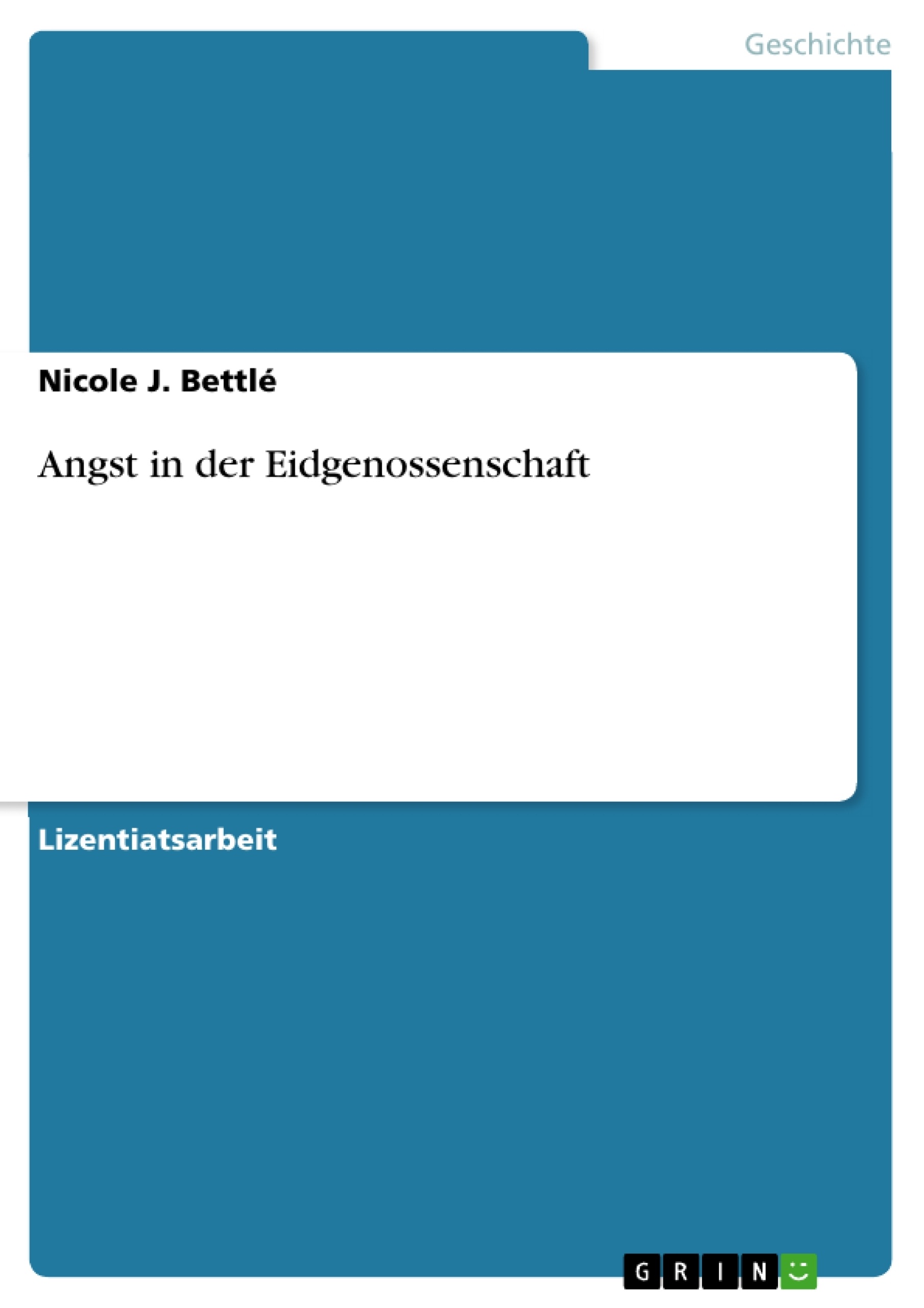Das Buch „Angst in der Eidgenossenschaft“ ist ein Beitrag zur historischen Angstforschung und bietet einen Überblick über das Angstverständnis der Neuzeit (1300-1800). Zwei Hauptthemen stehen im Mittelpunkt der Arbeit: einerseits die natürliche Funktion der Angst (Lebenserhaltung und Fortpflanzung) und andererseits die kulturellen Ängste, die durch den Menschen und seine Institutionen geschaffen werden (u.a. Religion, Politik, Recht). Im ersten Teil der Arbeit werden individuelle und kollektive Angstauslöser sowie Taktiken zur Angstbewältigung aufgezeigt. Das zweite Kapitel widmet sich der mündlichen und schriftlichen Überlieferung der Angsterfahrungen über die Generationen hinweg (Kollektivgedächtnis). Im dritten Teil steht die während der Neuzeit und insbesondere durch die Juristen und Mediziner injizierte Neubewertung der Angst als eine Krankheit im Mittelpunkt. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern sich das heutige Angstverständnis von demjenigen der Neuzeit unterscheidet – oder auch nicht. Dazu werden die Ergebnisse der Arbeit mit dem heutigen Gesundheitszustand der schweizerischen Bevölkerung verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Forschungslage und Begriffserklärung
- Quellen und Aufbau der Arbeit
- Die Definition der sozialpolitischen Angst
- Das Weltbild: christliche Vorstellungswelten
- Weltende und Sünde
- Teufel- und Hexenglauben
- Das Menschenbild: soziale Abgrenzungsmerkmale
- Zugehörigkeitszeichen: äusserliche Merkmale und Kleidung
- Körpermerkmale und Verhaltensweisen des Bösen
- Heldentum und die Angst vor Angstverdacht
- Mutlosigkeit und Armut
- Gemeinschaften: individuelle und kollektive Angstvorstellungen
- Die Klostergemeinschaft und die Angst der Mönche
- Die Lebensgemeinschaft und die Ängste des weltlichen Mannes
- Liebe und Ehe
- Unkeuschheit und Kuckuckskind
- Nachkommenschaft und erbberechtigte Söhne
- Fremde und Mitmenschen
- Die Rezeption der sozialpolitischen Angst
- Die Kommunikation
- Mündliche Überlieferung der Angst
- Angstverbreitung durch Klerus und Obrigkeit
- Die Hexen, die jedermann doch nur mit der eigenen Zunge geschaffen hat
- Die Angsträume
- Das Haus: Schutzlosigkeit und Enge
- Die Stadt: Überbevölkerung, Lebenserwartung und Fortpflanzung
- Individuelle und kollektive Reaktionsmechanismen
- Das Misstrauen des geistlichen und weltlichen Mannes
- Exkurs: Beispiel Kollektivängste
- Hungersnöte
- Pest
- Krieg
- Reaktionen auf Raumabgrenzung und Engeerfahrung
- Städtische Abwehrreaktionen
- Verursacher der Angstwellen und Angst-Aggressions-Antagonismus
- Die Einflüsse auf das kollektive Gedächtnis
- Politische Vorstellungswelten und die Angst als Instrument der Ordnungserhaltung
- Vereinigung von Haus- und Regierungsmacht
- Regierungsführung und Strafandrohung
- Erste demokratische Strukturen und Gruppenabgrenzung
- Kirchliche Vorstellungen der Krankenheilung und ihre Auswirkungen auf moderne Denkmuster
- Abgrenzung von der „Krankheit“ Aberglauben
- Rationalität und Neubeurteilung der Angst
- Krankenheilung und Kollektivausschluss
- Melancholie und Isolation
- Zusammenfassung und Vergleich (Neuzeit und Gegenwart)
- Welt- und Menschenbild
- Abgrenzung und Mitmenschen
- Angstverdacht und Mittel der Angstabwehr
- Angstverbreitung und Bildung
- Enge und Lebenserwartung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Lizentiatsarbeit befasst sich mit der sozialpolitischen Angst in der Eidgenossenschaft. Sie untersucht, wie die Angst im Laufe der Geschichte als Mittel der sozialen Kontrolle und der Abgrenzung eingesetzt wurde. Die Arbeit analysiert die Bedeutung von Angstvorstellungen in verschiedenen Bereichen des Lebens, von der Familie und der Gemeinde bis hin zur politischen Ordnung.
- Die Rolle der Angst in der Konstruktion von Welt- und Menschenbildern
- Die Kommunikation von Angst in verschiedenen Formen und Medien
- Die sozialen und räumlichen Ausdrucksformen der Angst
- Die Bedeutung von Angst als Instrument der Ordnungserhaltung
- Die Entwicklung der Angst und ihrer Interpretation über die Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungslage zur sozialpolitischen Angst beleuchtet und die methodischen Grundlagen der Arbeit erläutert. Kapitel 1 definiert die sozialpolitische Angst und analysiert die zugrunde liegenden Welt- und Menschenbilder. In diesem Kontext werden sowohl christliche Vorstellungswelten als auch soziale Abgrenzungsmerkmale beleuchtet. Kapitel 2 widmet sich der Rezeption der sozialpolitischen Angst, indem es die Kommunikation von Angst und die Entstehung von Angsträumen analysiert. Kapitel 3 untersucht die Einflüsse der sozialpolitischen Angst auf das kollektive Gedächtnis, insbesondere im Hinblick auf politische Ordnung und kirchliche Krankenheilung. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung und einem Vergleich der sozialpolitischen Angst in der Neuzeit und der Gegenwart.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind: sozialpolitische Angst, christliche Vorstellungswelten, Abgrenzungsmerkmale, Kommunikation, Angsträume, kollektives Gedächtnis, Ordnungserhaltung, Krankenheilung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Themen behandelt das Buch "Angst in der Eidgenossenschaft"?
Es untersucht das Angstverständnis der Neuzeit (1300-1800), wobei zwischen natürlichen Funktionen der Angst und kulturell geschaffenen Ängsten durch Religion, Politik und Recht unterschieden wird.
Wie wurde Angst als Instrument der Ordnungserhaltung genutzt?
Obrigkeit und Klerus nutzten Angstvorstellungen (wie Sündhaftigkeit oder Strafandrohung), um soziale Abgrenzung zu schaffen und politisches Wohlverhalten zu erzwingen.
Was waren die größten kollektiven Angstauslöser der Neuzeit?
Zu den massiven Bedrohungen zählten Hungersnöte, die Pest, Kriege sowie der Glaube an Teufel und Hexen.
Wie veränderte sich die Wahrnehmung der Angst im Laufe der Zeit?
Durch Juristen und Mediziner erfolgte eine Neubewertung der Angst als Krankheit (z. B. Melancholie), was zu neuen Formen des kollektiven Ausschlusses führte.
Inwiefern unterscheidet sich das heutige Angstverständnis von dem der Neuzeit?
Die Arbeit vergleicht historische Denkmuster mit dem heutigen Gesundheitszustand der Schweizer Bevölkerung, um Kontinuitäten und Brüche in der Angstbewältigung aufzuzeigen.
- Arbeit zitieren
- lic.phil. Nicole J. Bettlé (Autor:in), 2006, Angst in der Eidgenossenschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85465