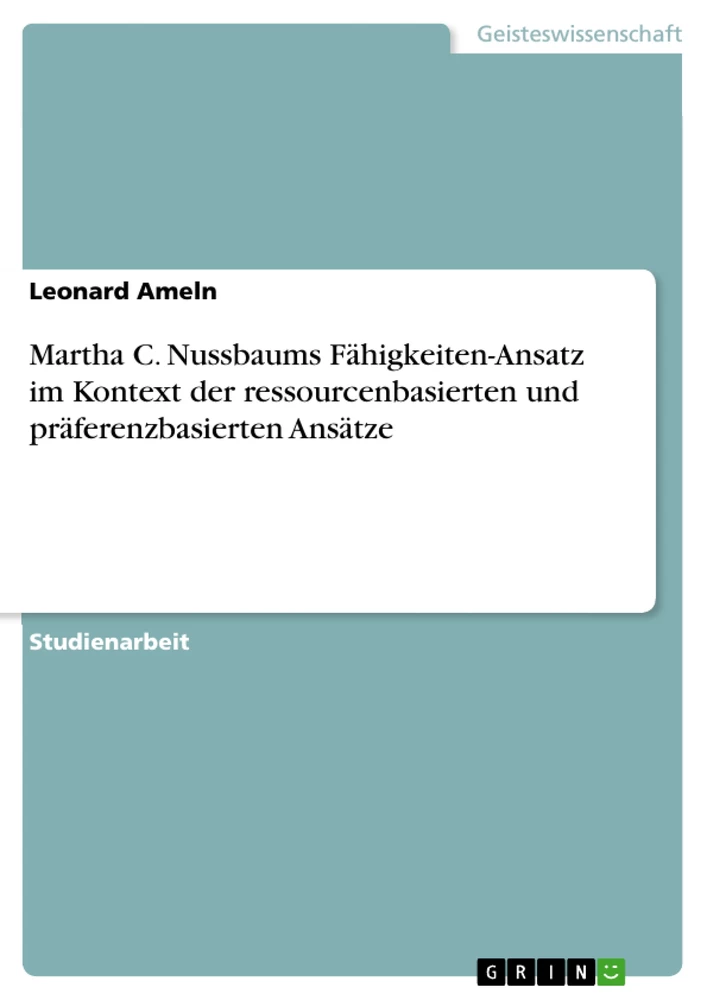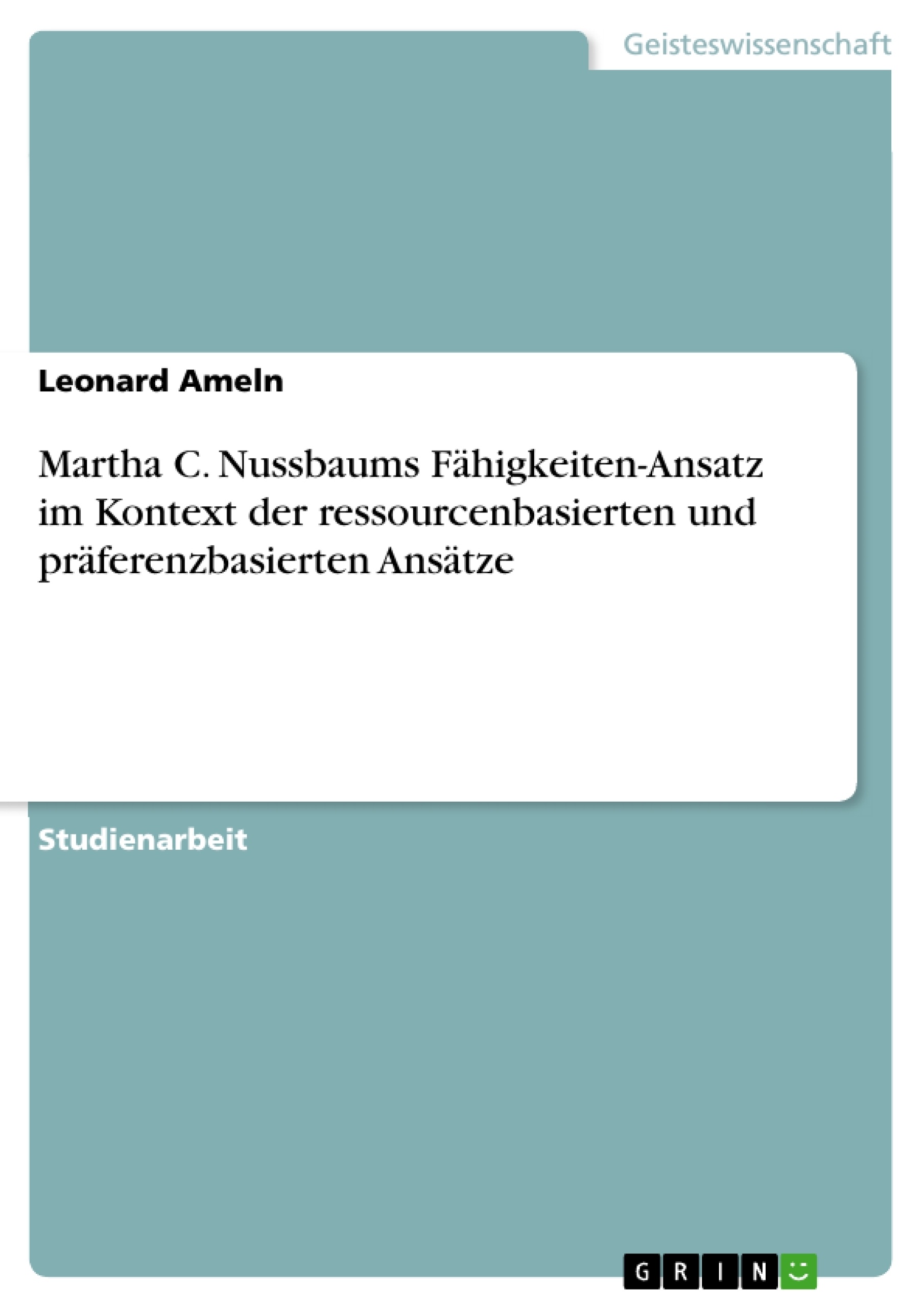Martha C. Nussbaum, Professorin an der Universität von Chicago, hat in den vergangenen Jahren mit ihrem Fähigkeiten-Ansatz ('capabilities-approach') maßgebliche Beiträge zur Kommunitarismus-Liberalismus-Debatte geleistet , welche durch John Rawls' Gerechtigkeitstheorie ('A Theory of Justice', 1971) ausgelöst wurde.
Ausgehend von der Fragestellung, welches Leben ein im aristotelischen Sinne gutes Leben ist, und welcher Voraussetzungen es dafür bedarf entwickelt sie, sich fortlaufend argumentativ auf Aristoteles stützend, eine "universalistische fähigkeitenbasierte Konzeption des Guten. Von Anfang an verfolgt sie damit zwei Anliegen: Zum einen will sie eine Alternative zu den in der Entwicklungsökonomik weit verbreiteten, aber unbefriedigenden Bewertungsansätzen der Lebensqualität - Pro-Kopf-Einkommen und Präferenzbefriedigung - schaffen, zum anderen will sie die Konzeptionen des Guten, die in der politischen Philosophie diskutiert werden - nämlich Gleichheit von Grundgütern und Ressourcen - präzisieren" und somit "Rawls' Theorie der Gerechtigkeit um eine eudämonistische Komponente [..] erweitern" .
In der vorliegenden Arbeit werde ich zunächst die von Martha Nussbaum vorgeschlagenen Fähigkeiten-Kategorien näher unter der Fragestellung diskutieren, inwieweit sie vollständig und auch angemessen sind, die Lebensqualität eines Menschen (über kulturelle Differenzen hinweg) zu bewerten. Räumt die Konzeption der 'functionings' und 'capabilities' jeden Vorwurfs hinsichtlich des Paternalismus aus dem Weg?
Und: Inwieweit ist es tatsächlich zulässig, daraus moralische und politische Forderungen abzuleiten? Welche Argumente benutzt Nussbaum dafür im Einzelnen?
Abschließend möchte ich Nussbaums Ansatz in den Kontext von ressourcen- und präferenzbasierten Ansätzen im Rahmen der Wohlfahrtsforschung stellen und damit, wenn möglich, die Leistungsfähigkeit des 'capabilities-approach' beurteilen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Fähigkeiten-Ansatz
- 2.1. Überblick
- 2.2. Vorgehensweise und Argumentation
- 3. Einwände und Gegenargumentation
- 3.1. Argument aufgrund von Kultur
- 3.2. Argument über das Gut der Vielfalt
- 3.3. Argument über den Paternalismus
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Martha C. Nussbaums Fähigkeiten-Ansatz im Kontext ressourcen- und präferenzbasierter Ansätze. Die Arbeit analysiert die Angemessenheit von Nussbaums Fähigkeiten-Kategorien zur Bewertung der Lebensqualität, diskutiert Einwände gegen den Ansatz und prüft die Ableitung moralischer und politischer Forderungen daraus. Schließlich wird der Fähigkeiten-Ansatz im Kontext der Wohlfahrtsforschung eingeordnet.
- Bewertung der Lebensqualität mittels Nussbaums Fähigkeiten-Kategorien
- Analyse von Einwänden gegen den Fähigkeiten-Ansatz (Kultur, Vielfalt, Paternalismus)
- Ableitung moralischer und politischer Forderungen aus dem Fähigkeiten-Ansatz
- Einordnung des Fähigkeiten-Ansatzes in die Wohlfahrtsforschung
- Vergleich mit ressourcen- und präferenzbasierten Ansätzen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt Martha C. Nussbaums Fähigkeiten-Ansatz als Alternative zu den in der Entwicklungsökonomik verbreiteten Bewertungsansätzen der Lebensqualität (Pro-Kopf-Einkommen und Präferenzbefriedigung) vor. Sie beschreibt Nussbaums Ziel, Rawls' Gerechtigkeitstheorie um eine eudämonistische Komponente zu erweitern und eine umfassendere Bewertung der Lebensqualität zu ermöglichen. Die Arbeit kündigt die Diskussion der Angemessenheit von Nussbaums Fähigkeiten-Kategorien und die Einordnung des Ansatzes in den Kontext der Wohlfahrtsforschung an.
2. Der Fähigkeiten-Ansatz: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über Nussbaums Fähigkeiten-Ansatz, platziert ihn im Spannungsfeld zwischen Kommunitarismus und Liberalismus und erläutert, wie Nussbaum Elemente beider Denkrichtungen in ihrem Ansatz vereint. Es betont Nussbaums humanistisches Projekt der Sozialkritik, das darauf abzielt, politische Systeme so zu gestalten, dass sie ein reichhaltiges und erfülltes Leben ermöglichen. Der Ansatz wird als Antwort auf die eindimensionale Betrachtung von Wohlstand und Lebensqualität kritisiert, die oft auf ökonomischen Parametern basiert. Nussbaum plädiert für eine umfassendere Sichtweise, die sich auf die Fähigkeiten jedes Einzelnen konzentriert.
Schlüsselwörter
Fähigkeiten-Ansatz, Martha Nussbaum, Lebensqualität, Gerechtigkeit, Wohlfahrtsforschung, Ressourcenbasierte Ansätze, Präferenzbasierte Ansätze, Kommunitarismus, Liberalismus, Eudämonie, Aristoteles, Rawls, Paternalismus, Kultur, Vielfalt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Martha C. Nussbaums Fähigkeiten-Ansatz
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht Martha C. Nussbaums Fähigkeiten-Ansatz im Kontext ressourcen- und präferenzbasierter Ansätze. Sie analysiert die Angemessenheit von Nussbaums Fähigkeiten-Kategorien zur Bewertung der Lebensqualität, diskutiert Einwände gegen den Ansatz und prüft die Ableitung moralischer und politischer Forderungen daraus. Schließlich wird der Fähigkeiten-Ansatz in die Wohlfahrtsforschung eingeordnet.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Bewertung der Lebensqualität mittels Nussbaums Fähigkeiten-Kategorien; Analyse von Einwänden gegen den Fähigkeiten-Ansatz (Kultur, Vielfalt, Paternalismus); Ableitung moralischer und politischer Forderungen aus dem Fähigkeiten-Ansatz; Einordnung des Fähigkeiten-Ansatzes in die Wohlfahrtsforschung; Vergleich mit ressourcen- und präferenzbasierten Ansätzen.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Fähigkeiten-Ansatz, ein Kapitel mit Einwänden und Gegenargumentationen und ein Fazit. Kapitel 2 gibt einen Überblick über Nussbaums Ansatz und seine Einbettung in den philosophischen Diskurs (Kommunitarismus und Liberalismus). Kapitel 3 behandelt kritische Argumente, die auf kulturellen Unterschieden, dem Gut der Vielfalt und dem Vorwurf des Paternalismus beruhen.
Was ist Nussbaums Fähigkeiten-Ansatz?
Nussbaums Fähigkeiten-Ansatz bietet eine Alternative zu rein ökonomischen Bewertungsmaßstäben von Lebensqualität (z.B. Pro-Kopf-Einkommen). Sie verbindet Elemente des Kommunitarismus und Liberalismus und zielt auf ein reichhaltiges und erfülltes Leben für alle ab, indem sie die Fähigkeiten jedes Einzelnen in den Mittelpunkt stellt. Der Ansatz wird als Kritik an der eindimensionalen Betrachtung von Wohlstand und Lebensqualität verstanden.
Welche Einwände gegen den Fähigkeiten-Ansatz werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert Einwände, die den Fähigkeiten-Ansatz als kulturell zu spezifisch, paternalistisch oder als Bedrohung der Vielfalt kritisieren. Diese Einwände werden im Detail analysiert und mit Gegenargumenten versehen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Seminararbeit?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit ergeben sich aus der Analyse von Nussbaums Ansatz und den damit verbundenen Debatten. Sie ordnet den Fähigkeiten-Ansatz in die Wohlfahrtsforschung ein und bewertet seine Eignung zur umfassenderen Beurteilung von Lebensqualität.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Fähigkeiten-Ansatz, Martha Nussbaum, Lebensqualität, Gerechtigkeit, Wohlfahrtsforschung, Ressourcenbasierte Ansätze, Präferenzbasierte Ansätze, Kommunitarismus, Liberalismus, Eudämonie, Aristoteles, Rawls, Paternalismus, Kultur, Vielfalt.
Wo finde ich eine detailliertere Zusammenfassung der Kapitel?
Die HTML-Datei beinhaltet Kapitelzusammenfassungen, die die einzelnen Abschnitte der Seminararbeit detaillierter beschreiben und ihren jeweiligen Inhalt und die Argumentationslinie skizzieren.
- Quote paper
- Leonard Ameln (Author), 2006, Martha C. Nussbaums Fähigkeiten-Ansatz im Kontext der ressourcenbasierten und präferenzbasierten Ansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84417