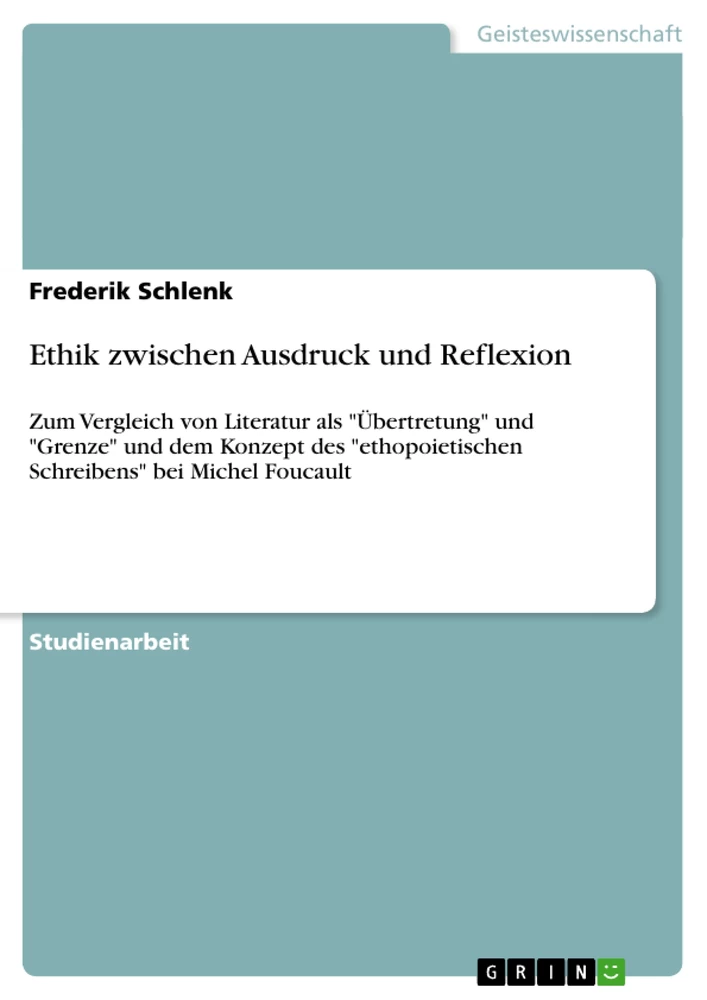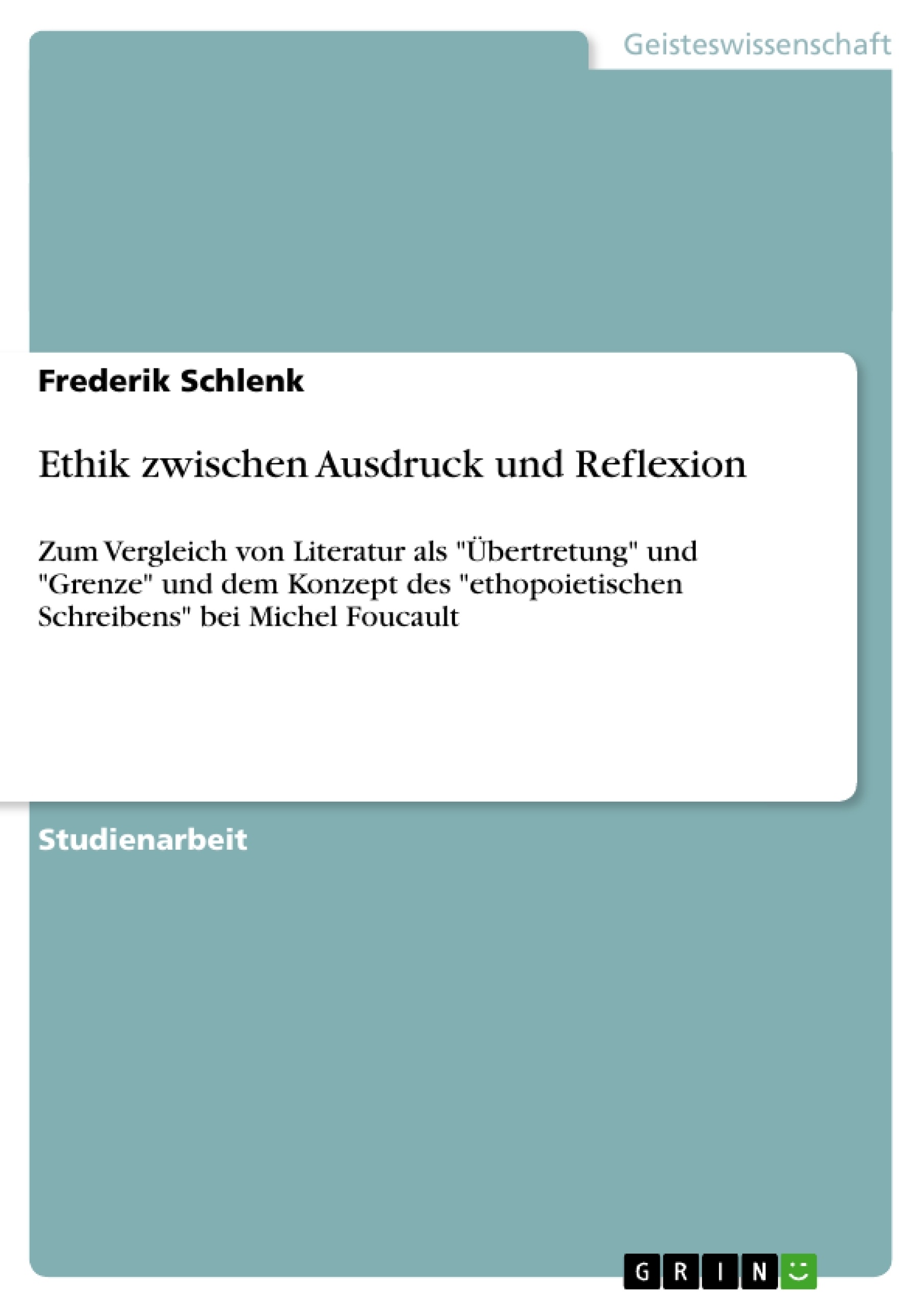„Wen kümmert´s, wer spricht?“ – Mit diesem Zitat Becketts beginnt Michel Foucault am 22. Februar 1969 einen Vortrag in der Französischen Gesellschaft für Philosophie. Zu diesem Zeitpunkt, ein Jahr vor seiner programmatischen Inauguralvorlesung am Collège de France, waren bereits drei wichtige Werke Foucaults erschienen: Die „Histoire de la folie“ (1961), die „Naissance de la clinique“ (1963) und „Les mots et les choses“ (1966). „L´archéologie du savoir“ erschien noch im gleichen Jahr 1969, kurze Zeit später folgte „L´ordre du discours“ (1971).
Schon die Intention der Beckett´schen Frage lässt in ihrer ausgesprochenen Gleichgültigkeit – genauer: in der Bestimmung dieses Emotivs als „eines der ethischen Grundprinzipien heutigen Schreibens“ – erkennen, warum der Philosoph das Schreiben zu seinem Thema machte. Offensichtlich erklärt sich das Erkenntnis- oder Verständnisinteresse an der Literatur nicht aus dem hermeneutisch abgeriegelten Bereich einer Kunstanalyse heraus, die in den Schriften deren Sinn und Bedeutung lediglich aus dem inneren Verweisungszusammenhang der Worte und Begriffe zieht. Vielmehr scheint für Foucault „littérature“ erst zu einer viel umfassenderen, modernen Bedeutung zu gelangen, wenn sie beginnt, die gleichsam in sie eingeschriebenen Merkmale wieder in ihr Umfeld zurückzugeben und so mit ihm in ein ausdrückliches Austauschverhältnis tritt. Aufgrund der Analyse der komplexen Bedingungen und Wirkungen dieses Vorgangs, der allein mit ästhetischen Kategorien kaum in den Griff zu bekommen sein dürfte, gelangt Foucault in der letzten Phase seines Werkes zur „écriture“, also dem, was bereits auf der Grundlage seiner Niederschrift eine ambivalente Beziehung zu seinem Hervorbringer, dem möglichen Rezipienten und den allgemeinen Produktionsbedingungen seiner Herstellung unterhält.
Die Schwierigkeiten, die Foucault durch verschiedene Ansätze zu dieser Problematik hin begleiteten, werden in der vorliegenden Arbeit weniger aufgelöst als aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und methodologische Vorbemerkungen
- Das Problem der Wissenschaftlichkeit
- Die theoretischen Begriffe Foucaults
- Die genealogisch-archäologische Methode
- Die „Schriften zur Literatur“ und ihre Begriffe
- Literaturtheorie oder Erfahrungsdenken? - Diskurs oder Gegendiskurs?
- Die Progressivität des Foucault'schen Denkens
- Die Ethik des Foucault'schen Spätwerkes
- Ist Foucaults Gesamtwerk widersprüchlich?
- Resümee und Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Beziehung zwischen philosophischer Reflexion und literarischem Ausdruck im Werk von Michel Foucault. Im Fokus steht insbesondere der Vergleich zwischen Foucaults Konzept des „ethopoietischen Schreibens“ und dem Verständnis von Literatur als „Übertretung“ und „Grenze“. Ziel ist es, die komplexen Verbindungen zwischen Literatur und Philosophie im Denken Foucaults zu beleuchten und den Einfluss seiner Werke auf die Literaturtheorie zu untersuchen.
- Die Entstehung des „ethopoietischen Schreibens“ im Spätwerk Foucaults
- Der Einfluss von Nietzsche auf Foucaults Denken über Sprache, Macht und das Subjekt
- Die Rezeption von Foucaults Werk in der Literaturtheorie
- Das Problem der Wissenschaftlichkeit in Bezug auf die Analyse literarischer Texte
- Die Bedeutung von „écriture de soi“ als Selbsttechnik im Kontext von Foucaults Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt die methodologischen Grundlagen der Arbeit fest und stellt den zentralen Forschungsgegenstand dar: das Verhältnis von Literatur und Philosophie in Michel Foucaults Werk. Die folgende Analyse der wissenschaftlichen Problematik in Foucaults Denken erörtert die Herausforderungen, die sich aus dem Vergleich zwischen philosophischer Reflexion und literarischem Ausdruck ergeben.
Daraufhin wird ein Überblick über die theoretischen Begriffe Foucaults gegeben, wobei die genealogisch-archäologische Methode sowie die zentralen Konzepte aus den „Schriften zur Literatur“ im Detail beleuchtet werden. Abschließend wird die Bedeutung der „écriture de soi“ als Selbsttechnik im Kontext von Foucaults Spätwerk erörtert und in Beziehung zu seinem früheren Verständnis von Literatur gesetzt.
Schlüsselwörter
Michel Foucault, Ethik, Literatur, „écriture de soi“, „ethopoietisches Schreiben“, „Übertretung“, „Grenze“, Philosophie, Diskursanalyse, Genealogie, Archäologie, Macht, Wissen, Sexualität, Selbsttechniken, „Nouveau Roman“.
- Citar trabajo
- M.A. Frederik Schlenk (Autor), 2003, Ethik zwischen Ausdruck und Reflexion, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84060