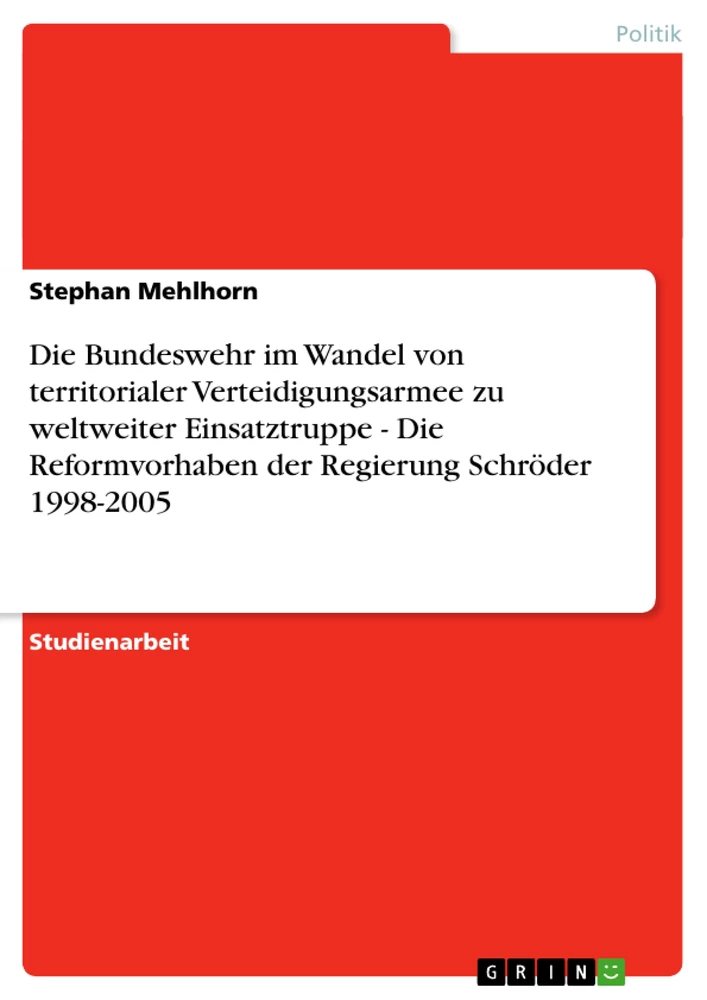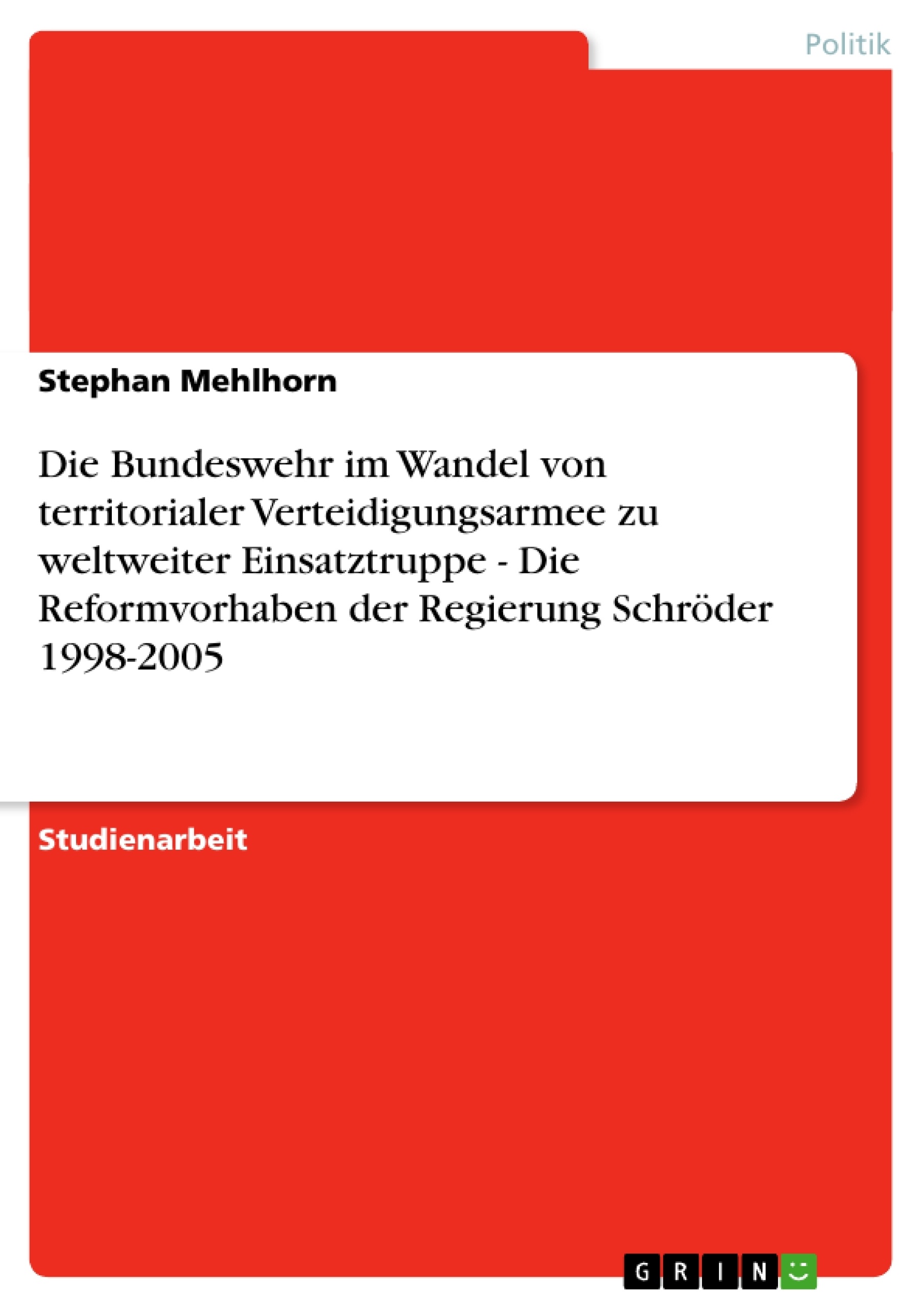Die Reform der Bundeswehr, die nach dem Zusammenbruch des Ostblocks Anfang der 1990er Jahre begann, entwickelte sich, begleitet durch Nachfolgekriege in Osteuropa und neue weltweite terroristische Bedrohungen, zu einem der vorrangigsten Ziel der deutschen Politik an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Die sich transformierende EU bestimmte auf dem Rat von Helsinki 1999 zudem feste Ziele europäischer Streitkräfte bis zum Jahr 2003, die die Petersberg-Aufgaben wahrnehmen können sollen. Der Bundeswehr als deutsche, europäische und NATO-Armee steht eine generelle Umstrukturierung bevor, die sie zukunfts- und damit überhaupt einsatzfähig machen muss. Seit Anfang der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts wurden mehrere Reformen geplant und (zumindest teilweise) durchgeführt, während erst in den letzten Jahren ein Umdenken hin zu einer ständigen Veränderung entstand, die nicht schubweise, sondern konstant erfolgen müsse. Dabei spielte eine große Rolle die Änderung der Kultur der Streitkräfte von einer landgestützten Massenarmee hin zu einer, in Luftraum und auf See aktiven Armee, hochausgebildeten Streitkraft, deren Landstreitkräfte verringert, dafür aber spezialisiert und technisch überlegen ausgestattet sind. Aus letztgenanntem ergibt sich wiederum die Frage nach der Notwendigkeit einer Wehrpflicht, da bereits viele westlich orientierte Nationen auf Berufsarmeen umgestellt haben, welche sich im Wesentlichen bewährt haben. Da gerade die Grünen, die seit jeher auf eine Abschaffung der Wehrpflicht bestehen, nun zum ersten Mal im deutschen Bundestag als Regierungspartei saßen, bildete dieser Bereich den größten öffentlichen Diskurs, der medial ausgetragen wurde.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Gründe, Planungen und Umsetzungen der Reformen unter der Regierung Schröder 1998 – 2005 zu beleuchten. Auf Grund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit ist es nicht möglich, auf alle Einflüsse und Diskussionspapiere einzugehen sowie auch nicht die öffentliche Diskussion zu beleuchten. Aus diesem Anlass heraus soll besonderes Augenmerk auf die Berichte der Weizsäcker-Kommission und des von Kirchbach-Reports sowie dem darauf aufbauenden Papier des damaligen Bundesministers der Verteidigung Rudolf Scharping gelegt werden und weiterhin ist zu untersuchen, welche Einflussfaktoren die grundsätzliche Ausrichtung der deutschen Militärpolitik beeinflussen bzw. ihre Entwicklung fordern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Vorwort
- 2. Die Situation der Bundeswehr gegen Ende des 20. Jahrhunderts
- 3. Politische Rahmenbedingungen
- 3.1. Außenpolitische Forderungen durch Bündnispolitik
- 3.2. Der Innenpolitische Rahmen
- 3.2.1. Koalitionsvereinbarung und Regierung 1998
- 3.2.2. Koalitionsvereinbarung und Regierung 2002
- 4. Die vorgelegten Reform-Modelle
- 4.1. von Kirchbach-Konzept und Weizsäcker-Kommission
- 4.2. Das Reformprogramm des Bundesverteidigungsministers Scharping
- 4.3. Die Reform im Streit zwischen den Fraktionen der deutschen Bundesparteien
- 4.4. Die Verteidigungspolitischen Richtlinien 2003
- 5. Die Umsetzung der Reformvorhaben
- 5.1. Haushalt, Finanzierung und Standortfrage
- 5.2. Streitkräftebasis und Wehrpflicht
- 5.3. Die Bundeswehr in Europa
- 5.4. Neuorganisierung der Struktur
- 5.5. Investitionen in Ausbildung und Ausrüstung
- 5.6. Waffen- und Materialreduzierung
- 6. Fazit: Zukunftsfähigkeit durch Flexibilität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Gründen, Planungen und Umsetzungen der Reformen der Bundeswehr unter der Regierung Schröder (1998 – 2005). Der Fokus liegt dabei auf den Berichten der Weizsäcker-Kommission und des von Kirchbach-Reports sowie dem Papier des damaligen Bundesverteidigungsministers Rudolf Scharping. Die Arbeit untersucht auch die Einflussfaktoren, die die grundsätzliche Ausrichtung der deutschen Militärpolitik beeinflusst haben, und zeigt die konkreten Ausführungen und Umsetzungen der Reformen auf.
- Die Transformation der Bundeswehr von einer territorialen Verteidigungsarmee zu einer weltweiten Einsatztruppe
- Die Rolle der Bündnispolitik und die außenpolitischen Forderungen
- Die innenpolitischen Rahmenbedingungen und die Auswirkungen der Koalitionsverträge auf die Reform
- Die verschiedenen Reformmodelle und ihre Umsetzung
- Die Bedeutung der Wehrpflicht in der neuen Sicherheitslandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Ausgangssituation der Bundeswehr gegen Ende des 20. Jahrhunderts dar. Es beschreibt die Herausforderungen, die sich durch den Zusammenbruch des Ostblocks und die Transformation Osteuropas ergeben haben. Das zweite Kapitel analysiert die politischen Rahmenbedingungen der Reform, einschließlich der außenpolitischen Forderungen durch die Bündnispolitik und der innenpolitischen Rahmenbedingungen, insbesondere die Koalitionsverträge von 1998 und 2002. Das dritte Kapitel beleuchtet die verschiedenen Reformmodelle, die von der Weizsäcker-Kommission, dem von Kirchbach-Report und dem Bundesverteidigungsminister Scharping vorgelegt wurden.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Bundeswehr, Reform, Transformation, Streitkräfte, Bündnispolitik, Außenpolitik, Innenpolitik, Koalitionsvertrag, Wehrpflicht, Einsatztruppe, Weizsäcker-Kommission, von Kirchbach-Report, Rudolf Scharping, Europäische Union, NATO.
- Quote paper
- B.A. Stephan Mehlhorn (Author), 2007, Die Bundeswehr im Wandel von territorialer Verteidigungsarmee zu weltweiter Einsatztruppe - Die Reformvorhaben der Regierung Schröder 1998-2005, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83863