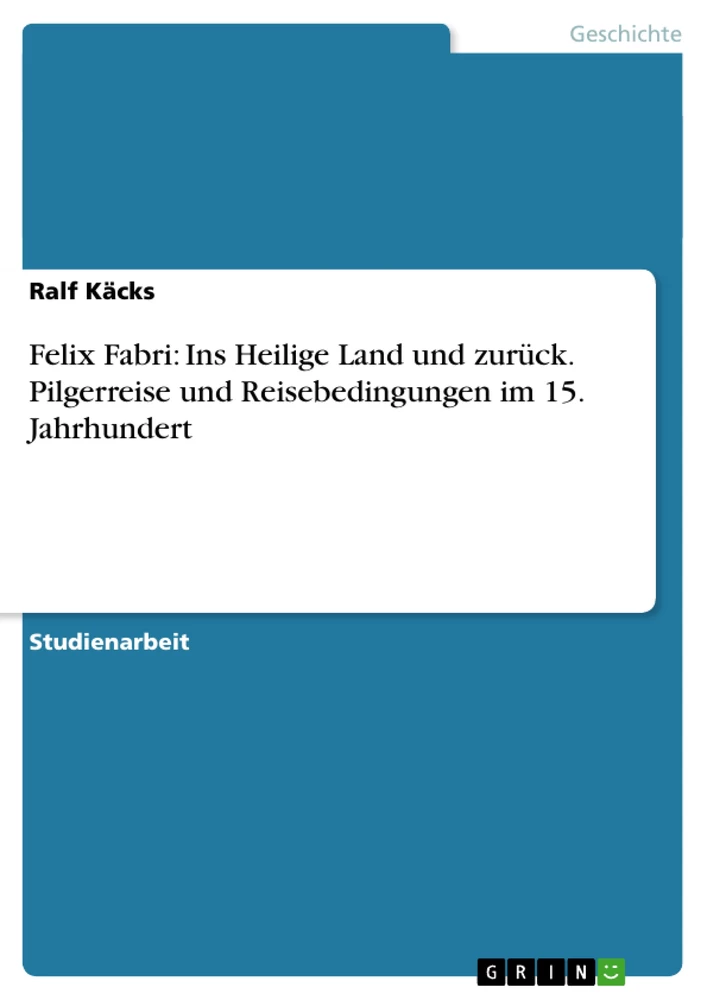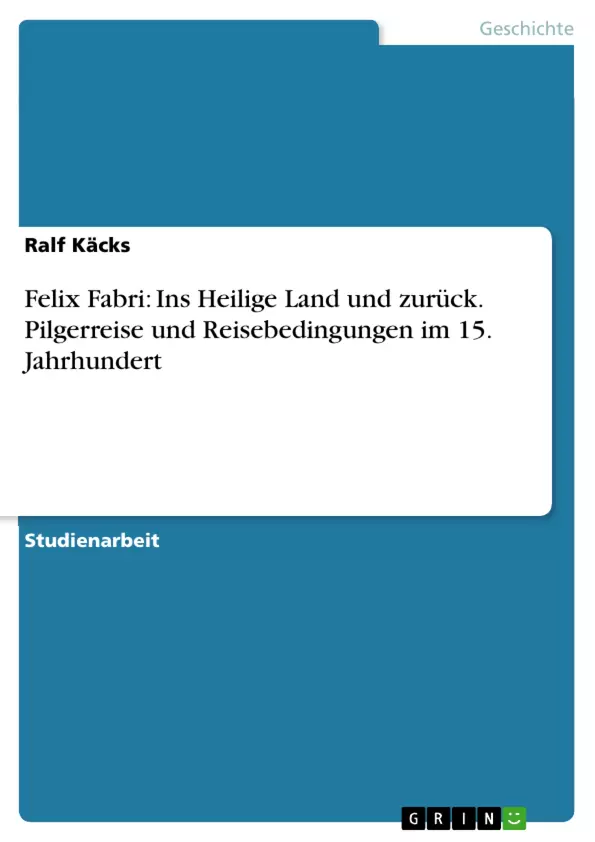Mobilität, Kommunikation und Globalität gelten heute als Schlagwörter für das nun bald anbrechende 21. Jahrhundert. Es wird nicht mit Spekulationen gespart, wie unsere Zukunft im dritten Jahrtausend wohl aussehen wird. Unverkennbar ist bei all den Betrachtungen die enorme Bedeutung von Verkehr und Transport in lokalen, regionalen und internationalen Dimensionen, ja das Reisen schlechthin steht ohne Frage jedem Mitglied der heutigen Gesellschaft offen.
Auch wenn das Ausmaß der Reisetätigkeit sicherlich erst allmählich zugenommen hat und sich besonders seit dem Aufkommen der Eisenbahn, des Autos und des Flugzeuges revolutioniert hat, lässt sich doch konstatieren, dass auch der Mensch des Mittelalters mit dem Reisen als Mittel zum Zweck, aber auch der Notwendigkeit von überregionalem Austausch durch Reisen, vertraut war. Viele Aspekte der mittelalterlichen Geschichte, die wir heute betrachten, schließen die Reisetätigkeit einzelner oder ganzer Gruppen wie selbstverständlich ein, oft ohne mit der notwendigen Aufmerksamkeit darauf zu achten, was denn das Unterwegssein in jener Zeit überhaupt bedeutete. Erst nachdem der in der heutigen Gesellschaft verwurzelte Betrachter seine modernen Vorstellungen von Mobilität zur Seite gelegt hat und Reisebedingungen mit den Augen eines Zeitgenossen betrachtet, kann ihm auch erst die ganze Bedeutung und Tragweite einzelner Gegebenheiten deutlich werden.
Bei den auch im Mittelalter bereits zahlreich reisenden Menschen lassen sich die unterschiedlichsten Motive für das Unterwegssein festmachen. Hierbei stellt Arnold Esch "die Pilgerreise als damals üblichste und meistberichtete Form der Reise für Personen jedes Standes" heraus. Norbert Ohler geht sogar noch einen Schritt weiter wenn er den Pilger als "Prototypen des mittelalterlichen Reisenden" bezeichnet. An anderer Stelle heißt es: "Das Pilgern […] gehörte zu den wenigen legitimen Reisebegründungen des sonst heimatgebundenen mittelalterlichen Menschen." Neben vielen lokalen und regionalen Pilgerzielen standen die drei Ziele der ‚peregrinationes maiores′ - Rom, Santiago de Compostela und das Heilige Land mit Jerusalem - an der Spitze der Pilgerrangliste. Aufgrund der hohen Kosten, die mit der Reise nach Jerusalem verbunden waren, stand dieses Pilgerziel meist aber nur recht wohlhabenden Pilgern offen, die auch ohne weiteres eine Abwesenheit vom Heimatort von bis zu einem Jahr oder länger einrichten konnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Felix Fabri und sein Pilgerbericht
- Ins Heilige Land und zurück
- Reisevorbereitungen
- Von Ulm nach Venedig - Landreise und Alpenüberquerung
- Von Venedig nach Jaffa - Pilgerreise zu Schiff
- Vom Heiligen Land nach Ägypten – Reisen in der Fremde
- Fabri und Breydenbach – Ein gemeinsames Erlebnis?
- Schlussbetrachtung
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Pilgerreise des Felix Fabri ins Heilige Land im 15. Jahrhundert und untersucht die Reisebedingungen jener Zeit. Ziel ist es, Fabri's Pilgerbericht in den Kontext der mittelalterlichen Reisetätigkeit und der Wahrnehmung Palästinas im Mittelalter einzuordnen.
- Die Bedeutung von Verkehr und Transport im Mittelalter
- Die Pilgerreise als Prototyp der mittelalterlichen Reise
- Die Reisebedingungen und -routen im 15. Jahrhundert
- Der Vergleich von Fabri's Reisebericht mit anderen Pilgerberichten der Zeit
- Die Rolle von Venedig als Ausgangspunkt für Pilgerreisen ins Heilige Land
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung setzt den Kontext für die Studie und beleuchtet die Bedeutung der Reisetätigkeit im Mittelalter. Sie hebt die Pilgerreise als eine wichtige Form des Reisens hervor und stellt die Bedeutung des Heiligen Landes als Pilgerziel dar.
- Felix Fabri und sein Pilgerbericht: Dieses Kapitel präsentiert Felix Fabri als Person und beleuchtet seinen Pilgerbericht als Quelle für das Verständnis der Reisebedingungen und der Wahrnehmung des Heiligen Landes im 15. Jahrhundert.
- Ins Heilige Land und zurück: Dieses Kapitel beschreibt Fabri's Reise in drei Abschnitten: die Reisevorbereitungen, die Reise von Ulm nach Venedig und die Seereise von Venedig nach Jaffa. Es gibt Einblicke in die Reisebedingungen, die Herausforderungen und die besonderen Orte, die Fabri auf seiner Reise erlebt hat.
- Fabri und Breydenbach – Ein gemeinsames Erlebnis?: Dieses Kapitel vergleicht Fabri's Pilgerbericht mit dem Bericht von Bernhard von Breydenbach, einem anderen bekannten Pilger des 15. Jahrhunderts.
Schlüsselwörter
Pilgerreise, Heiligen Land, Jerusalem, Mittelalter, Reisebedingungen, Verkehr, Transport, Felix Fabri, Bernhard von Breydenbach, Venedig, Reisebericht, Wahrnehmung Palästinas.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Felix Fabri?
Felix Fabri war ein Pilger des 15. Jahrhunderts, der durch seinen detaillierten Reisebericht über seine Pilgerfahrt ins Heilige Land bekannt wurde.
Welche Route nahm Felix Fabri für seine Reise?
Seine Reise führte ihn von Ulm über die Alpen nach Venedig und von dort aus mit dem Schiff über das Mittelmeer nach Jaffa im Heiligen Land.
Warum war Venedig im 15. Jahrhundert so wichtig für Pilger?
Venedig war der zentrale Ausgangspunkt für Seereisen ins Heilige Land und verfügte über die notwendige Infrastruktur und Schiffsverbindungen für Pilgergruppen.
Wer konnte sich eine Pilgerreise nach Jerusalem leisten?
Aufgrund der extrem hohen Kosten und der Dauer von bis zu einem Jahr stand dieses Pilgerziel meist nur wohlhabenden Bürgern oder Geistlichen offen.
Mit welchem anderen Pilgerbericht wird Fabris Werk verglichen?
Die Arbeit vergleicht Fabris Bericht mit dem von Bernhard von Breydenbach, einem weiteren bedeutenden Pilger dieser Zeit.
Was erfährt man in dem Bericht über die Reisebedingungen?
Der Bericht gibt Einblicke in die Herausforderungen der Alpenüberquerung, die Gefahren der Seefahrt und die bürokratischen sowie kulturellen Hürden beim Reisen in der Fremde.
- Quote paper
- Ralf Käcks (Author), 2000, Felix Fabri: Ins Heilige Land und zurück. Pilgerreise und Reisebedingungen im 15. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8325