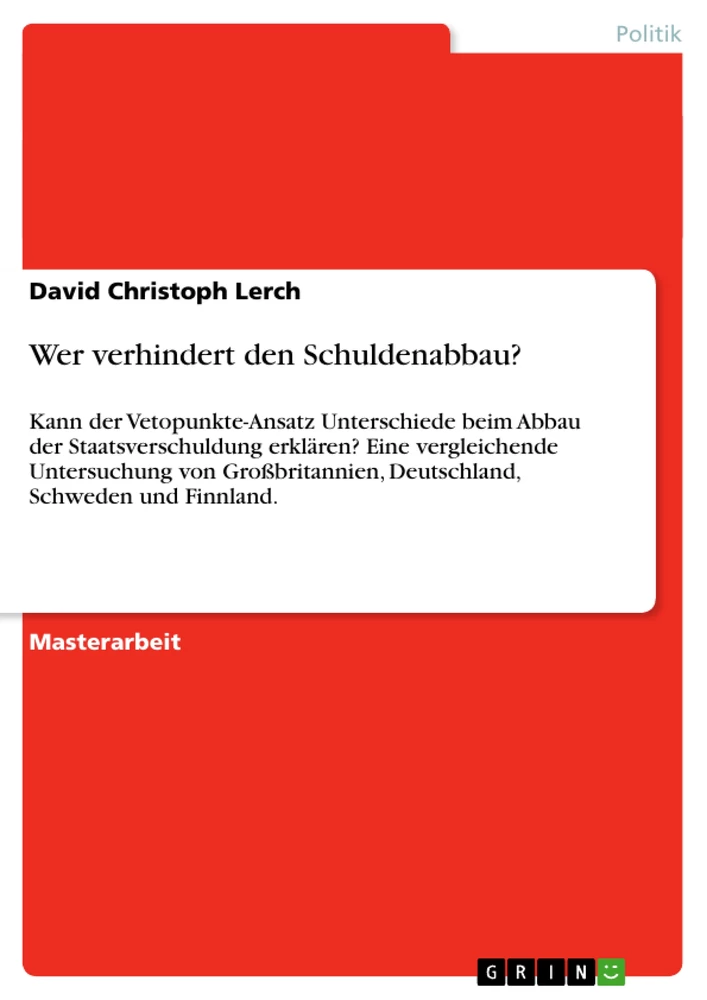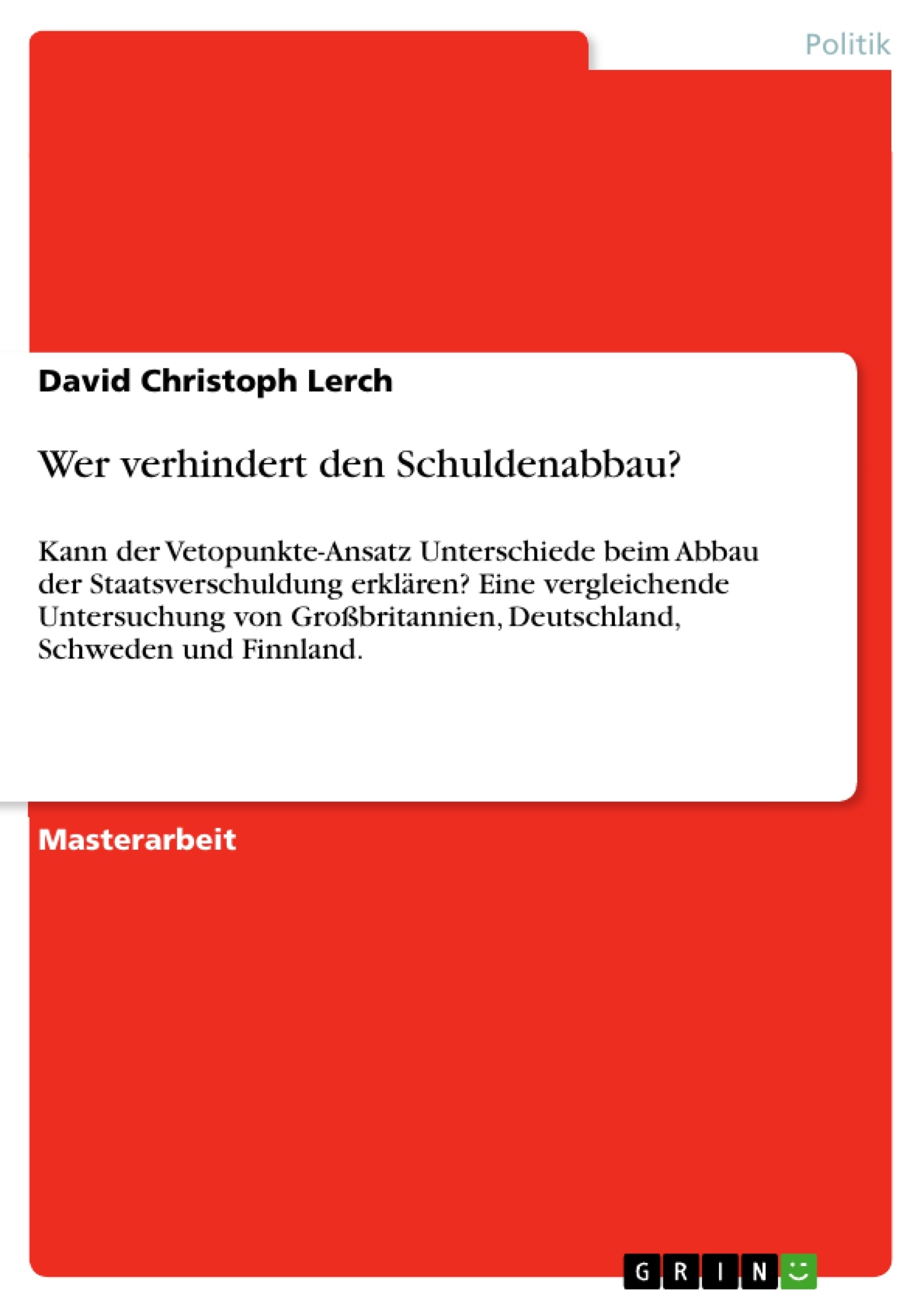„Die Finanzen des Bundes sind in einem desolaten Zustand. So deutlich hat das Eichel vor der Wahl natürlich nie gesagt. Doch er hat einen Haushaltsentwurf für das Jahr 2006 hinterlassen, der nur ein Prädikat verdient: völlig illusorisch“ (Die Zeit, 6.10.2005, S. 27). Der ehemalige Finanzminister ist mit seinem erklärten Ziel gescheitert, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Für seinen Nachfolger sieht es konjunkturell besser aus, dafür muss er sich Forderungen der Ministerien, der Bürger und der EU erwehren. Vor diesem Hintergrund gewinnt die vom Autor gestellte Frage nach dem „kausalen Einfluss von Faktoren“ für die Reduktion von Staatsschulden einen hohen Stellenwert. Was trägt er zur Erreichung dieses ehrgeizigen Ziels bei?
Vorgehensweise und Methode: Der Autor geht in zwei Schritten vor. Im theoretischen Teil führt er zunächst behutsam in das Thema ein und erläutert insbesondere den vergleichenden Ansatz. Vier Länder (Deutschland, Großbritannien, Finnland und Schweden) werden nach dem konkordanzmethodischen Verfahren ausgewählt, das heißt, sie ähneln sich in der sozioökonomischen wie auch in der politisch-institutionellen Struktur, bei letzterer jedoch mit einigen wichtigen Ausnahmen, und zeigen in der abhängigen Variable – nämlich dem Abbau der Staatsschulden – große Unterschiede (Kapitel 1). Woran das liegen könnte, wird in vier Zwischenschritten ausgeführt. Zunächst wird das Politikfeld „Staatsverschuldung“ begrifflich und konzeptionell aufgearbetet, einschließlich des Forschungsstandes. Die letzteren Ursachen könnten insbesondere darin liegen, dass Regierungen möglicherweise trotz guten Willens durch politisch-institutionelle Blockaden daran gehindert werden (Kapitel 2). Darum bietet sich der in den letzten Jahren entwickelte Ansatz der Vetospieler an (Tsebelis), insbesondere in der rafinierten Erweiterung der Theorie der Vetopunkte (Kaiser). Die kompetente Darstellung dieses Ansatzes ist Gegenstand des dritten Kapitels. Das vierte Kapitel dient dazu, kurz aber prägnant die politischen Systeme der Vergleichsländer zu skizzieren. Daran knüpft die Enwicklung der Hypothesen (Kapitel 5) an. Im empirischen Teil wird die Staatsschuldenpolitik der Länder nach den entwickelten Kriterien und Parametern im Zeitraum 1974 bis heute – also für eine Periode von immerhin 30 Jahren – untersucht. Dabei erweist sich das entwickelte Kriterienraster als äußerst hilfreiches Strukturierungs- und Auswertungsmittel des komplexen Politikfeldes.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Einführung und Fragestellung
- 1.2. Forschungsdesign und Forschungsmethodik
- 1.3. Vorgehensweise und Schrittfolge
- 2. Das Politikfeld Staatsverschuldung
- 2.1. Begriffsklärungen und Definitionen
- 2.2. Historische Entwicklung der Staatsverschuldung
- 2.3. Staatsverschuldung in der wissenschaftlichen Diskussion
- 2.4. Funktionen von Staatsverschuldung
- 2.5. Determinanten von Staatsverschuldung
- 2.6. Reduktion von Staatsverschuldung
- 2.7. Haushaltspolitik
- 3. Der Vetopunkte-Ansatz
- 3.1. Institutionalismus in der Politikwissenschaft
- 3.2. Vetopunkte-Ansatz von André Kaiser
- 4. Politische Systeme der Vergleichsländer
- 5. Allgemeiner Teil
- 5.1. Bedingungen und Annahmen
- 5.2. Analysekriterien und Untersuchungsgegenstand
- 5.3. Entwicklung der Hypothesen
- 6. Einordnung der Vergleichsländer
- 6.1. Legislativer und föderaler Raum
- 6.2. Exekutiver Raum
- 7. Abschließender Teil
- 7.1. Zusammenfassung der Ergebnisse
- 7.2. Überprüfung der Hypothesen
- 7.3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss institutioneller Strukturen auf den Abbau von Staatsverschuldung. Sie analysiert, unter welchen Bedingungen und Umständen eine Reduktion von Staatsschulden leichter oder schwerer gelingt. Der Fokus liegt auf einem Vergleich der politischen Systeme von Großbritannien, Deutschland, Schweden und Finnland. Die Ergebnisse sollen Aufschlüsse für die aktuelle haushaltspolitische Debatte in Deutschland liefern.
- Einfluss institutioneller Strukturen auf den Abbau von Staatsverschuldung
- Vergleichende Analyse der politischen Systeme von vier europäischen Ländern
- Bedingungen für eine erfolgreiche Reduktion von Staatsschulden
- Anwendung des Vetopunkte-Ansatzes
- Relevanz für die deutsche Haushaltspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Staatsverschuldung ein, beschreibt seine aktuelle Relevanz, insbesondere im Kontext der Eurozone und des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Sie definiert die Forschungsfrage nach den Faktoren, welche den Abbau von Staatsverschuldung beeinflussen und skizziert das Forschungsdesign, das auf einem Vergleich der politischen Systeme Großbritanniens, Deutschlands, Schwedens und Finnlands basiert. Die Arbeit betont die bisherige Forschungslücke zum Thema Abbau von Staatsverschuldung im Gegensatz zur Entstehung und legt den Fokus auf den Einfluss institutioneller Strukturen.
2. Das Politikfeld Staatsverschuldung: Dieses Kapitel liefert zunächst grundlegende Begriffsklärungen und Definitionen im Zusammenhang mit Staatsverschuldung. Es beleuchtet die historische Entwicklung, die wissenschaftliche Diskussion um Staatsverschuldung und deren Funktionen. Die Kapitel umfassen Determinanten und Möglichkeiten der Reduktion der Staatsverschuldung, sowie deren Bedeutung für die Haushaltspolitik. Es bildet die theoretische Grundlage für die spätere vergleichende Analyse.
3. Der Vetopunkte-Ansatz: Dieses Kapitel stellt den theoretischen Rahmen der Arbeit vor. Es beschreibt den Institutionalismus in der Politikwissenschaft und erläutert den Vetopunkte-Ansatz von André Kaiser, der besagt, dass die Anzahl und die Anordnung der Vetopunkte in einem politischen System den Erfolg von politischen Entscheidungen beeinflussen. Dieser Ansatz dient als analytisches Instrument für den Vergleich der vier untersuchten Länder.
4. Politische Systeme der Vergleichsländer: Dieses Kapitel beschreibt die politischen Systeme der vier Vergleichsländer (Großbritannien, Deutschland, Schweden, Finnland) und analysiert ihre jeweiligen institutionellen Strukturen und Prozesse im Hinblick auf ihre Relevanz für den Abbau von Staatsverschuldung. Es stellt die Grundlage für den darauf folgenden Vergleich dar.
5. Allgemeiner Teil: Der allgemeine Teil spezifiziert die Bedingungen und Annahmen der Studie. Hier werden die Analysekriterien und der Untersuchungsgegenstand präzisiert, sowie die daraus abgeleiteten Hypothesen formuliert, die im weiteren Verlauf der Arbeit überprüft werden.
6. Einordnung der Vergleichsländer: Dieser Abschnitt analysiert die vier untersuchten Länder im Detail, indem er den legislativen, föderalen und exekutiven Raum betrachtet und diese Aspekte im Hinblick auf den Abbau von Staatsverschuldung einordnet. Die Analyse berücksichtigt die jeweiligen institutionellen Besonderheiten der einzelnen Länder.
Schlüsselwörter
Staatsverschuldung, Haushaltspolitik, Vetopunkte-Ansatz, Vergleichende Politikwissenschaft, Institutionalismus, Großbritannien, Deutschland, Schweden, Finnland, Eurozone, Stabilitäts- und Wachstumspakt, ökonomische Politik, institutionelle Strukturen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Einfluss institutioneller Strukturen auf den Abbau von Staatsverschuldung
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss institutioneller Strukturen auf den Abbau von Staatsverschuldung. Im Mittelpunkt steht ein Vergleich der politischen Systeme Großbritanniens, Deutschlands, Schwedens und Finnlands. Ziel ist es, Bedingungen und Umstände zu identifizieren, die den Abbau von Staatsschulden erleichtern oder erschweren.
Welche Forschungsfrage wird bearbeitet?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche institutionellen Strukturen beeinflussen den Erfolg beim Abbau von Staatsverschuldung?
Welche Länder werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die politischen Systeme von Großbritannien, Deutschland, Schweden und Finnland.
Welches theoretische Konzept wird angewendet?
Die Arbeit nutzt den Vetopunkte-Ansatz von André Kaiser als analytisches Instrument. Dieser Ansatz besagt, dass die Anzahl und Anordnung von Vetopunkten in einem politischen System den Erfolg politischer Entscheidungen beeinflussen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Das Politikfeld Staatsverschuldung, Der Vetopunkte-Ansatz, Politische Systeme der Vergleichsländer, Allgemeiner Teil, Einordnung der Vergleichsländer und Abschließender Teil. Die Einleitung beschreibt die Forschungsfrage und Methodik. Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen zum Politikfeld Staatsverschuldung dar. Kapitel 3 erläutert den Vetopunkte-Ansatz. Kapitel 4 beschreibt die politischen Systeme der Vergleichsländer. Kapitel 5 formuliert Hypothesen. Kapitel 6 analysiert die Vergleichsländer im Detail und Kapitel 7 fasst die Ergebnisse zusammen und überprüft die Hypothesen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Staatsverschuldung, Haushaltspolitik, Vetopunkte-Ansatz, Vergleichende Politikwissenschaft, Institutionalismus, Großbritannien, Deutschland, Schweden, Finnland, Eurozone, Stabilitäts- und Wachstumspakt, ökonomische Politik, institutionelle Strukturen.
Welche Relevanz hat die Arbeit?
Die Ergebnisse sollen Aufschlüsse für die aktuelle haushaltspolitische Debatte in Deutschland liefern und die Forschungslücke zum Thema Abbau von Staatsverschuldung schließen.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit folgt einem strukturierten Aufbau mit Einleitung, theoretischem Teil, Ländervergleich, Hypothesenbildung, Analyse und Schlussfolgerung.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse der politischen Systeme der vier ausgewählten Länder, basierend auf dem Vetopunkte-Ansatz.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die detaillierten Ergebnisse und die vollständige Argumentation sind im vollständigen Text der Arbeit enthalten.
- Citar trabajo
- David Christoph Lerch (Autor), 2005, Wer verhindert den Schuldenabbau?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83257