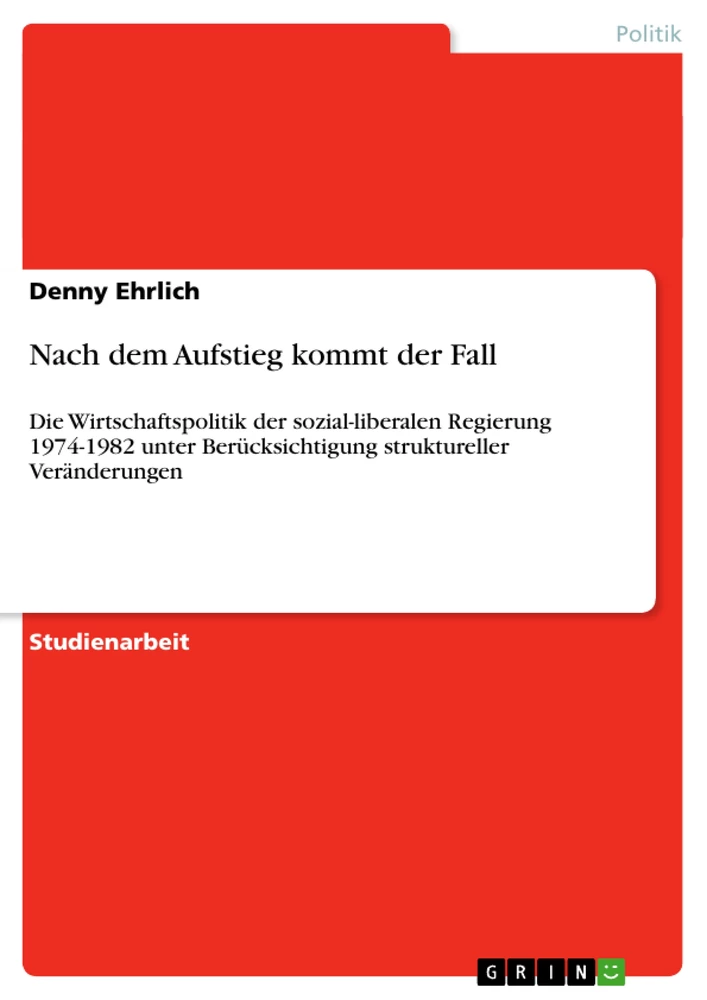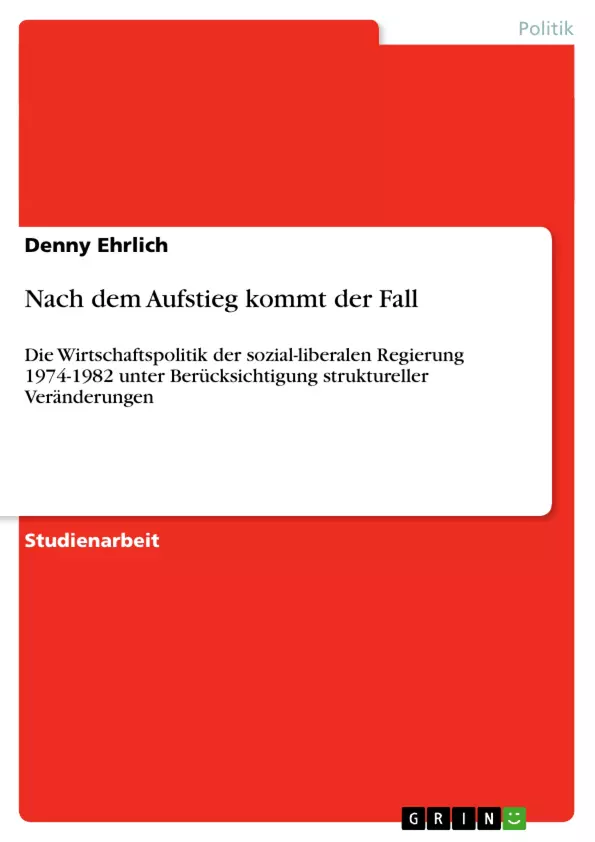„Ohne Investitionen kein Wachstum; ohne Investitionen keine Arbeitsplatzsicherheit, keine höheren Löhne und auch kein sozialer Fortschritt […] Die Haushaltspolitik der Bundesregierung wird im Rahmen des[...]vorliegenden Haushaltsentwurfs 1974 etwaigen übermäßigen Beschäftigungsrisiken in bestimmten Regionen und in bestimmten Branchen entgegenwirken.“(SCHMIDT 1974) Die Antrittsrede Helmut Schmidts am 17. Juni 1974 klang, trotz schlechter wirtschaftlicher Tendenzen zuversichtlich. Als der Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff 1982 mittels seines Thesenpapiers die Scheidungsurkunde der FDP einreicht und damit das Ende der sozialliberalen Koalition besiegelt, sieht die Wirtschaftsbilanz nicht so rosig aus: Die Zahl der Arbeitslosen rückt an die 2-Millionen-Grenze und entspricht einer Arbeitslosenquote von ≈ 8%. Der Anteil des Staatsverbrauchs am BSP ist auf mehr als 20 % gestiegen und der Finanzierungssaldo der öffentlichen Haushalte auf -70 Mrd. DM gesunken.
Die Anzeichen mehrten sich schon seit Beginn der 70er, dass der 2 Jahrzehnte andauernde, wirtschaftliche Boom mit „hohen Wachstumsraten, steigenden Einkommen und niedriger Arbeitslosenziffer“(BÜHRER 2001) langsam zu Ende ging.
Warum es aber in der Amtszeit Helmut Schmitts von 1974 bis 1982 zu solch einem wirtschaftlichen Einbruch gekommen ist, versucht der Verfasser dieses Textes auf den Grund zu gehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Wirtschaftspolitik unter Helmut Schmidt 1974-1982
- Auf dem Weg in die Rezession
- Eine Krise jagt die Nächste - Von Stagflation bis 2. Ölkrise
- Ein kleiner Hoffnungsschimmer - die Erhohlungsphase 1976-79
- Die 2. Ölkrise & Scheidung der Sozial-liberalen Koalition
- Außenwirtschaftliche Bedingungen
- Das „Scheinproblem\" der Außenwirtschaft
- ECU und das vorzeitige Ende der Wirtschafts- und Währungsunion
- Strukturpolitik - Tertiärisierung und höherwertige Technologie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Wirtschaftspolitik der sozialliberalen Regierung in Deutschland von 1974 bis 1982 unter Helmut Schmidt. Er untersucht die Ursachen des wirtschaftlichen Abschwungs in dieser Zeit und analysiert die politischen Maßnahmen, die zur Bewältigung der Krise ergriffen wurden. Außerdem werden strukturelle Veränderungen, die während dieser Periode stattgefunden haben, betrachtet.
- Die Folgen der ersten Ölkrise für die deutsche Wirtschaft
- Die Rolle der Geldpolitik und der Globalsteuerung im Kontext der Stagflation
- Die Auswirkungen der Tarifpolitik auf die Investitionstätigkeit und die Konjunktur
- Die Auswirkungen der zweiten Ölkrise auf die Koalitionsregierung
- Die Bedeutung der strukturellen Veränderungen, insbesondere der Tertiärisierung und der Einführung höherwertiger Technologien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den historischen Kontext des wirtschaftlichen Abschwungs in Deutschland von 1974 bis 1982 dar. Sie beleuchtet die anfänglichen Hoffnungen auf wirtschaftliches Wachstum und die politischen Herausforderungen, die die Regierung unter Helmut Schmidt zu bewältigen hatte. Die Einleitung führt außerdem die zentralen Forschungsfragen und die chronologische Struktur der Arbeit ein.
2. Die Wirtschaftspolitik unter Helmut Schmidt 1974-1982
2.1. Auf dem Weg in die Rezession
Dieser Abschnitt untersucht die Auswirkungen der ersten Ölkrise auf die deutsche Wirtschaft. Er analysiert die Rolle der Ölpreissteigerungen, die Inflation und die restriktive Geldpolitik der Bundesbank. Außerdem werden die Tarifabschlüsse der Gewerkschaften und ihre Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit der Unternehmen diskutiert.
2.2. Eine Krise jagt die Nächste - Von Stagflation bis 2. Ölkrise
In diesem Abschnitt wird die Rezession von 1975 betrachtet. Er analysiert die Ursachen für den wirtschaftlichen Einbruch, insbesondere die anhaltenden Auswirkungen der Ölpreiskrise, die Fehler der Tarifparteien und die ungenügende wissenschaftliche Prognosefähigkeit.
3. Außenwirtschaftliche Bedingungen
3.1. Das „Scheinproblem\" der Außenwirtschaft
Dieser Abschnitt diskutiert die Bedeutung der Außenwirtschaft im Kontext der wirtschaftlichen Entwicklung in den 1970er Jahren. Er analysiert die Herausforderungen, die sich aus der internationalen Vernetzung der deutschen Wirtschaft ergeben, insbesondere im Hinblick auf die Ölpreise und die Wechselkurse.
3.2. ECU und das vorzeitige Ende der Wirtschafts- und Währungsunion
Dieser Abschnitt befasst sich mit den Bemühungen um die Schaffung einer europäischen Währungsunion und analysiert die Rolle des ECU in diesem Prozess. Er untersucht die Herausforderungen und die Gründe für das vorzeitige Scheitern des Projekts.
4. Strukturpolitik - Tertiärisierung und höherwertige Technologie
Dieser Abschnitt analysiert die Bedeutung der Strukturpolitik in den 1970er Jahren. Er untersucht die Auswirkungen der Tertiärisierung der Wirtschaft und die Einführung höherwertiger Technologien auf den Arbeitsmarkt und die Produktivität.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Wirtschaftspolitik, sozialliberale Koalition, Helmut Schmidt, Ölkrise, Stagflation, Globalsteuerung, Geldpolitik, Tarifpolitik, Investitionstätigkeit, Arbeitslosigkeit, Strukturpolitik, Tertiärisierung, Technologie, Außenwirtschaft.
Häufig gestellte Fragen
Warum endete der wirtschaftliche Boom in den 1970er Jahren?
Der Boom endete durch eine Kombination aus der ersten Ölkrise, steigender Inflation (Stagflation) und strukturellen Problemen in der deutschen Wirtschaft.
Welche wirtschaftlichen Herausforderungen prägten die Amtszeit von Helmut Schmidt?
Schmidts Amtszeit war geprägt von zwei Ölkrisen, einer hohen Arbeitslosenquote (nahe 8%), steigender Staatsverschuldung und der Stagflation.
Was versteht man unter Stagflation?
Stagflation bezeichnet das gleichzeitige Auftreten von wirtschaftlicher Stagnation (geringes Wachstum) und Inflation (Geldentwertung).
Wie wirkte sich die zweite Ölkrise auf die Politik aus?
Die zweite Ölkrise verschärfte die wirtschaftlichen Spannungen so stark, dass sie letztlich zum Ende der sozialliberalen Koalition im Jahr 1982 beitrug.
Was war das Ziel der Strukturpolitik in dieser Zeit?
Die Strukturpolitik zielte auf die Tertiärisierung (Ausbau des Dienstleistungssektors) und die Förderung höherwertiger Technologien ab, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
- Citation du texte
- Denny Ehrlich (Auteur), 2007, Nach dem Aufstieg kommt der Fall, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83130