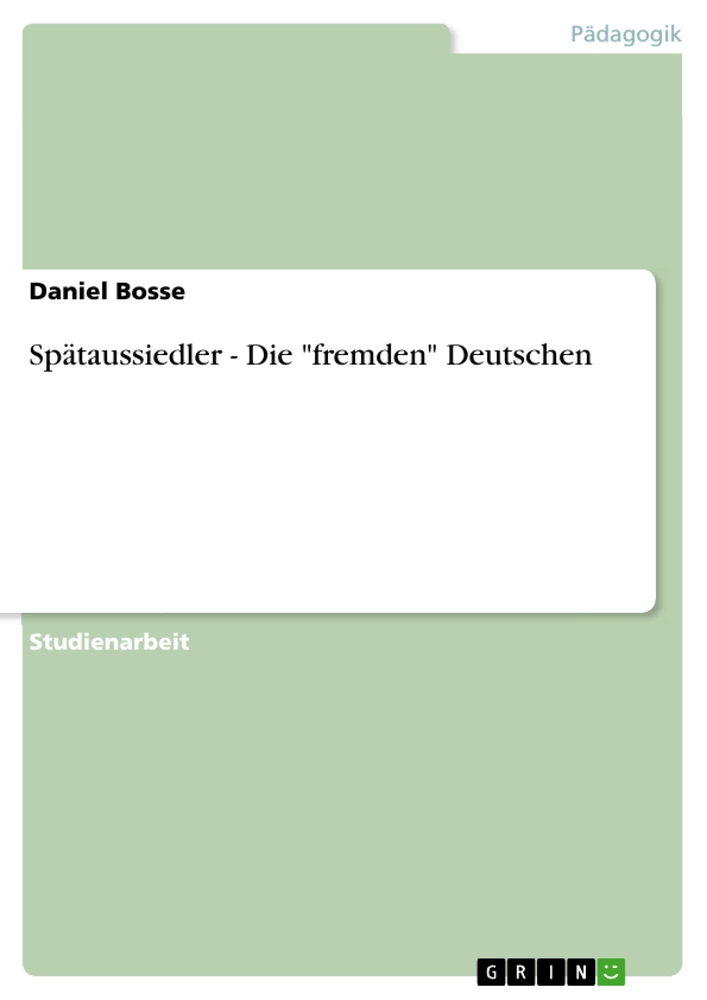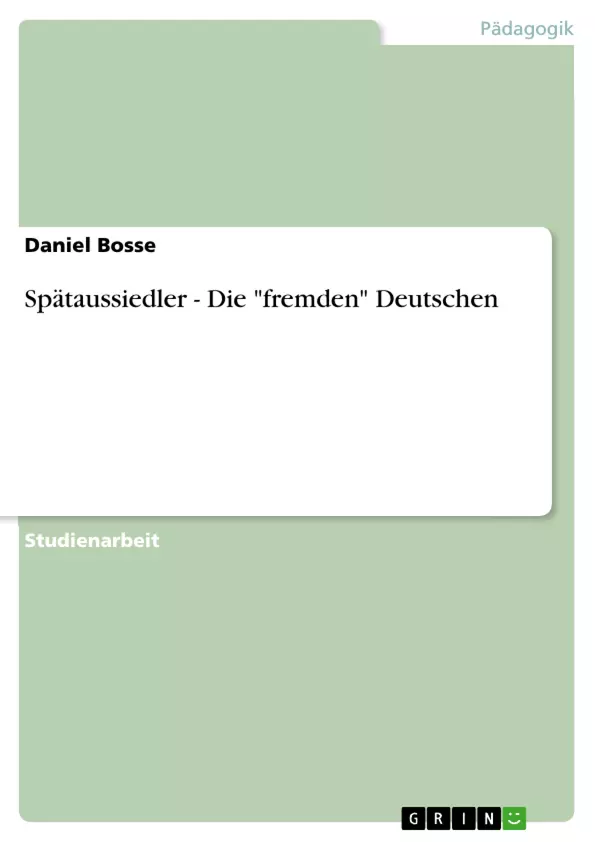Seit dem Fall der Mauer und der zuvor einsetzenden Perestroika in der ehemaligen Sowjetunion kam es zu einem enormen Schub der Zuwanderungen von Deutschen aus Osteuropa und Asien. Diese Menschen werden von der deutschen Mehrheitsgesellschaft als Spätaussiedler bezeichnet. Zu Beginn der Einwanderung in den 50ziger Jahren wurden diese Menschen mit offenen Armen empfangen, jedoch wendete sich die Einstellung der „Einheimischen“ in den 90ziger Jahren zu einer ablehnenden Haltung. Auch werden die Spätaussiedler von den hier lebenden Migranten nicht-deutscher Abstammung als Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt sowie im Bereich der sozialstaatlichen Zuwendungen betrachtet. Die Ungleichbehandlung von hier lebenden Migranten gegenüber Spätaussiedlern stößt auf Missverständnis, da diese bereits kurz nach ihrer Übersiedlung alle politischen und sozialen Rechte genießen können, wobei die hier bereits in der 3. Generation lebenden Zugewanderten auf ihre Anerkennung durch das politische System der Bundesrepublik noch immer warten. Ferner verbindet man mit Spätaussiedlern oft einen hohen Alkohol- und Drogenkonsum und eine überdurchschnittlichen Kriminalität sowie die Meinung, dass sie nur Nutznießer des deutschen Wohlfahrtsstaates sind bzw. dass sie nur aufgrund der schlechten ökonomischen Situation in ihrer alten „Heimat“ in die Bundesrepublik Deutschland gekommen sind.
In der öffentlichen Diskussion gewinnt der Begriff „Partizipation“ verstärkt an Bedeutung und jeder einzelne wird aufgefordert, sich am politischen und gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Dabei wird oft außer Acht gelassen, dass vor allem Menschen mit Migrationshintergrund diese Teilnahme oft verwehrt bzw. durch entsprechende Defizite kaum ermöglicht wird. Zu diesen Defiziten wird der viel zitierte Mangel an sprachlicher Kompetenz und die daraus resultierende mangelnde Integrationsbereitschaft sowie die soziale Lage der Migranten gezählt. Integration wird dabei nach Meinung des Autors oft als Assimilation begriffen, welche die vollständige Anpassung von Zugewanderten an die Aufnahmegesellschaft und die Negierung ihrer eigenen Kultur und ihrer Herkunftsidentität beinhaltet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen
- Interkulturelle Pädagogik
- Wahrnehmung von Spätaussiedlern
- Geschichte der Deutschen in Russland
- Die Anfänge der Besiedlung
- Die Entwicklung der Kolonien
- Der Zweite Weltkrieg und die Auswirkungen
- Situation der Spätaussiedler in Sachsen-Anhalt
- Schlußfolgerungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Problematik von Spätaussiedlern in Sachsen-Anhalt. Sie untersucht die historische Entwicklung der Deutschen in Russland, insbesondere die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf diese Gruppe. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen, die Spätaussiedler nach ihrer Einwanderung in Deutschland bewältigen müssen, und auf dem Beitrag, den interkulturelle Pädagogik zur erfolgreichen Integration leisten kann. Die Arbeit beleuchtet dabei die Konstruktion des Fremdenbildes „Russe“ und dessen Einfluss auf die Wahrnehmung von Spätaussiedlern.
- Die Geschichte der Deutschen in Russland und die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs
- Die Herausforderungen der Spätaussiedler in Deutschland
- Die Rolle der interkulturellen Pädagogik bei der Integration von Migranten
- Die Konstruktion des Fremdenbildes „Russe“ und dessen Einfluss auf die Wahrnehmung von Spätaussiedlern
- Die Bedeutung von Partizipation und sprachlicher Kompetenz für die Integration von Migranten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Spätaussiedler in Sachsen-Anhalt ein und skizziert die Problematik der Einwanderung von Deutschen aus Osteuropa und Asien nach dem Fall der Mauer. Sie beleuchtet die unterschiedliche Wahrnehmung von Spätaussiedlern in der deutschen Mehrheitsgesellschaft und die Herausforderungen, die sie im Alltag bewältigen müssen. Der Autor geht auf die Bedeutung von Partizipation für die Integration von Migranten ein und kritisiert die oft fehlende Anerkennung ihrer kulturellen Identität.
Theoretischer Rahmen
Dieses Kapitel stellt den theoretischen Rahmen der Arbeit vor, indem es auf die interkulturelle Pädagogik und die Wahrnehmung von Spätaussiedlern eingeht. Der Autor diskutiert die Bedeutung von Sprache und Kommunikation für die Integration von Migranten und kritisiert die oft als Assimilation verstandene Integrationspolitik.
Geschichte der Deutschen in Russland
Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der Deutschen in Russland, beginnend mit den Anfängen der Besiedlung und der Entwicklung der Kolonien. Der Autor schildert die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die Lebensbedingungen der Russlanddeutschen und die schwierige Situation, in der sie sich nach dem Krieg wiederfanden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themenschwerpunkte dieser Arbeit sind: Spätaussiedler, Russlanddeutsche, Interkulturelle Pädagogik, Integration, Partizipation, Fremdenbild, Migration, Mehrheitsgesellschaft, Deutschland, Sachsen-Anhalt.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind Spätaussiedler?
Spätaussiedler sind Zuwanderer deutscher Abstammung, die vor allem nach dem Fall der Mauer aus Osteuropa und Zentralasien (z.B. ehemalige Sowjetunion) nach Deutschland gekommen sind.
Wie hat sich die Wahrnehmung von Spätaussiedlern verändert?
In den 50er Jahren wurden sie oft mit offenen Armen empfangen, während sich die Haltung in den 90er Jahren teilweise in Ablehnung und Vorurteile (z.B. Kriminalität, Drogenkonsum) wandelte.
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Assimilation?
Assimilation verlangt die vollständige Anpassung und Aufgabe der eigenen Herkunftsidentität, während Integration die Partizipation bei gleichzeitiger Anerkennung der kulturellen Identität bedeuten sollte.
Welche Rolle spielt die interkulturelle Pädagogik?
Sie soll helfen, Vorurteile abzubauen und die sprachliche sowie gesellschaftliche Partizipation von Migranten zu fördern, ohne deren kulturelle Wurzeln zu negieren.
Welche historischen Ereignisse prägten die Russlanddeutschen?
Besonders der Zweite Weltkrieg und die darauffolgenden schwierigen Lebensbedingungen in der Sowjetunion hatten massive Auswirkungen auf die Geschichte und Identität dieser Gruppe.
- Citation du texte
- Daniel Bosse (Auteur), 2005, Spätaussiedler - Die "fremden" Deutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82930