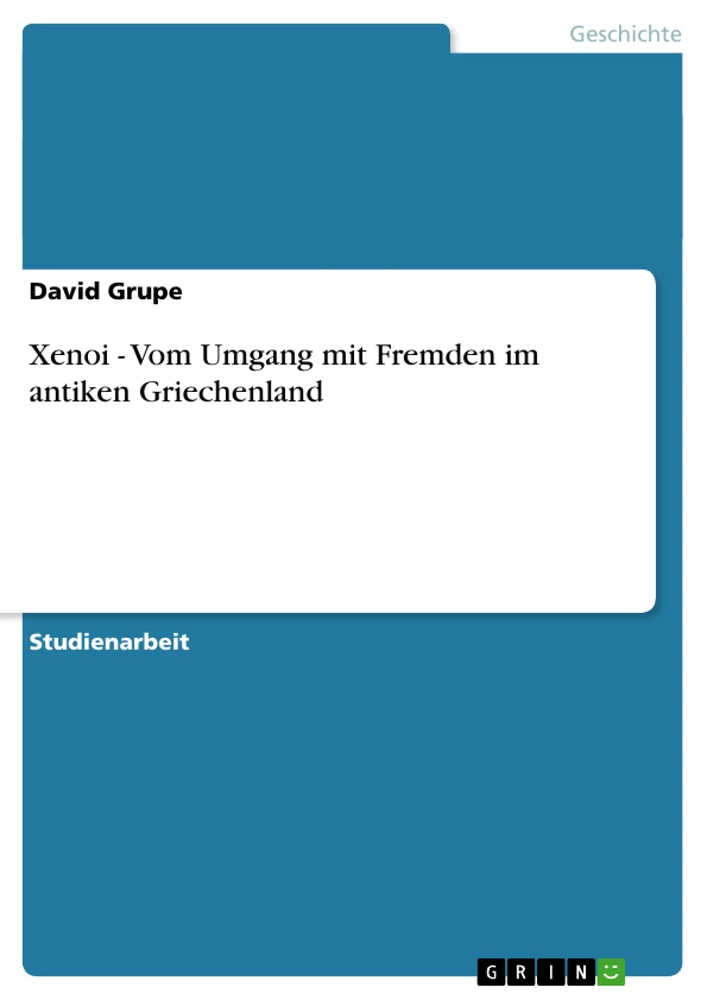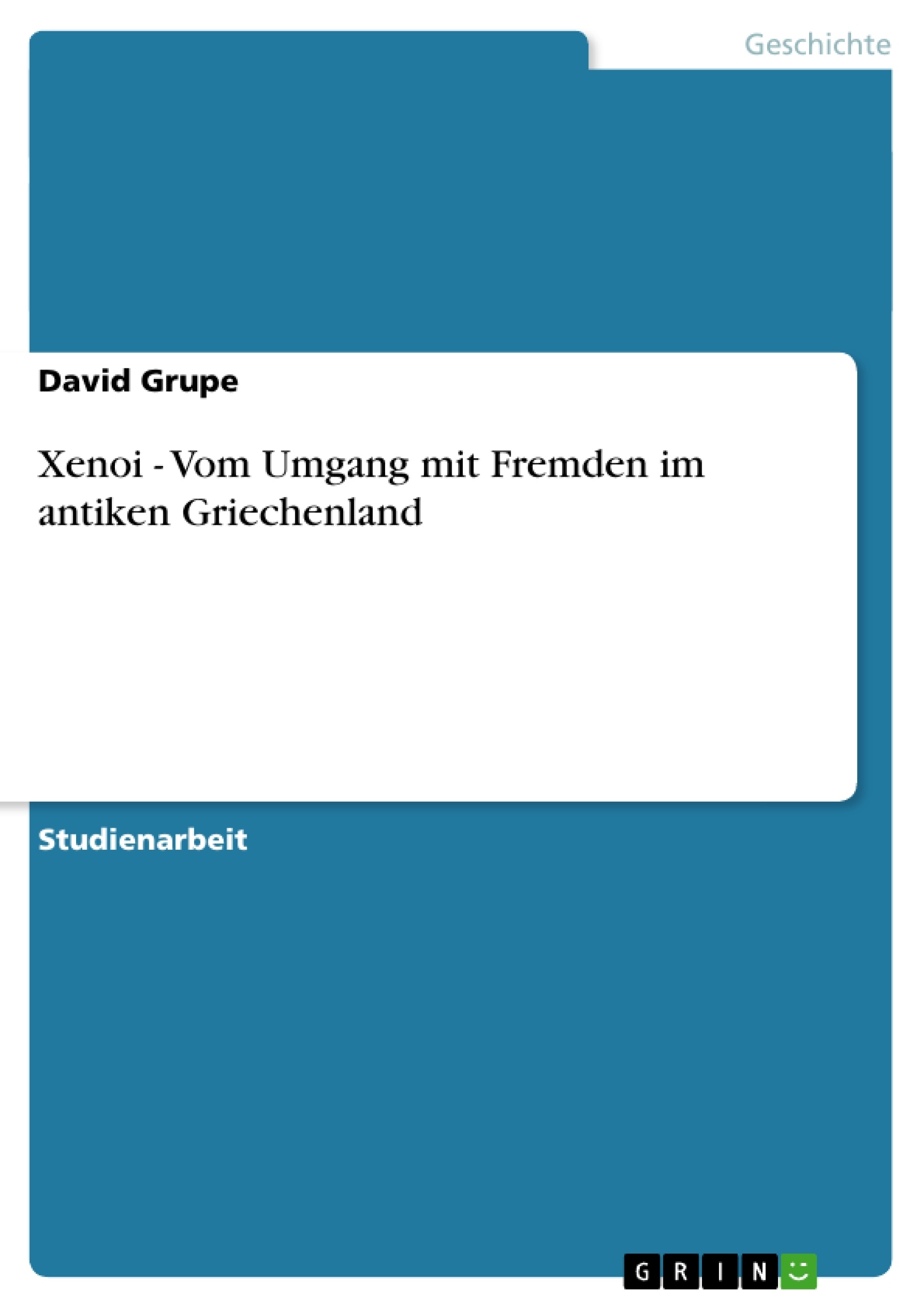Der Wahrnehmung des Fremden kommt eine besondere Rolle zu: Sie gibt Aufschluss über die Selbstwahrnehmung und trägt wesentlich zur Selbstbestimmung des Wahrnehmenden, zur Konstruktion seiner eigenen Identität bei. Dabei können die Reaktionen von selbstzufriedener Isolation gegenüber dem Fremden bis hin zur gewaltsamen Exklusion des Fremden reichen. Der bzw. das Fremde kann aber ebenso integriert werden, er/es wird dann zum Bestandteil der eigenen Identität. Im Vergleich mit dem Fremden können die eigenen Schwächen und Stärken in ein helleres Licht gerückt werden.
Um ein passendes Selbstbild der Griechen zu erhalten, ist es aufschlussreich, zu untersuchen, wie sich die Griechen Fremden gegenüber verhalten haben. Im griechischen Leben des 4. und 5. Jahrhunderts v.C. war Fremdes allgegenwärtig: Die Polizei Athens bestand aus skythischen Staatssklaven, besonders in Adelskreisen war ausländische Namensgebung beliebt, Heiratsverbindungen mit ausländischen Häuptlingsfamilien waren bei reichen Athenern nicht nur wegen der wirtschaftliche Interessen beliebt. Auch Perikles´ Gesetz, das Bürgerrecht Athens an athenische Abkunft von Vater und Mutter zu knüpfen entsprang wohl nicht der Fremdenfeindlichkeit, sondern kann als demokrati-sche Maßnahme gegen die auswärtig verschwägerte Oberschicht gedeutet werden.
Doch war das Verhältnis zwischen Griechen und Fremden wirklich unproblematisch? So zeigt ein Vasenbild aus der Zeit um 500 v.C., wie der große Griechenheld Herakles mit einer Meute schwächlicher Ägypter umspringt und ihren König bestraft. Dieses Bild kann als unmissverständliches Zeugnis griechischen Überlegenheitsgefühls gedeutet werden.
Es stellt sich die Frage, wie die Griechen die Fremden gesehen haben, wie sind Fremde und Griechen miteinander umgegangen? Wie war es um Gastfreundschaft bestellt, wurden Gastrechte missbraucht? Stand eher die Angst vor Fremden, die Xenophobie, im Vordergrund oder lässt sich ein bereits ritualisiertes Vertrautsein mit Jedermann, die Philoxenie, nachweisen?
Verlauf der Arbeit:
Um Antworten auf diese Fragestellungen zu finden, werden zunächst die Begriffe Xenoi, Barbaren und Metöken voneinander abgegrenzt und erläutert. Aus den Historien des Herodot werden Geschichten und Anekdoten aufgezeigt, die Hinweise auf den Umgang mit Fremden im antiken Griechenland geben. Es geht um die Behandlung von Fremden, den Umgang mit Gastrecht und Beispiele für den Missbrauch der Gastfreundschaft.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Philoxenie im antiken Griechenland?
- 2 Fremde, Xenoi, Metöken und Barbaren
- 3 Xenoi bei Herodot
- 3.1 Herodots „Historien“
- 3.2 Umgang mit „Fremdlingen“ bei Herodot
- 4 Schlussbetrachtung: Xenophobie oder Philoxenie?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Verhältnis der antiken Griechen zu Fremden. Ziel ist es, die verschiedenen Kategorien von Fremden (Xenoi, Metöken, Barbaren) zu definieren und anhand von Beispielen aus Herodots Historien zu analysieren, wie die Griechen mit diesen Fremden umgegangen sind. Die Arbeit beleuchtet dabei die Ambivalenz zwischen Philoxenie (Gastfreundschaft) und Xenophobie (Fremdenfeindlichkeit).
- Definition und Unterscheidung verschiedener Kategorien von Fremden im antiken Griechenland
- Der Umgang mit Fremden in Herodots Historien
- Gastfreundschaft und ihre Missachtung im antiken Griechenland
- Die Entwicklung des Begriffs „Barbar“ und dessen Bedeutung
- Analyse der griechischen Selbstwahrnehmung im Kontext der Begegnung mit Fremden
Zusammenfassung der Kapitel
1 Philoxenie im antiken Griechenland?: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Frage nach dem Verhältnis der Griechen zu Fremden. Es wird die Bedeutung der Wahrnehmung des Fremden für die Konstruktion der eigenen Identität hervorgehoben. Anhand von Beispielen wie der Zusammensetzung der athenischen Polizei aus skythischen Sklaven oder Heiratsverbindungen mit ausländischen Familien wird die Allgegenwärtigkeit des Fremden im griechischen Leben des 4. und 5. Jahrhunderts v. Chr. verdeutlicht. Gleichzeitig wird aber auch ein Beispiel für ein griechisches Überlegenheitsgefühl, dargestellt in einem Vasenbild, präsentiert, welches die Ambivalenz des Verhältnisses von Griechen zu Fremden aufzeigt und somit die Forschungsfrage einleitet.
2 Fremde, Xenoi, Metöken und Barbaren: Dieses Kapitel differenziert zwischen verschiedenen Kategorien von Fremden im antiken Griechenland. Es werden die Begriffe Xenoi (mit der Doppelbedeutung von Fremder und Gastfreund), Metöken (Fremde, die sich dauerhaft niedergelassen haben) und Barbaren (Nicht-Griechen) definiert und ihre jeweiligen Rechte und sozialen Positionen erläutert. Besonderes Augenmerk wird auf die Metöken in Athen gelegt, die zwar einen hohen sozialen Status erreichen konnten, aber von politischen Rechten weitgehend ausgeschlossen blieben. Das Kapitel beschreibt auch die Rolle nicht-griechischer Sklaven, insbesondere der Skythen, in der athenischen Gesellschaft und thematisiert die ursprüngliche wertneutrale Bedeutung des Begriffs „Barbar“, bevor er im Laufe des 5. Jahrhunderts eine negative Konnotation erhielt.
Schlüsselwörter
Xenoi, Metöken, Barbaren, Philoxenie, Xenophobie, Herodot, Historien, antikes Griechenland, Gastfreundschaft, Fremdenfeindlichkeit, griechische Identität, Selbstwahrnehmung, Perserkriege.
Häufig gestellte Fragen: Hausarbeit "Philoxenie im antiken Griechenland?"
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das Verhältnis der antiken Griechen zu Fremden. Sie analysiert die verschiedenen Kategorien von Fremden (Xenoi, Metöken, Barbaren) und deren Behandlung anhand von Beispielen aus Herodots Historien. Ein zentraler Fokus liegt auf der Ambivalenz zwischen Philoxenie (Gastfreundschaft) und Xenophobie (Fremdenfeindlichkeit).
Welche Kategorien von Fremden werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen Xenoi (Fremde und Gäste), Metöken (dauerhaft niedergelassene Fremde) und Barbaren (Nicht-Griechen). Es werden die jeweiligen Rechte und sozialen Positionen dieser Gruppen erläutert, insbesondere die der Metöken in Athen und die Rolle nicht-griechischer Sklaven.
Welche Rolle spielt Herodot in der Hausarbeit?
Herodots Historien dienen als Hauptquelle für die Analyse des Umgangs der Griechen mit Fremden. Die Arbeit untersucht konkrete Beispiele aus den Historien, um die verschiedenen Facetten des griechisch-fremden Verhältnisses zu beleuchten.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die Arbeit untersucht, wie die antiken Griechen Fremde wahrnahmen und kategorisierten. Sie beleuchtet, wie sich diese Wahrnehmung auf den Umgang mit Fremden auswirkte und inwieweit Gastfreundschaft und Fremdenfeindlichkeit koexistierten. Ein weiterer Fokus liegt auf der Bedeutung des Fremden für die Konstruktion der griechischen Identität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Hausarbeit beinhaltet Kapitel zu Philoxenie im antiken Griechenland, den unterschiedlichen Kategorien von Fremden (Xenoi, Metöken, Barbaren), einer detaillierten Analyse des Umgangs mit Fremden bei Herodot und einer abschließenden Betrachtung der Ambivalenz zwischen Xenophobie und Philoxenie.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt die Ambivalenz des Verhältnisses der antiken Griechen zu Fremden auf. Es wird deutlich, dass Gastfreundschaft (Philoxenie) und Fremdenfeindlichkeit (Xenophobie) parallel existierten und dass die Wahrnehmung des Fremden maßgeblich zur Konstruktion der griechischen Identität beitrug. Die Bedeutung des Begriffs "Barbar" und seine Entwicklung von einer ursprünglich wertneutralen zu einer negativen Konnotation wird ebenfalls analysiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Xenoi, Metöken, Barbaren, Philoxenie, Xenophobie, Herodot, Historien, antikes Griechenland, Gastfreundschaft, Fremdenfeindlichkeit, griechische Identität, Selbstwahrnehmung, Perserkriege.
- Quote paper
- David Grupe (Author), 2007, Xenoi - Vom Umgang mit Fremden im antiken Griechenland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82843