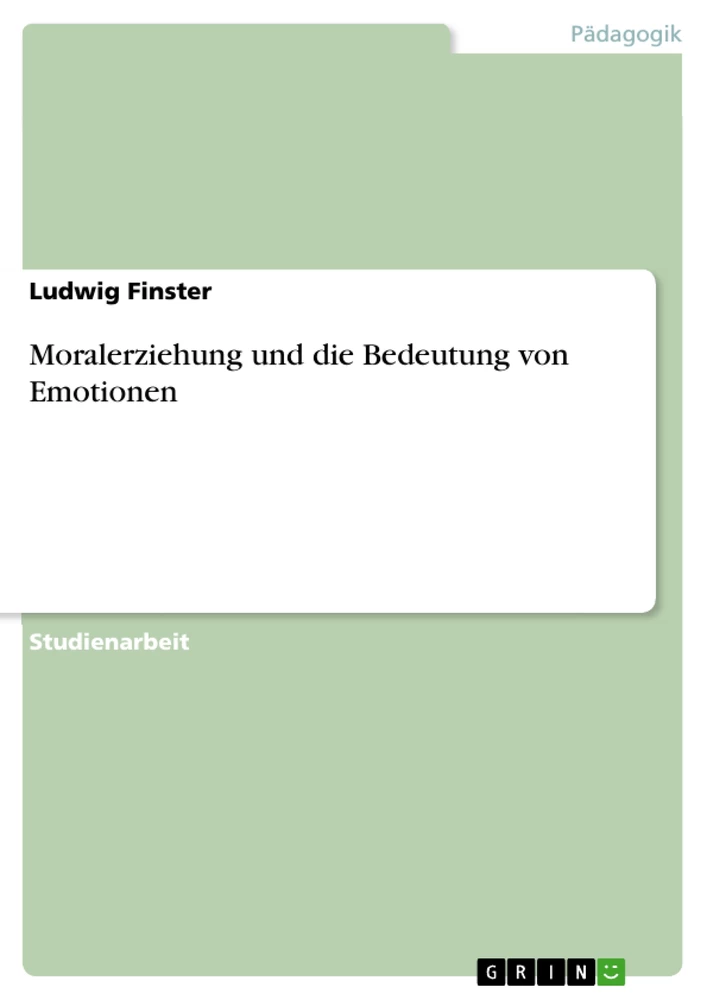Die Welt bringt jeden Tag neue Verfehlungen hervor.
Dieser Anschein drängt sich zumindest beim Betrachten der – mittlerweile rund um die Uhr verfügbaren – Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Showbusiness oder auch Sport auf. So mancher Geschäftsführer bereichert sich auf Kosten seines eigenen Unternehmens und wiederum einige Manager finden nicht nur an den Kurven ihres DAX-Unternehmens Gefallen. Eine Besenkammergeschichte hier, eine öffentliche Schlammschlacht da – und Berge radelt man auch schon lange nicht mehr nur durch Training und etwas Traubenzucker hoch. – Die so genannten „unmoralischen Angebote“ stehen offensichtlich hoch im Kurs. Und dabei bin ich an dieser Stelle noch nicht einmal eingehend auf – zum Teil leider alltäglich (gewordenes) – kriminelles Handeln eingegangen.
Ein großer Teil dieser – meinen genannten Beispielen ähnlichen – Vorkommnisse fällt wahrscheinlich schlicht in den Bereich „Klatsch und Tratsch“. Und um einen weiteren Teil hüllt sich der berühmte „Mantel des Schweigens“, so dass nur wenige wichtige Themen wirklich ernsthaft dargestellt und diskutiert werden (können).
Ich möchte und kann diese Beispiele ebenfalls nicht auseinander nehmen, auch weil mir zu viele Hintergründe und Informationen einfach nicht bekannt sind und sein können. Aber ich würde im Folgenden gern der Frage nachgehen, woher die regelmäßigen öffentlichen Aufschreie rühren und auf was sie sich gründen. Was bedeutet also überhaupt „moralisch“ oder „unmoralisch“? Wie lässt sich „Moral“ – trotz anscheinend weniger werdenden Vorbildern – erzieherisch weitergeben und welche Rolle spielen dabei die Emotionen, welche doch täglich auf uns einwirken und manches Mal (zu spät) aufrütteln? Was können Emotionen bei der moralischen Erziehung überhaupt bewirken?
Bevor ich zu den eigentlichen Hauptfeldern meiner Hausarbeit komme, möchte ich zunächst für diese Hausarbeit und auch zu meinem eigenen Verständnis den Begriff „Moral“ oder auch „Moralität“ (vgl. Maier 1986, S. 13) abstecken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Betrachtung und Klärung wichtiger Begriffe
- Einleitung
- Was also ist Moral? – Ein Definitionsversuch
- Zum Verhältnis von Moral und (emotionaler) Erziehung
- Der Einfluss von Emotionen in der Moralerziehung
- Was versteht man eigentlich unter „Emotionen“?
- Zur Bedeutung von Emotionen in der Moralerziehung
- Darstellung der Theorie – Psychologische Hintergründe
- Emotionen und Moralerziehung – Der psychologische Zugang nach Goleman
- Pädagogische Relevanz von Golemans Zugang – Beispiele aus der Praxis
- Emotionen und Moralerziehung – Das „Zwei-Aspekte-Modell“ nach Lind
- Theoriedarstellung
- Pädagogische Konsequenzen
- Kritische Schlussbetrachtung der beiden vorgestellten Ansätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Bedeutung von Emotionen in der Moralerziehung. Die Arbeit untersucht, wie Emotionen das moralische Erziehen und Bilden beeinflussen und welche Rolle sie in der Vermittlung von Werten und Normen spielen. Ziel ist es, die Wechselwirkung zwischen Emotionen und Moral zu beleuchten und die Relevanz von emotionalen Faktoren im pädagogischen Kontext zu verdeutlichen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Moral“
- Bedeutung und Einfluss von Emotionen in der Moralerziehung
- Analyse verschiedener Theorien zum Verhältnis von Emotionen und Moral
- Pädagogische Konsequenzen aus den theoretischen Ansätzen
- Die Rolle von Emotionen im Kontext des moralischen Urteilens und Handelns
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird der Begriff „Moral“ definiert und verschiedene Deutungen des Begriffs dargestellt. Das Kapitel beleuchtet den komplexen und vielschichtigen Charakter von Moral und zeigt die Schwierigkeit auf, eine einheitliche Definition zu finden.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Verhältnis von Moral und (emotionaler) Erziehung. Es wird die Frage untersucht, wie sich Emotionen auf die Vermittlung von moralischen Werten und Normen auswirken und welche Rolle sie im Erziehungs- und Bildungsprozess spielen.
Schlüsselwörter
Moralerziehung, Emotionen, Moral, Werte, Normen, Emotionale Intelligenz, Psychologische Ansätze, Pädagogische Praxis, Zwei-Aspekte-Modell, Handlungskompetenz, Prosoziale Kompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Emotionen in der Moralerziehung?
Die Arbeit untersucht, wie Emotionen das moralische Urteilen und Handeln beeinflussen und welche Bedeutung sie für die Vermittlung von Werten und Normen haben.
Was versteht Daniel Goleman unter emotionaler Intelligenz in der Erziehung?
Golemans Ansatz betont, dass emotionale Kompetenzen die Basis für moralisches Verhalten bilden; die Arbeit diskutiert die pädagogische Relevanz dieses Zugangs.
Was ist das „Zwei-Aspekte-Modell“ nach Georg Lind?
Linds Modell trennt moralische Orientierungen (Werte) von der moralischen Urteilskompetenz (Fähigkeit) und analysiert deren Zusammenspiel im Erziehungsprozess.
Warum ist eine Definition von „Moral“ so schwierig?
Moral ist ein vielschichtiger Begriff; die Arbeit zeigt verschiedene Deutungen auf und versucht eine Abgrenzung für den pädagogischen Kontext.
Können Emotionen „unmoralisches“ Verhalten verhindern?
Es wird untersucht, ob Emotionen wie Empathie oder Scham als „Wächter“ fungieren können, die Individuen vor kriminellem oder unmoralischem Handeln bewahren.
- Citation du texte
- Ludwig Finster (Auteur), 2007, Moralerziehung und die Bedeutung von Emotionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82794