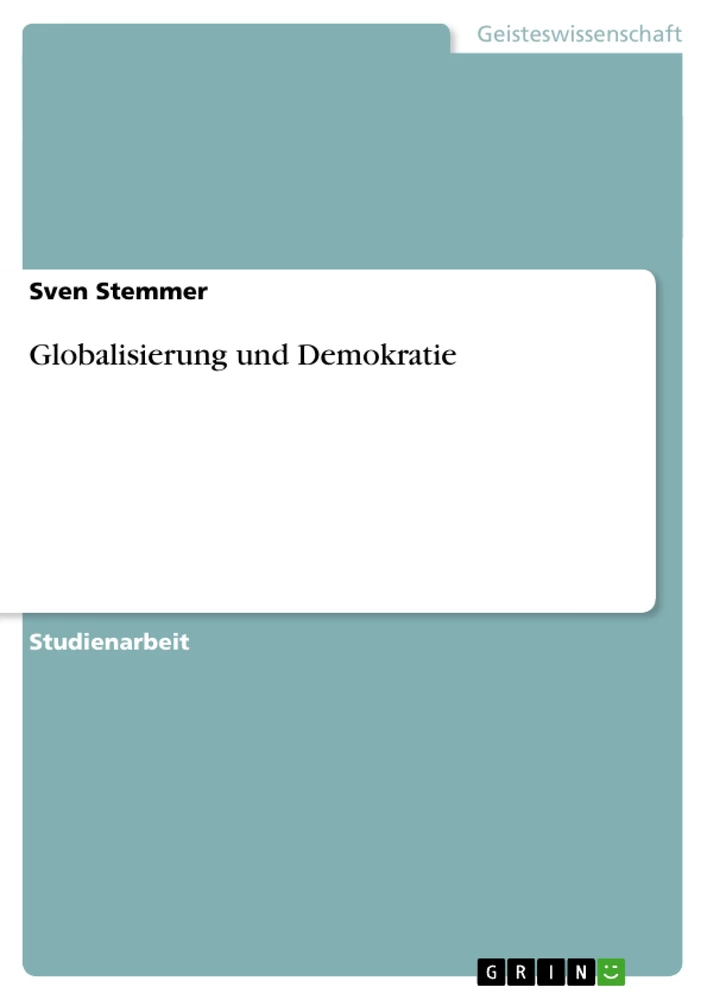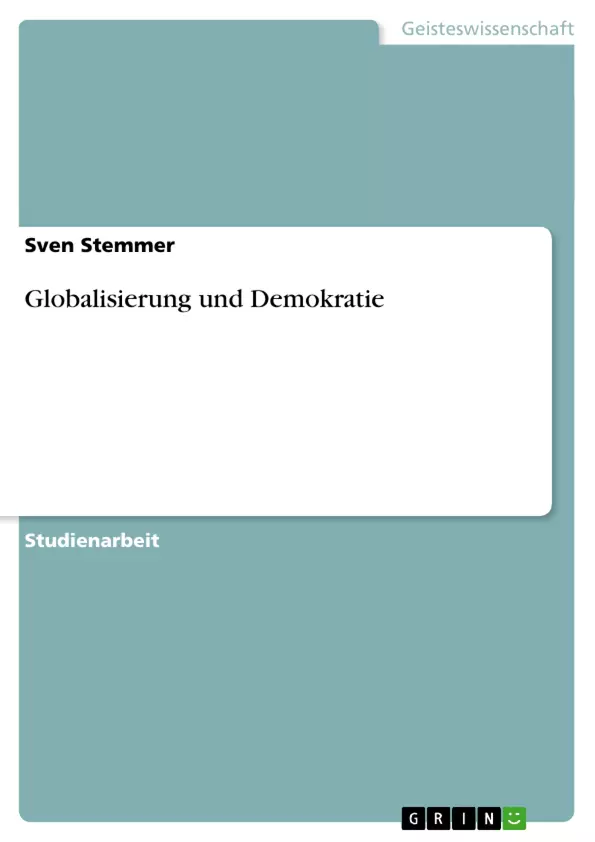Zu dem Konzept der Globalisierung hat sich seit den siebziger Jahren ein unüberschaubares Feld an Literatur entwickelt, das sich aus einer ungeheuren Vielzahl von Perspektiven und Interessen mit dem Phänomen ‚Globalisierung’ beschäftigt. Diese Vielzahl an Perspektiven ist gleichbedeutend mit einer Vielzahl von Ansichten davon, was unter diesem Phänomen zu verstehen sei. Von einem deutlich abgesteckten Begriff der ‚Globalisierung’, an dem sich klar festmachen läst, worüber man mit diesem Wort redet, kann nicht gesprochen werden. Dieses Wort wird von Politikern und Journalisten als Schlagwort verwendet, als Chiffre für die oft beschworenen Sachzwänge. Ein ungeklärter und somit kaum verstandener, diffuser Sachverhalt. Ebenso diffus sind auch die Ängste und Hoffnungen, die sich an die Globalisierung knüpfen. Man ist gemeinhin der Ansicht, daß der Großteil des sozialen Lebens durch globale Prozesse bestimmt wird.
Die großen Hoffnungen der einen gehen Hand in Hand mit den schlimmsten Befürchtungen derjenigen, die glauben, daß jenseits des Nationalstaates keine demokratische Öffentlichkeit existiert und keine demokratischen Kontrollverfahren zur Verfügung stehen. Neben der Angst vor Entdemokratisierung und dem Gefühl des Kontrollverlustes, herrsche nach dieser Perspektive ohne den ordnenden, für Recht und Gesetz einstehenden staatlichen Rahmen, Bürgerkrieg zwischen verschiedenen ethnischen Clans. In der Liberalisierung des Marktes sei vor allem ein entfesselter Kapitalismus zu erkennen, der zu einer Ausbreitung der Armut und einer Verelendung der Massen führe.
Zwischen totaler Emanzipation und Freiheit des Individuums auf der einen Seite und Herrschaft anonymer Kapitalmächte und Bürgerkriegszuständen auf der anderen Seite spielen sich die Zukunftsprognosen ab.
Aber was ist unter ‚Globalisierung’ genau zu verstehen? Gibt es die Globalisierung, so wie sie verstanden wird, tatsächlich oder lassen sich die mit ihr erklärten Phänomen auch anders deuten? Und gibt es Hoffnung auf demokratische Kontrolle ihrer Gefahren? Diese Fragen versuche ich im Folgenden zu klären, indem ich zunächst den Begriff ‚Globalisierung’ erläutere, und ihn mit einem alternativen Erklärungsansatz für die gegenwärtige wirtschaftlichen und sozialen Prozesse vergleiche.
Inhaltsverzeichnis
- Ein schwer fassbarer Begriff, diffuse Hoffnungen und Ängste
- Begriffsklärung - was ist Globalisierung
- Eine entfesselte Wirtschaft? – Globale oder internationale Ökonomie?
- Die globale Ökonomie
- Die internationale Ökonomie
- Ist der gegenwärtige Zustand etwas Neues?
- Weltvergesellschaftung – sozial statt national?
- Die Nationalgrenze – eine willkürliche, künstliche Setzung?
- Bedeutung transnationaler, sozialer Bindungen
- Entgrenzung der Staaten?
- Bedeutungsverlust oder Funktionswandel der Grenze?
- Neugeschaffene Grenzen
- Angleichung durch Sprachpolitik
- Die Schweiz, ein taugliches Modell?
- Vielsprachigkeit und transnationale Orientierung
- Wert der Vielfalt - Sprachpolitik in der EU
- Demokratieaspekte
- Demokratieformen
- Minderheitenschutz und Mehrheitsvotum
- Soziale Aspekte
- Autoritärer Kapitalismus als Herausforderung, 'von oben'
- Kontrollverlust der Politik
- Individueller Kontrollverlust
- Autoritäre Orientierung als Herausforderung, 'von unten'
- Populismus
- Trotz alledem - Hoffnungen der Mehrebenenpolitik
- Regionalisierung
- Planungszellen - repräsentative Bürgerbeteiligung
- Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Konzept der Globalisierung im Kontext der Demokratie. Sie untersucht die Auswirkungen der Globalisierung auf die nationale Grenzen, die Rolle des Staates und die Herausforderungen für demokratische Prozesse. Die Arbeit hinterfragt, ob die Globalisierung zu einer Entgrenzung der Staaten führt und welche Konsequenzen dies für die demokratische Ordnung hat.
- Begriffsklärung und Definition von Globalisierung
- Analyse der wirtschaftlichen Dimensionen der Globalisierung (globale vs. internationale Ökonomie)
- Bedeutung transnationaler sozialer Bindungen und die Frage der Weltvergesellschaftung
- Herausforderungen für die Demokratie durch Globalisierung (z. B. Kontrollverlust, Populismus)
- Potenzial und Grenzen demokratischer Kontrolle in der globalisierten Welt
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem komplexen und vielschichtigen Konzept der Globalisierung. Es beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven und die damit verbundenen Hoffnungen und Ängste. Das zweite Kapitel analysiert den Begriff Globalisierung und stellt verschiedene Merkmale heraus, die als Aspekte der Globalisierung angesehen werden können. Im dritten Kapitel wird die Frage der entfesselten Wirtschaft beleuchtet, indem die globale und die internationale Ökonomie miteinander verglichen werden. Die Rolle transnationaler Korporationen (TNCs) und die Auswirkungen der Globalisierung auf den Arbeitsmarkt werden dabei untersucht. Das vierte Kapitel widmet sich dem Thema der Weltvergesellschaftung und der Bedeutung transnationaler, sozialer Bindungen. Im fünften Kapitel wird die Frage der Entgrenzung der Staaten und der Bedeutung bzw. des Funktionswandels nationaler Grenzen diskutiert. Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, wie Sprachpolitik zur Angleichung beitragen kann, am Beispiel der Schweiz und der EU. Im siebten Kapitel werden Demokratieaspekte im Kontext der Globalisierung beleuchtet, mit Fokus auf Demokratieformen, Minderheitenschutz und soziale Aspekte. Die Kapitel acht und neun widmen sich den Herausforderungen für die Demokratie, sowohl durch den autoritären Kapitalismus ('von oben') als auch durch autoritäre Orientierung ('von unten'), insbesondere durch Populismus. Das zehnte Kapitel stellt schließlich Hoffnungen der Mehrebenenpolitik in den Vordergrund, insbesondere durch Regionalisierung und Bürgerbeteiligung.
Schlüsselwörter
Globalisierung, Demokratie, Nationalstaat, Grenzen, Wirtschaft, TNCs, Weltvergesellschaftung, Sprachpolitik, Populismus, Mehrebenenpolitik, Bürgerbeteiligung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen globaler und internationaler Ökonomie?
Die Arbeit untersucht, ob die Wirtschaft heute tatsächlich grenzenlos (global) agiert oder ob es sich primär um eine verstärkte Verflechtung zwischen Nationalstaaten (international) handelt.
Führt Globalisierung zum Kontrollverlust der Politik?
Die Arbeit analysiert die Angst vor Entdemokratisierung und die Frage, ob Nationalstaaten gegenüber anonymen Kapitalmächten an Steuerungskraft verlieren.
Welche Rolle spielt die Sprachpolitik in der EU?
Sprachpolitik wird als Mittel zur Angleichung und Förderung transnationaler Orientierung betrachtet, wobei die Schweiz oft als Modell für Vielsprachigkeit dient.
Was versteht man unter „autoritärem Kapitalismus“?
Dies beschreibt eine Herausforderung „von oben“, bei der wirtschaftliche Sachzwänge demokratische Entscheidungsprozesse unterwandern oder aushebeln.
Gibt es Ansätze für mehr Bürgerbeteiligung in der Globalisierung?
Ja, die Arbeit nennt unter anderem Regionalisierung und „Planungszellen“ als Modelle für repräsentative Bürgerbeteiligung in einer komplexen Mehrebenenpolitik.
- Citar trabajo
- M.A. Sven Stemmer (Autor), 2002, Globalisierung und Demokratie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82478