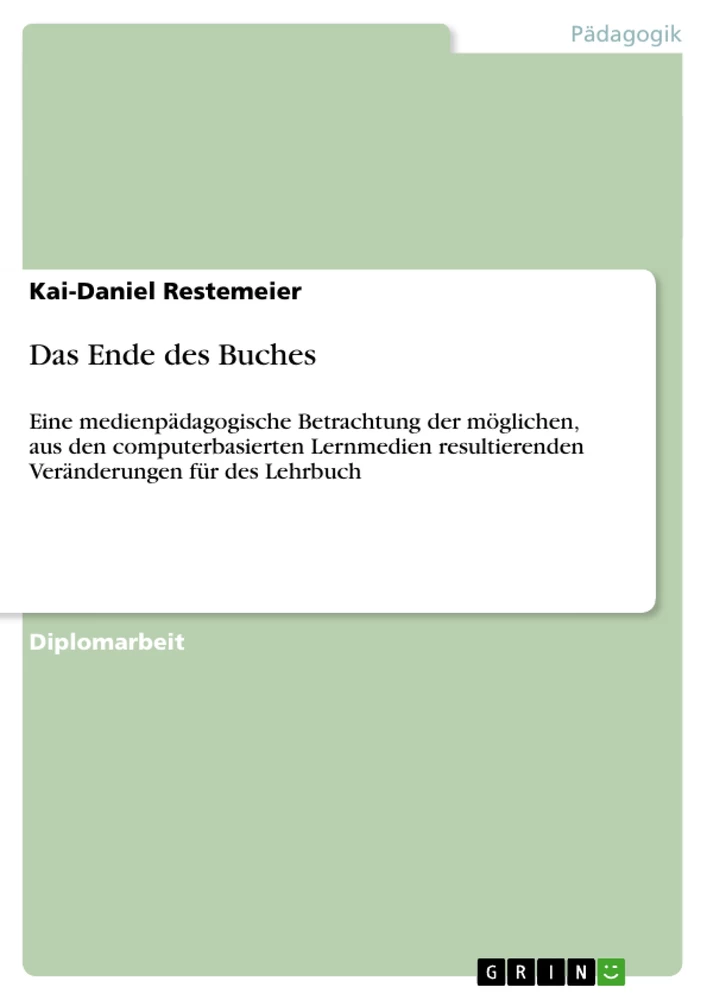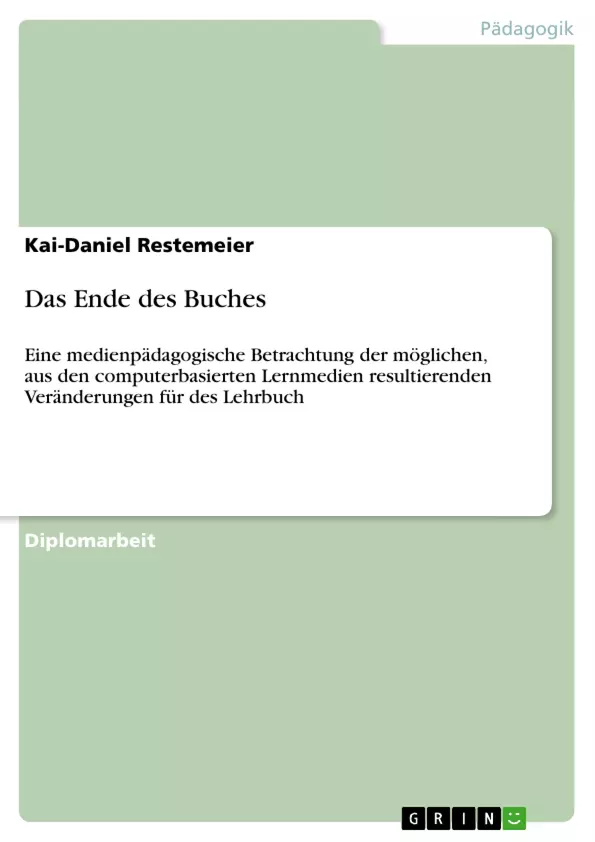In weiten Teilen der Gesellschaft herrscht eine positive Einstellung gegenüber Neuen Medien. Beinahe könnte man von einer Euphorie sprechen. Über Internet und Computer lassen sich Prozesse vereinfachen, lassen sich Wege verkürzen, lässt sich Zeit sparen. Mit den neuen Technologien ist zweifellos ein gewaltiges Potenzial verbunden: Im Computer können Schrift, Tonaufzeichnungen, Bilder und audiovisuelle Informationen dargestellt werden. Außerdem können neben solchen Informationen, die aufgezeichnet und zur Bearbeitung an den Computer übertragen werden, vollkommen neue Inhalte generiert werden. Als weiterer Vorteil ist der flexible Zugriff auf die im Computer gespeicherten und strukturierten Informationen zu nennen. Inhalte, die im Buch linear aneinandergereiht sind, können am Computer je nach Bedarf und Interesse abgerufen werden, bieten Erklärungen, wo sie nötig sind. Über das Internet erschließen sich zudem neuartige und zeitsparende Mittel zur Kommunikation zwischen Einzelpersonen oder Gruppen. Die vielfältigen Möglichkeiten des Computers bieten daher einen hohen Anreiz für dessen Verwendung.
Ob diese reizvollen Optionen dem Lehrbuch seinen Stellenwert nehmen oder es gar vollständig von der Bildfläche verdrängen können, ist die zentrale Frage, die in dieser Arbeit beantwortet werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffe und Definitionen
- Lehrbuch
- computerbasierte Lernumgebungen
- Medienkritik als Phänomen
- Kritik am Buch
- Die Auswirkungen des Fernsehens auf das Leseverhalten
- Lesemüdigkeit
- Kritik an der Medienkritik
- Mediennutzung
- Modelle des Leseprozesses
- Grundbegriffe des Leseprozesses
- Lesen am Bildschirm
- Rezeption von Bildern
- Kombination von Bild und Text
- Bildtypologie nach Pöggeler
- Nutzung von Multimedia-Inhalten
- Gestaltungsprinzipien nach Varesi
- Gestaltungsprinzipien nach Mayer
- Modelle des Leseprozesses
- Mediendidaktik
- Aufgabe des Lernmediums
- Lerntheoretische Grundlagen
- Behavioristisches Lernmodell
- Kognitivistisches Lernmodell
- Konstruktivistisches Lernmodell
- Didaktischer Aufbau von Lehrbüchern
- Allgemeine Kriterien zur Lehrbuchgestaltung
- Erstellung von Lehrtexten
- Zulassungskriterien für Schulbücher
- Lehrbuchtypen
- Schullesebücher
- Lehr- und Übungsbücher
- Ratgeber und allgemeine Lehrbücher
- Nachschlagewerke
- Sonstige
- Didaktischer Aufbau computerbasierter Lernumgebungen
- Programme zur Instruktion
- Tutorielle Systeme
- Intelligente Tutorielle Systeme
- Computerspiele
- Programme zur Darstellung von Inhalten
- Hypertext und Hypermedien
- WIKIs
- Simulationen
- Programme zur Produktion von Inhalten
- Programme zur Kommunikation
- synchrone Online-Kommunikation
- Chat/Messenger
- Online-Telefonie- und Videokonferenzen
- MUDs
- asynchrone Online-Kommunikation
- Diskussionsforen
- synchrone Online-Kommunikation
- Programmkombinationen zu Lernzwecken
- Lernplattformen
- Unentdeckte Nutzungsmöglichkeiten
- Programme zur Instruktion
- Wird das Lehrbuch von computerbasierten Lernprogrammen verdrängt?
- Vergleich der Eigenschaften
- Vorteile des Lehrbuchs
- Nachteile des Lehrbuchs
- Vorteile von CBL
- Nachteile von CBL
- Zukunftsprognosen
- Ausschluss-Szenario
- Koexistenz-Szenario
- Zusammenspiel-Szenario
- Konvergenz-Szenario
- Vergleich der Eigenschaften
- Abschließende Worte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die möglichen Veränderungen für das Lehrbuch, die aus computerbasierten Lernmedien resultieren. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob das Lehrbuch durch den Computer vollständig verdrängt werden könnte.
- Medienkritik und die Entwicklung von neuen Medien
- Mediennutzung und die Rezeption von Text- und Bildinformationen
- Didaktische Gestaltung von Lehrbüchern und computerbasierten Lernumgebungen
- Vergleich der Eigenschaften von Lehrbüchern und CBL
- Zukunftsprognosen für die Entwicklung und Verwendung von Lernmedien
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt die zentrale Fragestellung der Arbeit ein und benennt die wichtigsten Themenbereiche.
- Kapitel 2 definiert die Begriffe Lehrbuch und computerbasierte Lernumgebungen, die im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht werden.
- Kapitel 3 behandelt die Medienkritik und diskutiert die traditionellen Befürchtungen über negative Medienwirkungen auf Kinder und Jugendliche.
- Kapitel 4 untersucht die Mediennutzung und widmet sich den Aspekten der Textrezeption und der Bildrezeption, wobei die Besonderheiten des Lesens am Bildschirm hervorgehoben werden.
- Kapitel 5 geht auf die Mediendidaktik ein und präsentiert verschiedene Lerntheorien, die für die Gestaltung von Lernmedien relevant sind. Außerdem werden didaktische Kriterien für die Gestaltung von Lehrbüchern und computerbasierten Lernumgebungen dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Medienpädagogik und den Auswirkungen neuer Medien auf das traditionelle Lernmedium Lehrbuch. Besondere Themenschwerpunkte liegen auf dem Vergleich der Eigenschaften von Lehrbüchern und computerbasierten Lernumgebungen, den Möglichkeiten und Grenzen der Medienkritik, sowie den verschiedenen Modellen und Theorien des Lernens und der Wissensvermittlung.
Häufig gestellte Fragen zur Zukunft des Lehrbuchs
Wird das digitale Lernen das klassische Lehrbuch verdrängen?
Die Arbeit untersucht verschiedene Szenarien: vom vollständigen Ausschluss des Lehrbuchs bis hin zur Koexistenz oder Konvergenz (Verschmelzung) beider Medien.
Was sind die Vorteile von computerbasierten Lernumgebungen (CBL)?
CBL bietet flexiblen Zugriff, die Kombination von Ton, Bild und Video sowie interaktive Elemente wie Simulationen und Wikis, die lineares Lernen aufbrechen.
Gibt es Nachteile beim Lesen am Bildschirm?
Untersuchungen zum Leseprozess zeigen, dass die Konzentration am Bildschirm oft geringer ist und die haptische Erfahrung des Buches für die Wissensverankerung fehlen kann.
Welche Lerntheorien sind für digitale Medien relevant?
Wichtige Modelle sind der Behaviorismus (Instruktion), Kognitivismus (Informationsverarbeitung) und Konstruktivismus (selbstgesteuertes Lernen).
Was ist Mediendidaktik?
Mediendidaktik befasst sich mit der Gestaltung von Lernmedien, um den Lehr- und Lernprozess optimal zu unterstützen, sei es durch Text-Bild-Kombinationen oder tutorielle Systeme.
- Arbeit zitieren
- Diplom-Pädagoge Kai-Daniel Restemeier (Autor:in), 2007, Das Ende des Buches, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80969