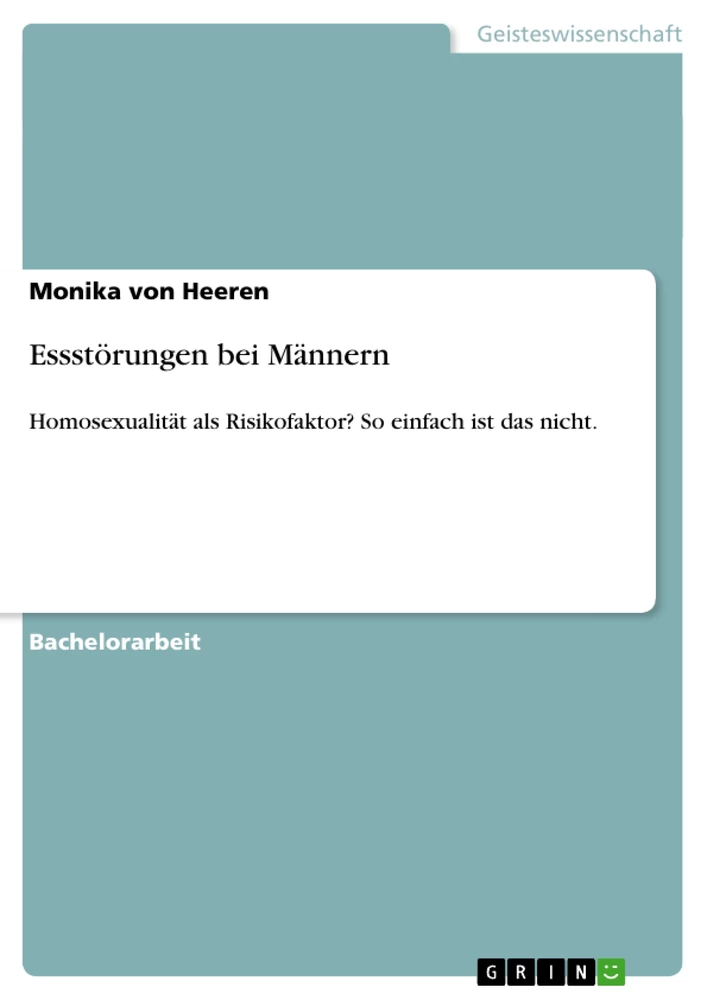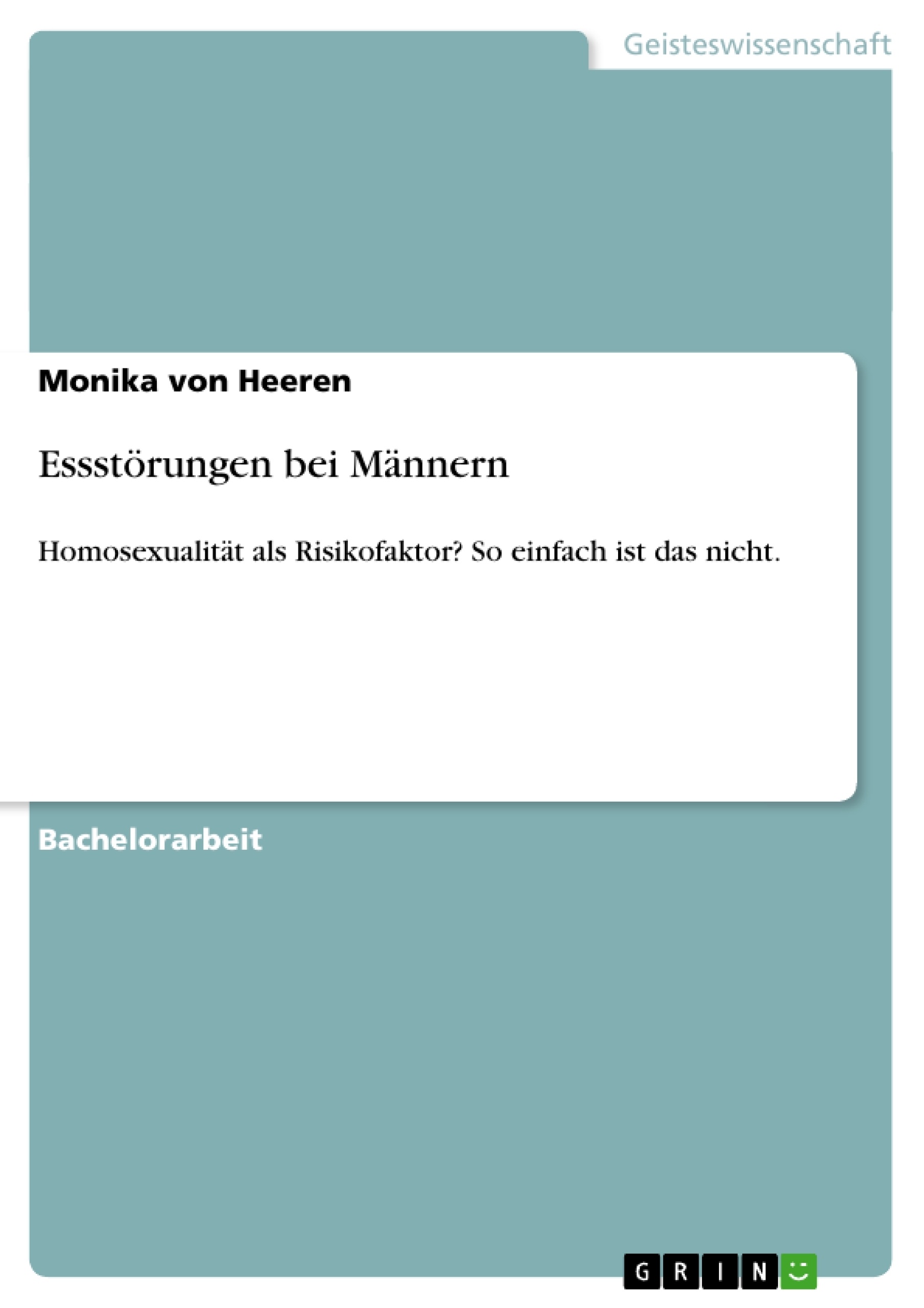Homosexualität gilt unter Männern als spezifischer Risikofaktor für die Entwicklung
einer Essstörung. Dennoch sind drei von vier Männern mit einer Essstörung
heterosexuell veranlagt. Ein weiterer Risikofaktor stellt die soziale Geschlechterrolle
dar. Darunter werden Attribute verstanden, welche von der Gesellschaft als typisch
weiblich oder männlich empfunden werden. Seit einigen Jahrzehnten besteht der
Trend, die Rollenverteilung der Geschlechter aufzuweichen, mit der Erwartung, dass
beide Geschlechter Attribute beider Seiten in sich vereinen. Dadurch ausgelöste
Identifikationsprobleme und Verunsicherungen führen zu anhaltend emotionalem
Stress. Laut Studien trifft die Verunsicherung vor allem homosexuell veranlagte
Männer mit starker femininer und gleichzeitig schwacher maskuliner Orientierung.
Im Weiteren neigen Männer mit Essproblemen zu Essattacken, welche als
maladaptive Bewältigungsstrategien eingesetzt werden um starke, unerwünschte
Emotionen zu regulieren. Inwieweit androgyne Erwartungen bei Männer mit
einseitiger Rollenorientierung zu einer maladaptiven Emotionsregulation wie
Essattacken führen und welche Bedingungen diese Entwicklung unterstützen, muss in
weiteren Studien angegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Essstörung beim Mann
2.1. Symptome
2.2. Vorkommen der Männer in den Subgruppen der Essstörungen
2.3. Zusammenfassung
3. Sexuelle Orientierung: Homosexualität als Risikofaktor
3.1. Sexuelle Orientierung unter Männern mit Störungen im Essverhalten
3.2. Zusammenfassung
4. Rollenorientierung: Feminität als Risikofaktor?
4.1. Feminität und Maskulinität
4.1.1. Eine Dimension versus zwei Dimensionen
4.1.2. Wandel in Richtung Androgynie
4.2. Rollenorientierung unter Männern mit Essstörung
4.2.1. Rollenorientierung unter Heterosexuellen
4.2.2. Rollenorientierung unter Homosexuellen
4.3. Gesellschaft: die soziale Rolle des Mannes im Wandel
4.3.1. Traditionelle Rollenbilder werden aufgerüttelt
4.3.2. Emotionalität
4.4. Zusammenfassung
5. Essattacken, eine Antwort auf sozialen Druck?
5.1. Essattacken und die Fähigkeit der Emotionsregulation
5.1.1. Essen und Stressoren
5.1.2. Zwei Modelle zur Funktion von Essattacken (und Erbrechen):
5.2. Zusammenfassung
6. Diskussion
1. Einleitung
Essstörung bei Männern: Früher eine ‚feminine’ Krankheit unter Homosexuellen - heute ein Zeichen der Verunsicherung des heterosexuellen Mannes? Essstörungen werden heute nicht mehr als eine weibliche Krankheit bezeichnet, denn die enorme Zunahme von Inzidenzfällen bei Männern in den letzten 50 Jahren lässt von dieser Behauptung abweichen (Polivy & Herman, 2002). Dennoch handelt es sich um ein Thema, das in der Gesellschaft noch weitgehend einen Tabustatus innehat. Essstörungen bei Männern werden weniger klar und weniger schnell erkannt als bei Frauen. Als Einstieg ins Thema beleuchte ich die klinischen Symptome von Männern mit Essstörungen und ihre Verteilung in den Subgruppen. Ein Vergleich mit Frauen zeigt, ob Männer an den gleichen Symptomen leiden, wie sie bei Frauen bekannt sind. Aktuell liegen zu Essproblemen bei Männern zu wenige Studien vor, als dass diese Arbeit gänzlich ohne den Einbezug von Studien an Frauen auskommen kann.
Auf der Suche nach einem Erklärungsansatz für die Zunahme der Inzidenzfälle bei Männern ergründe ich den Einfluss zweier Faktoren. Einerseits die sexuelle Orientierung und andererseits die soziale Geschlechterrolle. Beides sind Faktoren, deren Status von gesellschaftlichen Werten geprägt ist.
Der dritte Teil der Arbeit widmet sich dem Faktor der sexuellen Orientierung und dem Auftreten von Essproblemen. Homosexuelle Männer gelten in der Literatur als Risikogruppe für die Entwicklung einer Esspathologie. Die Literatur bietet unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten. Homosexuelle würden einerseits mehr Wert auf Figur und Gewicht legen als Heterosexuelle und andererseits seien sie als marginalisierte Gruppe grösserem gesellschaftlichem Druck ausgesetzt. Tatsächlich sind Homosexuelle unter Männern mit Essstörungen um das Vielfache stärker vertreten als in der Normalbevölkerung (Williamson, 1999). Homosexualität gilt empirisch als Risikofaktor bestätigt, dennoch nehmen Essprobleme ebenso unter heterosexuellen Männern zu. Interessant ist, ob die Zunahme in den letzten Dekaden vor allem unter Homosexuellen erfolgte, oder eher unter Heterosexuellen. Trifft der zweite Fall ein, werden Veränderungen im zukünftigen Forschungsfokus nahe gelegt.
Der vierte Teil untersucht den Einfluss der Geschlechterrolle auf die Vulnerabilität für Essprobleme. Ein Fokus auf die maskuline oder feminine Rollenorientierung von Individuen und ihren Stellenwert in der Gesellschaft erweitert das Verständnis der Funktion der Essstörung. Die Gesellschaft ordnet feminine Attribute den Frauen und maskuline Attribute den Männern zu. Feminität und Maskulinität schliessen sich in einer zweidimensionalen Sicht gegenseitig nicht aus. Ein Individuum kann somit beide Attribute in sich vereinen. Bei Frauen wurde ein Zusammenhang von Essproblemen mit einseitiger hoher femininer Orientierung belegt (Murnen & Smolak, 1997). Ist nicht die Homosexualität, sondern eine einseitige soziale Rollenorientierung der übergreifende Risikofaktor, der homosexuelle Männer und heterosexuelle Männer für Störungen anfällig macht? Das würde erklären, warum Essstörungen nicht nur ein Phänomen der Homosexuellen darstellt.
Männer mit Essstörungen zeigen die Tendenz zu Bulimie und Essattacken. Sind Essattacken ein Ausdruck von emotionaler Überforderung aufgrund der androgynen Ansprüche der Gesellschaft? Die Frage scheint weit hergeholt. Und trotzdem: Essen hat mit Emotionen zu tun. Nicht in jeder Stimmung haben wir Hunger oder das Bedürfnis zu essen. Essen hat für jeden Menschen eine basale Bedeutung und ist selbst ein Ausdrucksmittel. Im fünften Teil werden anhand zweier Modelle zur Emotionsregulation mögliche Funktionen von Essattacken dargestellt.
Meine These:
,Nicht die homosexuelle Orientierung macht den Mann vulnerabel für eine Essstörung, sondern eine ausgeprägte einseitige soziale Rollenorientierung.‚
Die These besteht aus zwei Teilaussagen. Einerseits lege ich dar, dass Homosexuelle zwar unter Männern mit Essproblemen gut vertreten sind, die Homosexualität an sich aber kein spezifischer Risikofaktor sein muss. Denn Männer mit Essstörungen verbindet ein anderer Faktor: eine einseitige ausgerichtete soziale Rollenorientierung. Stark feminin orientierte Männer sind dem Schönheitskult unterworfen, wogegen stark maskuline Männer sich der Kritik der androgyn orientierten Gesellschaft aussetzen. Ich postuliere, dass eine einseitige soziale Rollenorientierung das Individuum in eine Verunsicherung versetzt, die eine Essstörung auslösen kann.
2. Essstörung beim Mann
Bei der Bezeichnung von Krankheitsbildern beziehe ich mich auf die Diagnosekriterien des DSM-IV. Durch Studien bezeichnete Krankheitsbilder stützen sich je nach Jahrgang auf die Ausgaben DSM-III, DSM-IV oder DSM-IV-TR.
2.1. Symptome
Die zwei bekanntesten Diagnosemanuale, das DSM-IV[1] und das ICD-10[2], unterscheiden bei Essstörungen bei der Darstellung von klinisch relevanten Symptomen nicht zwischen Frauen und Männern. Eine Mehrheit der empirischen Studien, stellvertretend seien Bramon-Bosch, Troop und Treasure (2000) und Fichter und Daser (1987) genannt, stellen bei den klinischen Symptomen der Männer und ihrem Essverhalten keine oder nur geringe Abweichungen zu jenen der Frauen fest.
Geschlechtsspezifische Unterschiede werden bezüglich dem Zeitpunkt des Ausbruchs der Essstörung, dem Körperempfinden, dem Schlankheitsstreben und der Wahl der gewichtsreduzierenden ‚Technik’ vereinzelt erwähnt. Nach Grabhorn, Köpp, Gitzinger, von Wietersheim und Kaufhold (2003) und Bramon-Bosch et al. (2000) sind Männer bei Krankheitsausbruch durchschnittlich älter als Frauen. Deter, Köpp, Zipfel und Herzog (1998) stellen bei Männern mit Anorexie einen früheren Ausbruch als bei Frauen fest. Don Morgan und Marsh (2006) sagen bulimischen Männern einen späteren Ausbruch der Krankheit nach, wogegen Joiner, Katz und Heaterthon (2000) bei Bulimikern keinen Geschlechtsunterschied feststellen. Ein guter Überblick über geschlechtsspezifische Unterschiede bietet die multizentrische Essstörungsstudie von Grabhorn et al. (2003).
Vermutungen, dass Männer zufriedener sind mit ihrem Körper als Frauen, wird empirisch wiederholt bestätigt. Nach Lewinsohn, Seeley, Moerk und Striegel-Moore (2002) weisen Männer eine geringere Körperbildstörung auf und sind grundsätzlich zufriedener mit ihrem Körper. Die höhere Zufriedenheit mit dem Körper kann Ursache sein für ein geringeres Schlankheitsstreben als es bei den Frauen der Fall ist. (Grabhorn et al., 2003; Fernandez-Aranda et al. 2004). Silberstein, Mishkind, Striegel-Moore, Timko und Rodin (1989) betonen, dass unter Männern mit Essstörung jene mit homosexueller Orientierung mit ihrem Körper unzufriedener sind als Heterosexuelle. Homosexuelle, die dünner sein wollen als sie sind, neigen stärker zu gestörtem Essverhalten als Heterosexuelle, die ebenfalls angeben, dünner sein zu wollen. Bei Jugendlichen unter 18 Jahren sind Knaben zufriedener mit ihrem Körperbild als Mädchen und möchten eher ,stärker’ als ‚dünner’ erscheinen[3] (Cohane & Pope, 2001). In jenem Reviewartikel weisen die Autoren auf eine positive Korrelation zwischen Unzufriedenheit mit dem eigenem Körper und reduziertem Selbstwertgefühl hin. Um das Gewicht zu kontrollieren betreiben Männer im Vergleich zu Frauen häufiger Sport und exzessives Training (Lewinsohn et al., 2002) und halten nur Diät, wenn es dafür einen gesundheitlichen Grund gibt (Kiefer, Rathmanner & Kunze, 2005).
2.2. Vorkommen der Männer in den Subgruppen der Essstörungen
Die Angaben über Prävalenzen von Essstörungen bei Männern differieren aufgrund methodischer Unterschiede. In epidemiologischen Querschnitterhebungen sind Männer oft höher vertreten als in klinischen Studien, was mit der höheren Hemmschwelle der Männer Hilfe zu beanspruchen, erklärt wird (Grabhorn et al., 2003). Der Anteil Männer unter allen Personen mit Essstörungen wird auf einen Zehntel geschätzt. Bei Braun, Sunday, Huang und Halmi (1999) ist nachzulesen, dass bei Anorexia nervosa der Männeranteil 5-10% ausmacht und bei Bulimia nervosa gar 10-15%. Grabhorn et al. (2003) haben in der klinischen Studie mit über 1’000 bulimischen und anorektischen Patienten einen Männeranteil von 2.8% belegt. Da Männer mit gestörtem Essverhalten die Diagnosekriterien der Anorexia nervosa (AN) oder Bulimia nervosa (BN) oft nicht umfänglich erfüllen, werden sie vorwiegend den ‚nicht näher bezeichneten Essstörungen’ oder „Eating Disorders not otherwise specified“ (EDNOS) zugeordnet[4]. Dies zeigt auch die oft zitierte Männerstudie von Carlat, Carmargo und Herzog (1997) mit 135 Patienten, in der 32% die DSM-IV Kriterien für AN oder BN nicht umfänglich erfüllen und den EDNOS zufallen. Unter den EDNOS bildet die „Binge eating disorder“ (BED) mit 26% die grösste Subgruppe. Fast die Hälfte aller Männer in Carlat et al.’s (1997) Studie erfüllen die Kriterien für BN und insgesamt zeigten 79 Patienten, mehr als die Hälfte der Stichprobe, regelmässige Essanfälle. Die hier dargestellte Tendenz zu Bulimia nervosa und Essanfällen wird von weiteren Autoren bestätigt. Stellvertretend gelten Bramon-Bosch et al. (2000), Fernandez-Aranda et al. (2004) und Grabhorn et al. (2003).
2.3. Zusammenfassung
1) Die klinischen Symptome von Männern weichen nicht oder nur gering von jenen der Frauen ab.
2) Homosexuell veranlagte Männer sind unzufriedener mit ihrem eigenen Körper und neigen eher zu gestörtem Essverhalten als heterosexuelle Männer.
3) Der Männeranteil aller Patienten mit Essstörungen kann auf ungefähr ein Zehntel geschätzt werden. Ihr Anteil beträgt bei AN 5-10% und bei BN 10-15%. Männer zeigen über die empirischen Studien hinweg eine Tendenz zu bulimischem Verhalten, insbesondere zu Essanfällen.
3. Sexuelle Orientierung: Homosexualität als Risikofaktor
In der amerikanischen Normalbevölkerung liegt der Anteil Homosexueller bei 1-6% (Seidman & Rieder, 1994). Unter Männern mit Essproblemen ist die Homosexualität aber um ein Vielfaches höher vertreten. Männer mit einer homosexuellen Orientierung sind in der Literatur wiederholt als Risikogruppe für eine Essstörung diskutiert (Bramon-Bosch et al., 2000; Williamson, 1999).
3.1. Sexuelle Orientierung unter Männern mit Störungen im Essverhalten
Wo bei Frauen mit Essproblemen nicht von einer nennenswerten Neigung zur Homosexualität gesprochen wird[5], gilt Homosexualität bei Männern als spezifischer Risikofaktor für die Entwicklung einer Essstörung. Homosexuelle bilden häufig mit Gleichgesinnten eine eigene Subkultur, mit einem eigenen vorherrschenden Körperkult. Jener kann die Unzufriedenheit mit dem Körper und die Vulnerabilität unter Homosexuellen für Probleme im Essverhalten erhöhen (Silberstein et al., 1989). Hospers (2005) stellt ebenfalls fest, dass Homosexuelle in dieser Subgruppe unzufriedener sind mit ihrem Körper als heterosexuelle Männer und ein stärkerer Gruppendruck („peer pressure“) herrscht.
Obwohl die Studien bei Erfassung der sexuellen Orientierung methodologische Unterschiede aufweisen[6], variieren die Resultate nur in einem kleinen Rahmen, wie nachfolgend ersichtlich wird. In der erwähnten Studie von Fichter und Daser (1987) sind vier von zwanzig Anorektikern homosexuell. Bei Grabhorn et al. (2003) sind 22,3%, bei Herzog, Norman, Gordon und Pepose (1984) 26% und bei Carlat et al. (1997) sind 27% homosexuell orientiert. Entgegen diesen ähnlichen Resultaten befinden Russel und Keel (2002) in einer amerikanischen, wenig repräsentativen, nicht-klinischen Studie 20 von 21 Männern mit gestörtem Essverhalten als homosexuell veranlagt[7].
Die Anzahl publizierter Studien mit quantitativen Aussagen zur Auftretenshäufigkeit von Essstörungen unter Homosexuellen ist zu gering, als dass eine Entwicklung über Dekaden hinweg ableitbar wäre. Die älteste von mir gefundene Studie aus dem Jahre 1984 zeigt bei den Betroffenen vergleichbare Anteile von Homo- beziehungsweise Heterosexuellen wie die jüngste Studie aus dem Jahre 2003. Beide Gründe behindern mein Vorhaben, eine eventuelle Zu- oder Abnahme des homosexuellen Anteils zu erkennen. Ersichtlich ist aber, dass die Zunahme der Esspathologie unter Männern nicht allein durch Homosexuelle zustande kommt. Aktuell sind rund drei von vier Männern mit Essstörungen heterosexuell veranlagt. Es bleibt die folgende Frage relevant: Was bewegt heterosexuelle Männer dazu, eine Essstörung zu entwickeln?
Die Studie von Fichter und Daser (1987) liefert einen interessanten Hinweis für eine mögliche Antwort. Fünf von zehn Anorektikern dieser Studie weisen prämorbid signifikant hohe feminine Werte auf[8], vier von zwanzig Anorektikern sind homosexuell. In ähnlicher Weise äussern sich Meyer, Blisset und Oldfield (2001), indem sie die Frauenrolle, oder eine starke Ausprägung der Feminität, als den grösseren Risikofaktor bezeichnen als die sexuelle Orientierung. Eine nähere Betrachtung der Rollenorientierung bietet der folgende Abschnitt.
3.2. Zusammenfassung
1) Empirisch ist bestätigt, dass Homosexualität bei Männern mit Essstörungen gehäuft vorkommt. Homosexuelle neigen eher zu Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper als Heterosexuelle.
2) Die Zunahme von Essstörungen unter Männern kann nicht mit der Erhöhung des Anteils Homosexueller erklärt werden. Der Zunahme der Esspathologie bei Männern muss ein Faktor zugrunde liegen, der homosexuelle sowie heterosexuelle Männer betrifft.
3) Empirische Studien bestätigen eine Korrelation von Esspathologie mit starker femininer Orientierung.
4. Rollenorientierung: Feminität als Risikofaktor?
Männer und Frauen der westlichen Gesellschaft orientieren sich nach Verhaltensweisen, Einstellungen und Charakteristiken, die kulturell als feminin, neutral oder maskulin deklariert werden.
4.1. Feminität und Maskulinität
Feminität und Maskulinität bezeichnen Attribute und Verhaltensweisen, die speziell Männer zugehörig oder Frauen zugehörig gelten.
Sie sind nicht zwingend ans biologische Geschlecht gebunden, sondern bezeichnen traditionelle Erwartungen der Gesellschaft an einen Mann oder eine Frau.
4.1.1. Eine Dimension versus zwei Dimensionen
Zur Messung der Geschlechterrolle stehen unterschiedliche Instrumente zur Verfügung, die nicht alle dem gleichen Konzept entsprechen. Auch die am häufigsten angewendeten Instrumente wie MMPI („Minnesota Multiphasic Personality Inventory“) und BSRI („Bern Sex Role Inventory“) basieren auf unterschiedlichen theoretischen Konzepten von Feminität und Maskulinität (Murnen & Smolak, 1997). Die zwei Instrumente zeigen einen nicht ignorierbaren Unterschied, was einen Vergleich der Daten beeinträchtigt. Der MMPI, der vor allem vor 1970 eingesetzt wurde, misst Feminität und Maskulinität auf einer bipolaren Skala. Das von Sandra Bern 1974 entwickelte Sex Role Inventory (BSRI) stellt Maskulinität und Feminität auf zwei Dimensionen und nicht mehr bipolar dar. Mit dieser Methode kann ein Individuum, im Gegensatz zum MMPI, auf keiner, auf einer oder auf beiden Dimensionen hohe Werte erreichen. Wer hohe Werte in Feminität und Maskulinität erreicht, wird als androgyn bezeichnet, wer beiderseits tiefe Werte erreicht, gilt als neutral.
4.1.2. Wandel in Richtung Androgynie
Auster und Ohm (2000) prüften, ob die im BSRI aus den 70er Jahren enthaltenen feminin oder maskulin klassierten Attribute heute noch als solche in der amerikanischen Gesellschaft klassifiziert werden. Sie verglichen Daten aus den 70er Jahren mit Daten des Jahres 1999. Frauen sowie Männer wurden aufgefordert, Attribute des BSRI als für sich erwünscht oder nicht erwünscht einzustufen. Ebenso mussten sie die gleichen Attribute einem Geschlecht zuordnen. In der Stichprobe von 1999 beurteilten Frauen wie auch Männer für ihr Geschlecht noch dieselben Attribute als typisch männlich oder weiblich wie die Stichprobe von drei Dekaden zuvor. Auf die Frage, welche Attribute sie für sich selbst wünschten, äusserten beide Geschlechter, dass sie idealerweise eine Mischung von maskulinen und femininen Charakteren des BSRI haben möchten. Die gleiche Tendenz zeigt sich in der Selbstbeschreibung. Die Personen gebrauchten im Jahr 1999 eine ausgeprägtere Mischung beider Pole als 1979. Im Jahr 1999 wählten Männer unter den 15 favorisierten Attributen fünf des anderen Geschlechts, Frauen sogar 8 Attribute. Der Anspruch androgyn zu sein hat folglich über die letzten 25 Jahre bei Männern sowie Frauen zugenommen[9]. Wie die Untersuchung von Auster und Ohm (2000) aufzeigt, besteht eine Entwicklung hin zur Androgynität und dennoch bleiben parallel die traditionellen Charakterzuschreibungen noch im Bewusstsein verankert. Bestehen gleichzeitig zwei verschiedene Wertesysteme, wird das Individuum mit Rollenkonflikten und einer Erwartungsdiffusion konfrontiert. Paxton und Sculthorpe (1991) weisen bei Frauen nach, dass eine Diskrepanz zwischen den gepriesenen männlichen Charakteristiken zum eigenen Selbst die Basis für eine Essstörung bilden kann. Sie vertreten die Auffassung, dass Frauen mit Essstörungen sich mehr maskuline Attribute wünschen, vor allem, wenn sie hohe feminine Werte zeigen, die in der Gesellschaft negativ besetzt sind.
[...]
[1] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Text Revision (Hrsg.: APA)
[2] International Classification of Diseases (Hrsg.: WHO)
[3] Sie kritisieren Studien, die die Aussage ‚mehr Masse haben wollen’ nicht genauer definieren. Es bleibt unklar, ob es sich dabei um Muskeln oder Fett handelt.
[4] Nach DSM-IV-TR: Anorexia nervosa 307.1; Bulimia nervosa 307.51; nicht näher bezeichnete Essstörung 307.50
[5] Bei Frauen liegt die Quote der Homosexuellen ungefähr bei 4% (Herzog et al., 1984)
[6] Die angewendeten Methoden: Fichter und Daser (1987), das Freiburger Persönlichkeitsinventar (FBI) und ein standardisiertes Interview; Grabhorn (2003), FPI-R; Carlat und Kollegen (1997), Aufnahme sexueller Präferenz mittels Patientenaussagen und Fachpersonen; Russel und Keel (2002), Bern Sex-Role Inventory (BSRI).
[7] Stichprobe erworben durch Inserat mit Hinweis auf sexuelle Orientierung, was u.U. zu selektiver Stichprobe mit erhöhter Quote Homosexueller führte.
[8] Mit dem bipolaren Messinstrument FPI (Fahrenberg et al., 1973): Hoher femininer Wert besagt einen tiefen maskulinen Wert (weitere Erklärungen siehe nächstes Kapitel).
[9] Gemäss den Autoren die Generalisierung der Resultate unter Umständen eingeschränkt, da die Stichprobe aus ‚undergraduate students’ besteht.
Häufig gestellte Fragen
Sind Essstörungen eine rein weibliche Krankheit?
Nein, Essstörungen werden heute nicht mehr als rein weibliche Krankheit angesehen. Die Zahl der betroffenen Männer ist in den letzten 50 Jahren deutlich gestiegen, auch wenn das Thema gesellschaftlich oft noch ein Tabu darstellt.
Welche Rolle spielt die sexuelle Orientierung bei Essstörungen bei Männern?
Homosexualität gilt in der Literatur als spezifischer Risikofaktor, da homosexuelle Männer oft stärkeren gesellschaftlichen Druck erleben und mehr Wert auf Figur und Gewicht legen. Dennoch sind drei von vier betroffenen Männern heterosexuell.
Was versteht man unter der Rollenorientierung als Risikofaktor?
Die soziale Geschlechterrolle (Feminität und Maskulinität) beeinflusst die Anfälligkeit. Besonders Männer mit einer einseitigen Rollenorientierung oder Identifikationsproblemen durch androgyn geprägte gesellschaftliche Erwartungen leiden unter emotionalem Stress, der Essstörungen begünstigen kann.
Welche Funktion haben Essattacken bei Männern?
Essattacken werden häufig als maladaptive Bewältigungsstrategie eingesetzt, um starke, unerwünschte Emotionen zu regulieren und auf sozialen Druck zu reagieren.
Gibt es Unterschiede in den Symptomen zwischen Männern und Frauen?
Die klinischen Kernsymptome sind weitgehend gleich. Unterschiede gibt es jedoch oft beim Zeitpunkt des Ausbruchs (Männer oft älter), beim Körperempfinden und bei der Wahl der gewichtsreduzierenden Techniken, wie etwa exzessivem Sport.
In welchen Subgruppen von Essstörungen kommen Männer am häufigsten vor?
Männer machen bei Anorexia nervosa etwa 5-10 % und bei Bulimia nervosa etwa 10-15 % der Betroffenen aus. Da sie die Kriterien oft nicht vollständig erfüllen, werden sie häufig der Kategorie "nicht näher bezeichnete Essstörungen" (EDNOS) zugeordnet.
- Quote paper
- Monika von Heeren (Author), 2007, Essstörungen bei Männern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80853