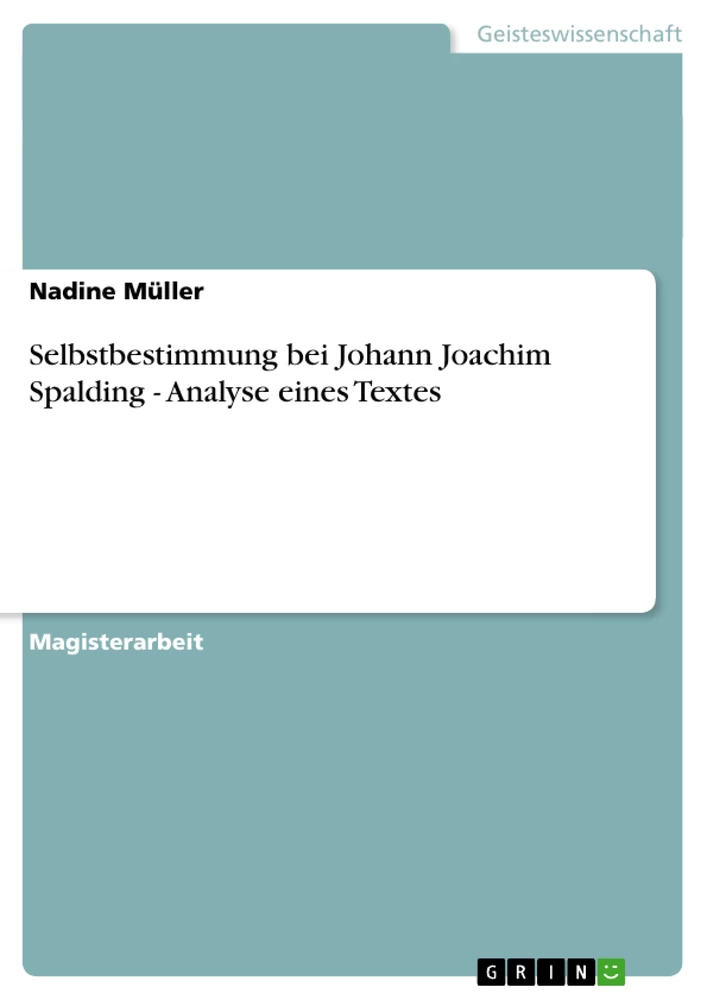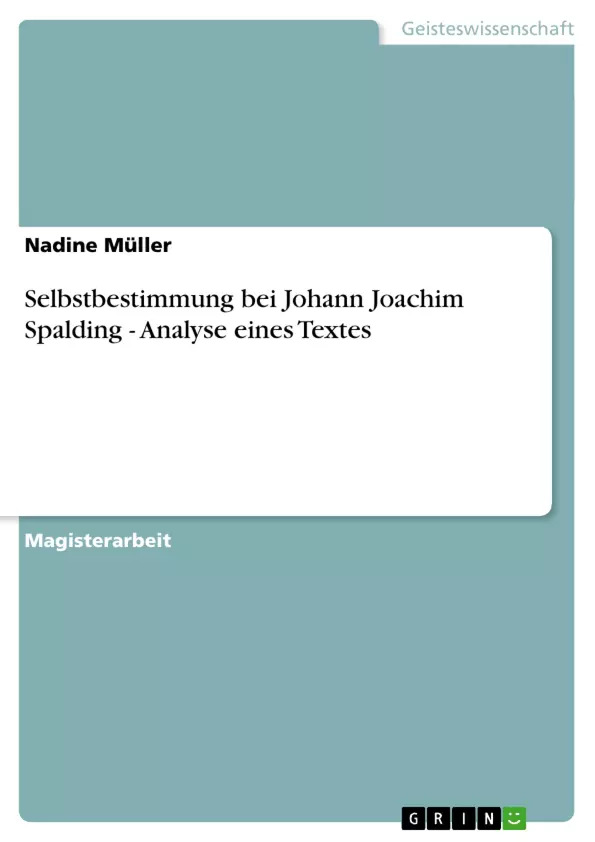Ausgehend von der Fragestellung nach dem Sinn des Lebens, die darauf abzielt, sich selbst eine Antwort darauf zu geben, warum und mit welchen Zielen man lebt, versucht Spalding dem nach Aufklärung und eigener Einsicht strebenden Individuum, eine Richtschnur für die vernünftige Beurteilung und Handhabung seines Daseins aufzuzeigen. Die Frage also, wie sich das Leben des Individuums durch es selbst, unter Annahme einer von innen kommenden Aktivität, zu einer erfüllten und glücklichen Zeit gestalten läßt, stellt sich für Spalding daher in praktischer Absicht. Dabei geht es dem Autor darum, den Einzelnen aufzufordern, sich mit sich selbst zu beschäftigen, um Einsicht in die eigene Natur zu erhalten und aus diesen Erkenntnissen heraus selbst tätig zu werden. – Der Einzelne ist angehalten sein Leben aus eigener Einsicht, unabhängig von Autoritäten bzw. der Meinung anderer, selbst zu bestimmen.
Der Begriff der Selbstbestimmung ist ein Terminus, der bereits im antiken Denken angelegt ist und bei den Theoretikern der Renaissance in eine zentrale, theoretische Position gelangt. Aber erst in der Nachfolge der kritischen Philosophie Immanuel Kants wird er zu einem eigenständigen Terminus mit grundlegender Bedeutung. Deshalb ist die unmittelbare Vorgeschichte des Begriffs im Zeitalter Kants von besonderem Gewicht. Ziel dieser Magisterarbeit war es deshalb, den Beitrag von Johann Joachim Spalding zu dieser Entwicklung aufzuklären. Seine Schrift "Gedanken über die Bestimmung des Menschen", die 1748 erstmals in Greifswald erschien und dreizehn Auflagen erlebt hat, trägt seit der vierten Auflage aus dem Jahre 1751 den Titel "Die Be-stimmung des Menschen". Die hier vorgelegte, detaillierte Analyse des Textes der ersten und dreizehnten Auflage hat gezeigt, wie sehr die begrifflichen Bestimmungsmomente der später so genannten „Selbstbestimmung“ bereits bei Spalding gegenwärtig waren.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Zur Zitierweise
- Zeitgeschichtliche und philosophiegeschichtliche Hintergründe
- Shaftesburys Einfluß auf den Neologen Spalding
- Grundgedanken der Shaftesburyschen Philosophie
- Selbsterkenntnis und Selbstreflexion
- Ästhetische Erfahrung und moralisches Gefühl
- Glückseligkeit durch Tugend
- Die tugendunterstützende Funktion der Religion
- Die Bestimmung des Menschen nach Spalding
- Ethische Reflexion und Selbstreflexion
- Ethische Reflexion und die Frage nach dem Sinn des Lebens
- Sinnlichkeit die niedrigste Stufe der Selbstbestimmung
- Vergnügungen des Geistes – ein Weg zur vernünftigen Selbstbestimmung
- Tugend als Ausdruck vernünftiger Selbstbestimmung
- Religion als Stütze der Tugend
- Unsterblichkeit als Lohn
- Resümee
- Spalding und Shaftesbury – ein Vergleich
- Selbstbestimmung und kulturelle Verantwortung
- Die Rolle der Gewissens im Akt der Selbstbestimmung
- Spaldings Stufenmodell
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit analysiert Johann Joachim Spaldings Werk "Die Bestimmung des Menschen", insbesondere die darin dargestellte Konzeption von Selbstbestimmung. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, Spaldings Verständnis von Selbstbestimmung im Kontext seiner Zeit und unter Berücksichtigung des Einflusses von Anthony Ashley Cooper, Earl of Shaftesbury, zu erforschen und zu erläutern. Dabei wird der Fokus auf die Analyse der ersten und letzten Auflage von Spaldings Werk gelegt, um die Entwicklung seiner Gedanken und die Kontinuität seiner Grundlinien aufzuzeigen.
- Die Bedeutung von Selbstbestimmung im philosophischen Denken Spaldings
- Der Einfluss von Shaftesbury auf Spaldings Philosophie
- Spaldings Konzeption des menschlichen Daseins und der Frage nach dem Sinn des Lebens
- Die Rolle der Vernunft, des Gefühls und der Religion bei der Selbstbestimmung
- Die Bedeutung der ethischen und ästhetischen Dimensionen der Selbstbestimmung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet den historischen und philosophischen Kontext, in dem Spaldings Werk entstanden ist. Es werden die zeitgeschichtlichen und philosophiegeschichtlichen Hintergründe sowie die wichtigsten Einflüsse auf Spaldings Denken beleuchtet.
Kapitel zwei widmet sich dem philosophischen Einfluss von Shaftesbury auf Spalding. Es werden die Kerngedanken der Shaftesburyschen Philosophie rekonstruiert und die Gemeinsamkeiten mit Spaldings Positionen herausgearbeitet.
Kapitel drei analysiert und rekonstruiert Spaldings System zur Bestimmung des Menschen. Es werden die verschiedenen Stufen der Selbstbestimmung, die Rolle des Gefühls, der Vernunft und der Religion sowie die Bedeutung der Ästhetik und Ethik für die Selbstbestimmung des Menschen untersucht. Der Vergleich mit Shaftesburys Philosophie wird an relevanten Stellen fortgesetzt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen dieser Arbeit sind: Selbstbestimmung, Johann Joachim Spalding, Anthony Ashley Cooper, Earl of Shaftesbury, "Die Bestimmung des Menschen", Sinn des Lebens, Vernunft, Gefühl, Religion, Ästhetik, Ethik, Kulturwesen, moralisches Subjekt.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Johann Joachim Spalding?
Johann Joachim Spalding (1714–1804) war ein bedeutender deutscher Theologe der Aufklärung und ein wichtiger Vertreter der sogenannten Neologie.
Was ist das Hauptthema seines Werkes „Die Bestimmung des Menschen“?
Spalding untersucht die Frage nach dem Sinn des Lebens und wie das Individuum durch Vernunft und Selbsterkenntnis zu einer glücklichen und moralisch erfüllten Existenz gelangen kann.
Welchen Einfluss hatte Lord Shaftesbury auf Spalding?
Shaftesburys Ideen zur Selbsterkenntnis, zum moralischen Gefühl und zur Verbindung von Tugend und Glückseligkeit prägten Spaldings Konzept der Selbstbestimmung maßgeblich.
Wie definiert Spalding Selbstbestimmung?
Selbstbestimmung bedeutet bei Spalding, sein Leben aus eigener Einsicht und unabhängig von äußeren Autoritäten zu gestalten, basierend auf der Erkenntnis der eigenen Natur und vernünftigen Zielen.
Welche Rolle spielt die Religion in Spaldings System?
Die Religion dient als Stütze der Tugend. Sie hilft dem Menschen, seinen moralischen Weg zu festigen und bietet die Hoffnung auf Unsterblichkeit als Lohn für ein tugendhaftes Leben.
- Arbeit zitieren
- Nadine Müller (Autor:in), 2003, Selbstbestimmung bei Johann Joachim Spalding - Analyse eines Textes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80657