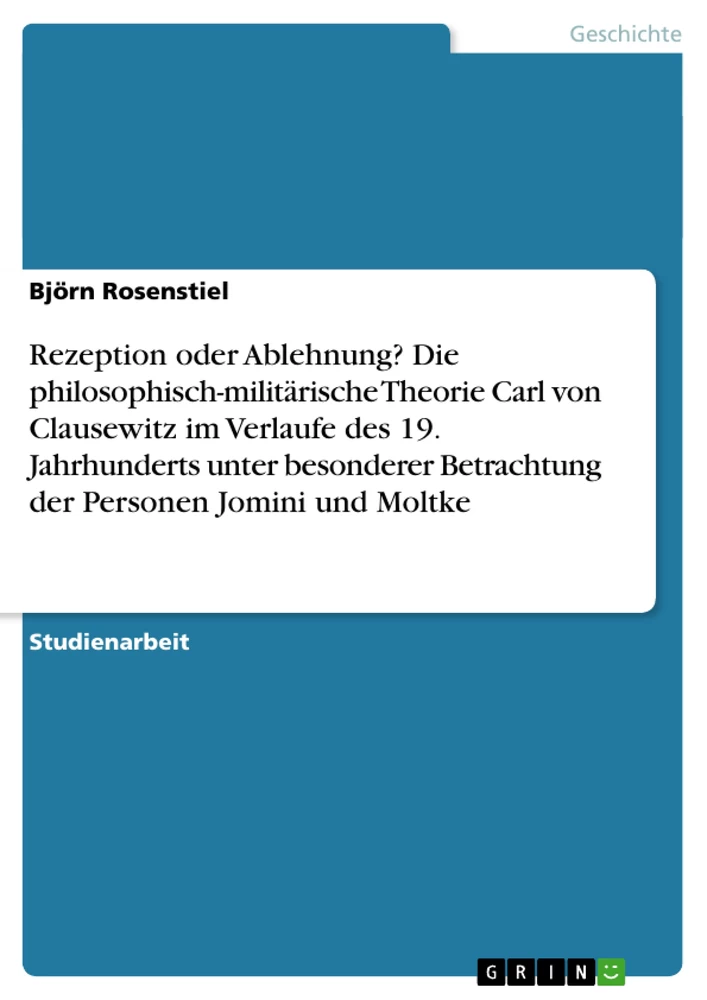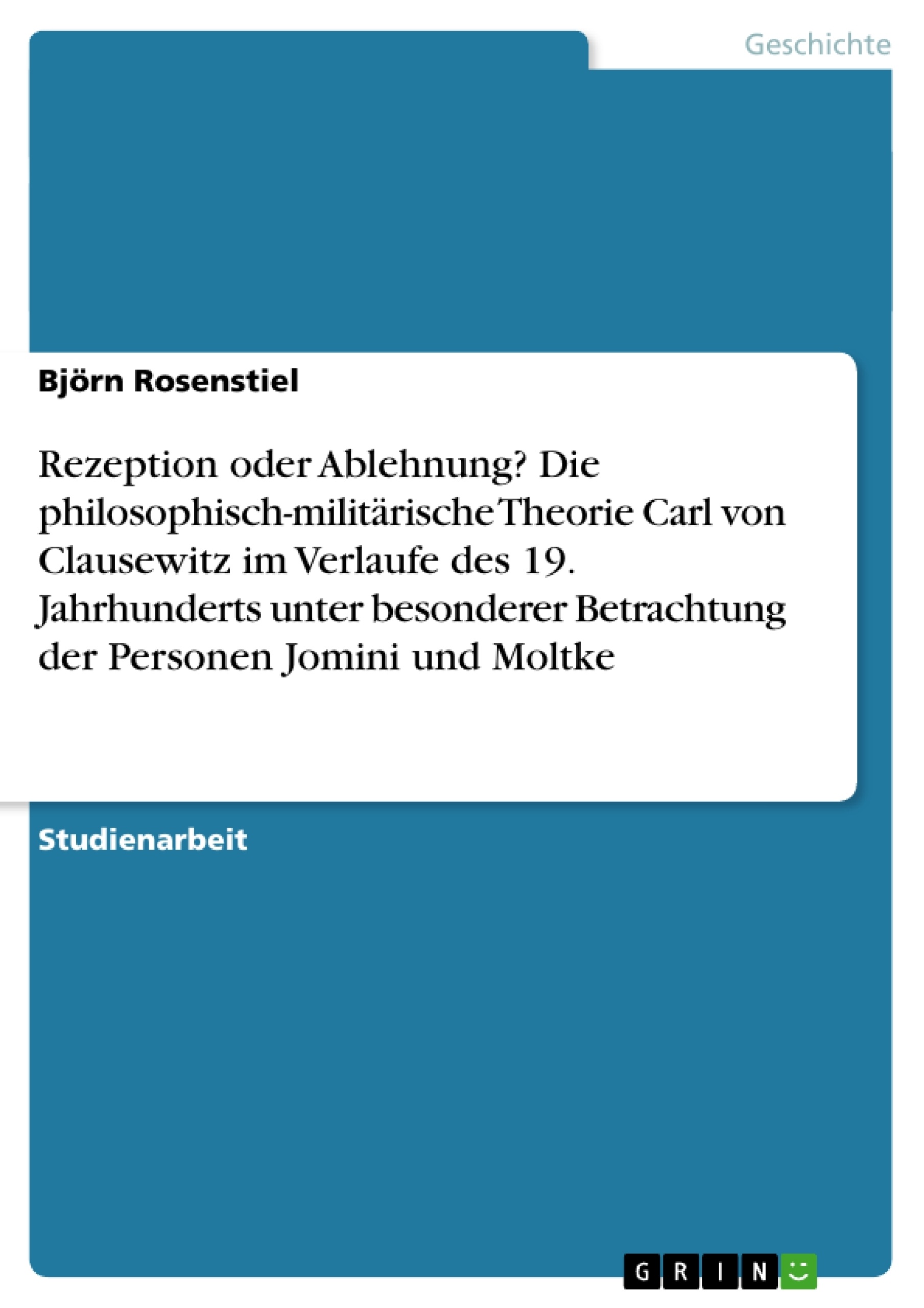1. Einleitung
Der Versuch eine Lehre aus dem Krieg zu ziehen, um dem Gegner voraus zu sein, um weiter zu denken, schneller zu schießen und exakter zu töten als er, war von jeher so unverzichtbar wie das Feindbild selbst.
Denn ursprünglich wurden schon in der Antike allgemeine Grundsätze der Kriegskunst formuliert, die sich später im 16./17. Jahrhundert, wesentlich beeinflusst durch Descartes Rationalismus, zu mechan- ischen Theorien verdichteten. Die moderne Theorie des Krieges jedoch entstand erst im Verlaufe der Französischen Revolution und das durch sie veränderte Kriegsbild wurde wesentlich geprägt von Napoleon und dessen „Analytikern“ Jomini und Clausewitz.
Vor allem mit Carl von Clausewitz begann eine „Kehre“ im kriegswissenschaftlichem Denken. Aus der Beschäftigung mit den alten Theorien der Kabinettskriegszeit erwuchs in ihm angesichts neuer Gegebenheiten der Drang den Krieg neu zu verstehen. Zunächst anhand der Kleinen und später der Großen Kriege analysierte er dieses Phänomen auf eine bis dahin einzigartig philosophische Weise in seinem 1831 erschienenen Buch „Vom Kriege“.
Im folgenden gilt es nun zu untersuchen, wie dieses Werk zu Clausewitz Lebzeiten und in der Folgezeit von den Militärs rezipiert worden ist. Um diese Frage zu beantworten, werden nach einer Einführung in Clausewitz Leben, Denken und Werk, zuerst der Analytiker der napoleonischen Strategieprinzipien, Henri - Antoine Jomini, und dann der selbst ernannte Clausewitzschüler und Begründer der „technizistischen Kriegslehre“, Helmuth von Moltke, hinsichtlich ihrer Beziehungen in ihrem Denken zu „Vom Kriege“ in Augenschein genommen. Davon ausgehend soll schließlich ein kurzer Ausblick auf die entscheidende Entwicklung der Kriegstheorie in Frankreich und in Preußen mit Blickrichtung auf die militärische Planung von 1914 an den Personen Foch und Schlieffen gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Carl von Clausewitz - General und Philosoph
- 3. Vorstellung und Wirklichkeit
- 4. Vom Kriege
- 4.1. Krieg und Politik
- 4.2. Strategie und Taktik
- 4.3. Verteidigung und Angriff
- 4.4. Der Volkskrieg
- 5. Zwei bedeutende Leser und Zeitgenossen
- 5.1. Der „Systemmacher“ Jomini (1779-1869)
- 5.2. Der „Technizist“ Moltke (1800-1891)
- 6. Epigonen
- 7. Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeption von Carl von Clausewitz' Werk „Vom Kriege“ im 19. Jahrhundert, insbesondere durch Jomini und Moltke. Ziel ist es, zu analysieren, wie Clausewitz' Theorie in der militärischen Praxis aufgegriffen und weiterentwickelt wurde.
- Rezeption von Clausewitz' „Vom Kriege“
- Vergleichende Analyse der Ansätze von Jomini und Moltke
- Entwicklung der Kriegstheorie im 19. Jahrhundert
- Einfluss von Clausewitz auf die militärische Planung
- Der Wandel des Kriegsbildes im 19. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert den historischen Kontext der Entwicklung der Kriegstheorie, beginnend mit der Antike und der Entwicklung mechanischer Theorien im 16./17. Jahrhundert. Sie betont die Bedeutung der Französischen Revolution und Napoleons für das veränderte Kriegsbild und hebt Clausewitz als zentralen Wegbereiter einer neuen, philosophischen Betrachtung des Krieges hervor. Der Fokus der Arbeit liegt auf der Rezeption von Clausewitz' Werk „Vom Kriege“ und der Analyse seiner Interpretation durch Jomini und Moltke.
2. Carl von Clausewitz - General und Philosoph: Dieses Kapitel beschreibt Leben und Werk von Carl von Clausewitz. Es schildert seine frühen Kriegserfahrungen, seine Ausbildung und seinen Werdegang im preußischen Militär. Besonders wird auf seine kritische Auseinandersetzung mit bestehenden militärischen Theorien und seinen Drang, den Krieg neu zu verstehen, eingegangen. Der Kapitelverlauf zeigt Clausewitz' Entwicklung vom jungen Offizier zum philosophischen Denker, dessen Werk „Vom Kriege“ einen bedeutenden Einschnitt in der Kriegstheorie darstellt.
3. Vorstellung und Wirklichkeit: Dieses Kapitel behandelt den Wandel des Verhältnisses von Politik und Krieg im Kontext des Strukturwandels der französischen Gesellschaft. Clausewitz' Motivation, den Krieg in seiner Vorstellung und Wirklichkeit zu analysieren, wird erläutert, ausgehend vom Ausbruch des Krieges aus den Schranken der Kabinettspolitik des 18. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf Clausewitz' Analyse der Diskrepanz zwischen der theoretischen Planung und der realen Kriegsführung.
4. Vom Kriege: Dieses Kapitel fasst die zentralen Argumentationslinien von Clausewitz' Hauptwerk zusammen. Es werden die Aspekte Krieg und Politik, Strategie und Taktik, Verteidigung und Angriff sowie der Volkskrieg behandelt. Das Kapitel beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen diesen Elementen und ihre Bedeutung für Clausewitz' Kriegstheorie. Es werden die innovativen Ansätze Clausewitz' im Vergleich zu früheren Ansätzen im Bereich der Kriegführung diskutiert.
5. Zwei bedeutende Leser und Zeitgenossen: Hier werden die Rezeption und Interpretation von Clausewitz' Werk durch Jomini und Moltke analysiert. Jominis „Systematik“ und Moltkes „Technizismus“ werden im Detail beleuchtet und im Kontext zu Clausewitz' Theorie eingeordnet. Der Vergleich ihrer Ansätze verdeutlicht unterschiedliche Interpretationen und Anwendung von Clausewitz' Ideen in der Praxis.
6. Epigonen: Dieses Kapitel widmet sich den Nachfolgern und Interpreten von Clausewitz und Jomini und deren Einfluss auf die weitere Entwicklung der Kriegstheorie. Es wird die Weiterentwicklung und die Veränderungen in der Kriegstheorie untersucht, die durch diese Nachfolger entstanden sind. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Kontinuitäten und Brüche in der Rezeption von Clausewitz' Werk.
Schlüsselwörter
Carl von Clausewitz, Vom Kriege, Kriegstheorie, Jomini, Moltke, Strategie, Taktik, Militärgeschichte, 19. Jahrhundert, Napoleon, Rezeption, Militärplanung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Rezeption von Clausewitz' "Vom Kriege" im 19. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rezeption von Carl von Clausewitz' Werk "Vom Kriege" im 19. Jahrhundert, insbesondere durch Jomini und Moltke. Der Fokus liegt auf der Analyse, wie Clausewitz' Theorie in der militärischen Praxis aufgegriffen und weiterentwickelt wurde.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rezeption von Clausewitz' "Vom Kriege", einen vergleichenden Analyse der Ansätze von Jomini und Moltke, die Entwicklung der Kriegstheorie im 19. Jahrhundert, den Einfluss von Clausewitz auf die militärische Planung und den Wandel des Kriegsbildes im 19. Jahrhundert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Carl von Clausewitz - General und Philosoph, Vorstellung und Wirklichkeit, Vom Kriege (mit Unterkapiteln zu Krieg und Politik, Strategie und Taktik, Verteidigung und Angriff sowie dem Volkskrieg), Zwei bedeutende Leser und Zeitgenossen (Jomini und Moltke), Epigonen und Schluss.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung skizziert den historischen Kontext der Entwicklung der Kriegstheorie, beginnend mit der Antike bis zur Französischen Revolution und Napoleon. Sie betont Clausewitz' Bedeutung als Wegbereiter einer neuen, philosophischen Betrachtung des Krieges und fokussiert auf die Rezeption seines Werkes durch Jomini und Moltke.
Wie wird Clausewitz dargestellt?
Kapitel 2 beschreibt Leben und Werk von Clausewitz, seine Kriegserfahrungen, Ausbildung und seinen Werdegang im preußischen Militär. Es wird seine kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Theorien und sein Bestreben, den Krieg neu zu verstehen, hervorgehoben.
Was ist das Thema von Kapitel 3 ("Vorstellung und Wirklichkeit")?
Dieses Kapitel behandelt den Wandel des Verhältnisses von Politik und Krieg im Kontext des Strukturwandels der französischen Gesellschaft und analysiert die Diskrepanz zwischen theoretischer Planung und realer Kriegsführung bei Clausewitz.
Welche Aspekte von "Vom Kriege" werden zusammengefasst?
Kapitel 4 fasst die zentralen Argumentationslinien von Clausewitz' Hauptwerk zusammen, einschließlich Krieg und Politik, Strategie und Taktik, Verteidigung und Angriff sowie den Volkskrieg. Es beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen diesen Elementen und ihre Bedeutung für Clausewitz' Kriegstheorie.
Wie werden Jomini und Moltke behandelt?
Kapitel 5 analysiert die Rezeption und Interpretation von Clausewitz' Werk durch Jomini und Moltke. Jominis „Systematik“ und Moltkes „Technizismus“ werden im Detail beleuchtet und im Kontext zu Clausewitz' Theorie eingeordnet. Der Vergleich verdeutlicht unterschiedliche Interpretationen und Anwendungen von Clausewitz' Ideen.
Worüber handelt Kapitel 6 ("Epigonen")?
Dieses Kapitel befasst sich mit den Nachfolgern und Interpreten von Clausewitz und Jomini und deren Einfluss auf die weitere Entwicklung der Kriegstheorie. Es untersucht die Weiterentwicklung und Veränderungen in der Kriegstheorie, die durch diese Nachfolger entstanden sind, mit Schwerpunkt auf Kontinuitäten und Brüchen in der Rezeption von Clausewitz' Werk.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen Carl von Clausewitz, Vom Kriege, Kriegstheorie, Jomini, Moltke, Strategie, Taktik, Militärgeschichte, 19. Jahrhundert, Napoleon, Rezeption und Militärplanung.
- Quote paper
- Magister Artium Björn Rosenstiel (Author), 2004, Rezeption oder Ablehnung? Die philosophisch-militärische Theorie Carl von Clausewitz im Verlaufe des 19. Jahrhunderts unter besonderer Betrachtung der Personen Jomini und Moltke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79434