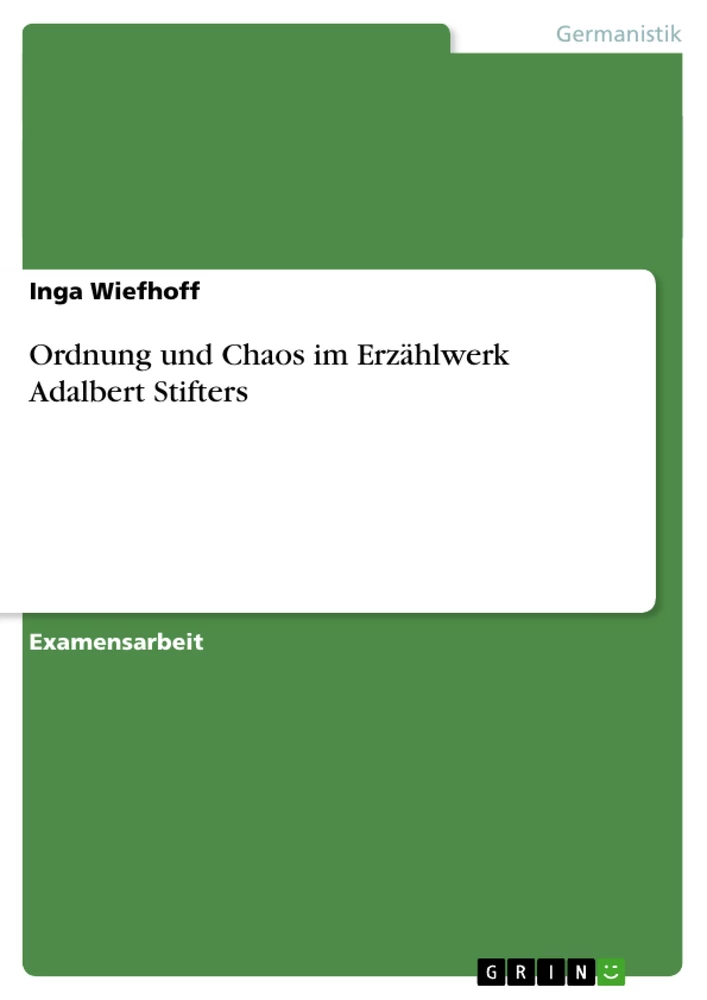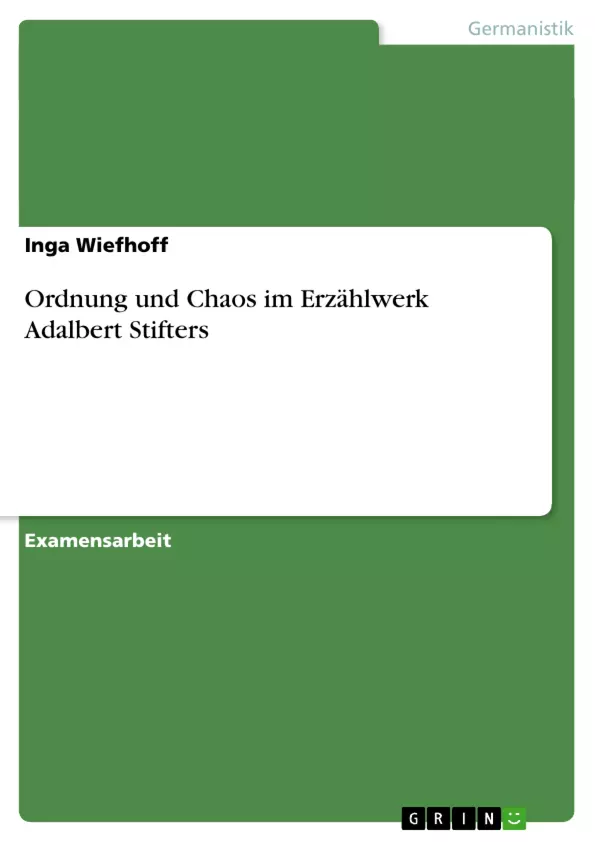„Es ist doch mehr und anderes als das bekannte noble ennui.“
Dieses von Thomas Mann in Bezug auf Stifters Œuvre beobachtete ‚mehr’ soll ins Zentrum der vorliegenden Arbeit gerückt werden. Schon von Zeitgenossen als „das überschätzte Diminutiv-Talent“ bezeichnet, hat gerade Stifter immer wieder negative Einschätzungen erfahren, die im zweifelhaften Prädikat ‚Poet der Langeweile’ kulminieren.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, die immer wieder thematisierte Langatmigkeit, die scheinbar endlos idyllisierenden Beschreibungen, die dem Leser bei der Rezeption Stifterscher Erzählprosa begegnen, aus einer anderen Perspektive heraus zu betrachten. Thomas Mann bezeichnet den Österreicher als „Ehrenretter der Langeweile“ und betont des Weiteren, „was für ein aufregender, außerordentlicher, alle Augenblicke ins Extreme [...] vorstoßender Erzähler“ er ist. Seine Beobachtung soll in diesem Rahmen als erste Motivation herangezogen werden, innerhalb der Ordnungssysteme Stifters tatsächlich nach ‚mehr’, nach anderen Strukturen zu suchen, an denen sich der jeweils dargestellte Kosmos reibt und so seine ‚Außer-Ordentlichkeit’ bedingt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Strömungen und Tendenzen in einer schwierigen Zeit
- I. Teil
- Un-Ordentliche Ordnung
- I. 1 „Bergkristall“ – (un)geordnete Erzählräume
- I. 1.1 Problematisches Weihnachtsidyll
- I. 1.2, Tal-Welt'
- I. 1.3 Schneekatastrophe: Orientierungsverlust
- I. 1.4 Ordnungsversuche
- I. 1.5 Rettung
- I. 2 „Turmalin“ – Fragmentarische Lebensbilder
- I. 2.1 Der, verschachtelte' Rentherr
- I. 2.2 Der, Ehe-Bruch'
- I. 2.3 Die, Ordnungs-Stifterin' und das unterirdische Paar
- I. 2.4 Das,kopflastige' Mädchen
- II. Teil
- Ordentliche Un-Ordnung
- II. 1 Der Nachsommer – die,andere' Rosen-Welt
- II. 1.1 Das Rosen-Panorama
- II. 1.2 Heinrich Drendorf – ein schweigender Erzähler
- II. 1.4 Rückblickende Entzifferung: , Rosen - Zeichen'
- II. 1.3 Strategien eines schweigenden Erzählers
- II. 2 Welt des Nichts - „Der fromme Spruch“
- II. 2.1,Figuren-Spiel' in einer entleerten diegetische Welt
- II.2.2 Der Chronist: ein unsichtbarer Erzähler
- II. 2.3 Grenzen der Kommunikation
- Das Zusammenspiel von Ordnung und Chaos in Stifters Texten
- Die Darstellung von Unordnung in scheinbar idyllischen Erzählungen
- Stifters narrative Strategien zur Darstellung von Unordnung
- Die Rolle von Natur und Gesellschaft in Stifters Welt
- Der Einfluss der Zeit des Biedermeier auf Stifters Werk
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Werk Adalbert Stifters und fokussiert auf die scheinbar widersprüchliche Beziehung zwischen Ordnung und Chaos in seinen Erzählungen und Romanen. Ziel ist es, die oft bemängelte Langatmigkeit und Idyllisierung in Stifters Werken aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten und die spannungsvolle Coexistenz von Ordnung und Unordnung in seinen Texten aufzuzeigen. Durch die Analyse verschiedener Erzählungen und des Romans „Der Nachsommer“ wird gezeigt, wie sich das Chaos trotz scheinbarer Ordnungsstrukturen in Stifters Welt durchsetzt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit vor: Stifters Werk ist nicht durch Langeweile und Idyllisierung geprägt, sondern durch eine ambivalente Beziehung zwischen Ordnung und Chaos. Die Einleitung skizziert die historische und literarische Situation des Biedermeier und argumentiert für die Relevanz der Suche nach dem „Un-Ordentlichen“ in Stifters Texten.
Das erste Kapitel untersucht zwei Erzählungen aus der Sammlung „Bunte Steine“: „Bergkristall“ und „Turmalin“. In „Bergkristall“ manifestiert sich das Chaos in Form der Natur, während „Turmalin“ un-geordnete Figuren und Lebensbilder präsentiert. Die Kapitel fokussieren auf die Repräsentation der Unordnung sowohl auf der Ebene der Geschichte (histoire) als auch der Erzählung (discours).
Das zweite Kapitel widmet sich dem Roman „Der Nachsommer“ sowie der Erzählung „Der fromme Spruch“. Hier werden die Erkenntnisse aus dem ersten Kapitel auf scheinbar geordnetere Texte angewendet. Der Fokus liegt darauf, wie sich das Chaos trotz der scheinbar ordentlichen Oberflächlichkeit in den Texten drängt.
Schlüsselwörter
Adalbert Stifter, Biedermeier, Ordnung, Chaos, Erzähltheorie, „Bergkristall“, „Turmalin“, „Der Nachsommer“, „Der fromme Spruch“, histoire, discours, Idyllisierung, Ambivalenz, Un-Ordnung, Ordnungsstrukturen, Erzählstrategien
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Adalbert Stifter oft als „Poet der Langeweile“ bezeichnet?
Wegen seiner scheinbar endlos idyllisierenden Beschreibungen und der Langatmigkeit seiner Erzählprosa, die oft als ereignisarm wahrgenommen wird.
Was ist das Ziel dieser Arbeit über Stifters Werk?
Die Arbeit möchte zeigen, dass hinter der geordneten Oberfläche ein spannungsvolles Chaos und „Außer-Ordentlichkeit“ stecken.
Wie manifestiert sich das Chaos in der Erzählung „Bergkristall“?
Das Chaos zeigt sich durch eine Schneekatastrophe und den damit verbundenen Orientierungsverlust der Kinder in der Natur.
Welche Rolle spielt der Roman „Der Nachsommer“ in dieser Analyse?
Der Roman dient als Beispiel für eine „ordentliche Un-Ordnung“, bei der sich das Chaos trotz einer perfekt scheinenden Rosen-Welt bemerkbar macht.
Was versteht man unter Stifters „narrativen Strategien“?
Es sind die Techniken, mit denen Stifter Ordnungssysteme aufbaut, die sich an extremen Erfahrungen reiben und so tiefere Strukturen offenbaren.
- Arbeit zitieren
- Inga Wiefhoff (Autor:in), 2007, Ordnung und Chaos im Erzählwerk Adalbert Stifters, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79363