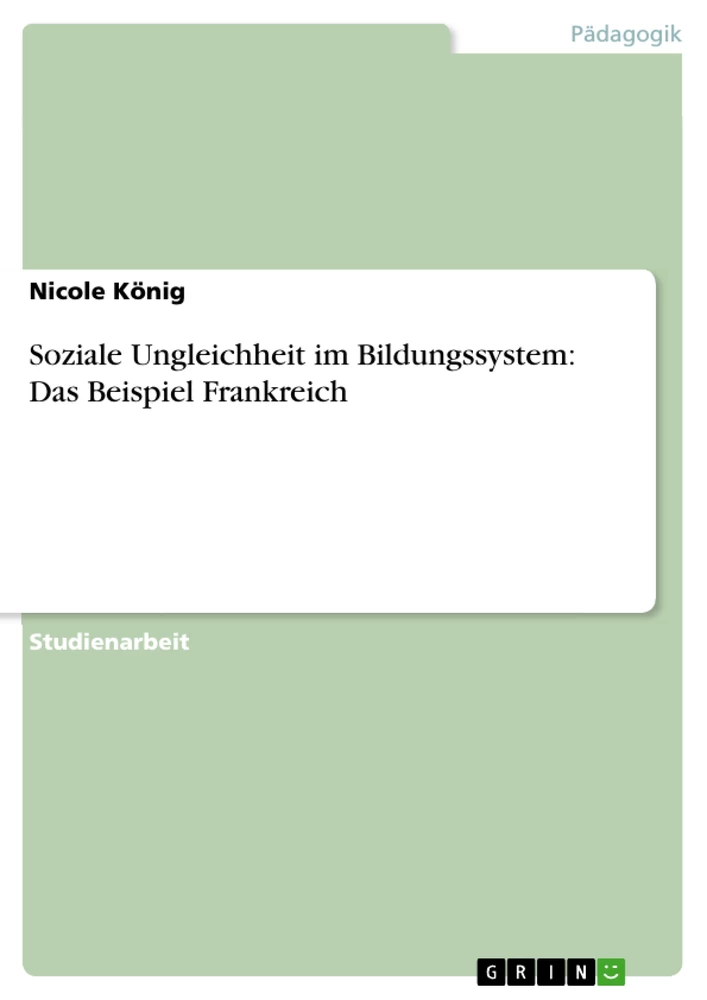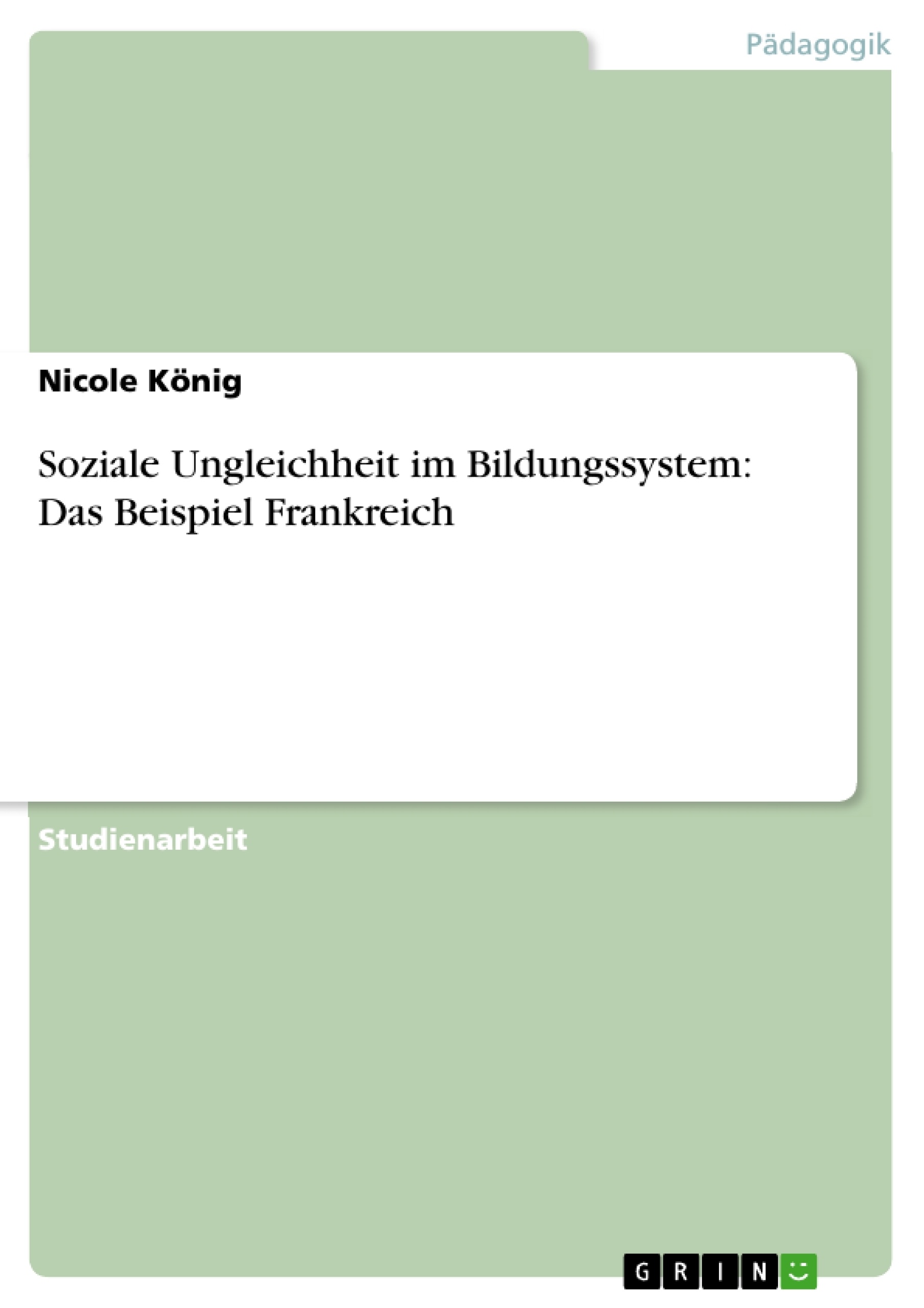Die wissenschaftlichen und sozialkritischen Analysen des Soziologen, Kulturphilosophen und Zeitkritikers Pierre Bourdieu haben nicht nur für Frankreich eine große Bedeutung gewonnen, sondern die Forschungsschwerpunkte des Franzosen erlangten auch in Deutschland im Bereich der Kultur- und Bildungssoziologie eine immer größere Bedeutung. Besonders das Thema „Bildung und soziale Ungleichheit“ steht im Mittelpunkt dieser Debatte.
Der Begriff des Habitus erhielt durch Bourdieu seine Prägung. Seine Erklärung der „Habitus-Theorie“ wird im Zusammenhang mit „Bildung und sozialer Ungleichheit“ von Wichtigkeit, da er die „Klassenkulturen“ für die Aufrechterhaltung von sozialer Ungleichheit verantwortlich macht. Bourdieu geht von einer Ungleichverteilung dreier Ressourcen unter der Bevölkerung aus: dem ökonomischen Kapital, dem Bildungskapital und dem sozialen Kapital. Dadurch gliedern sich die Gesellschaftsmitglieder in eine vertikale Klassenordnung. Das Aufwachsen innerhalb der jeweiligen Lebensbedingungen bestimmter Klassen, lässt Bourdieu zufolge „automatisch“ und weitgehend unbewusst bestimmte Habitusformen entstehen, die dann die Denk-, Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster der Menschen in ihrem Verhalten begrenzen.
Dem Bildungssystem einer Gesellschaft unterstellt Bourdieu eine zentrale Bedeutung in der Reproduktion sozialer Ungleichheiten. Für Bourdieu geht es in der Schule nicht nur um Erziehung, sondern sie dient als Selektionsmittel und produziert demnach nicht nur Wissen, sondern auch Stile, Haltungen, Meinungen und Urteile, ohne das es den Individuen bewusst wird. Nach Bourdieu wird die pädagogische Arbeit als „Einprägungsarbeit“ gesehen, die durch „magische Weiherituale“ legitimiert wird. Nach Bourdieu sind es die Unterrichtsmethoden und Beurteilungsverfahren in den Schulen und Universitäten, die vorhandene Ungleichheiten, indem sie ungleiche Eintrittsbedingungen von SchülerInnen und StudentInnen systematisch ignorieren, bestätigen.
Im Rahmen dieser Arbeit, die den Titel „Soziale Ungleichheit im Bildungssystem: Das Beispiel Frankreich“ trägt, soll betrachtet werden, in wieweit es einen Zusammenhang zwischen schulischen und familiären Habitusformen gibt und wie sie im direkten Zusammenhang mit dem Bildungssystem und Bildungschancen stehen und insbesondere, wie sich die französische „Eliteklasse“ ihren Erhalt sichert.
Bevor ich auf Bourdieu eingehe, werde ich zunächst allgemeine Punkte zum Thema der „sozialen Ungleichheit“ erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff der sozialen Ungleichheit
- Die Habitus-Theorie Pierre Bourdiues
- Bildungsungleichheit im Bildungssystem
- Die Schule ein Institutionsritus
- Bildungschancen und Bildungsungleichheit
- Bildungschancenungleichheit durch ein anerkanntes System: Das Beispiel Frankreich
- Concours général : Ein Elitenrekrutierungsprogramm
- Die Konstruktion des Adels?
- Kommentar
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen schulischen und familiären Habitusformen sowie deren Einfluss auf das Bildungssystem und Bildungschancen, insbesondere im Kontext Frankreichs. Die Analyse konzentriert sich auf die Frage, wie die französische „Eliteklasse“ ihren Erhalt sichert.
- Der Begriff der sozialen Ungleichheit
- Die Habitus-Theorie Pierre Bourdieus und ihre Bedeutung für die Reproduktion sozialer Ungleichheit
- Das Bildungssystem als Reproduktionsmechanismus sozialer Ungleichheiten
- Bildungschancenungleichheit im Vergleich: Deutschland und Frankreich
- Das französische Elitensystem und die Rolle des „Concours général“
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Relevanz der sozialkritischen Analysen Pierre Bourdieus im Kontext von Bildung und sozialer Ungleichheit vor. Der Fokus liegt auf der Habitus-Theorie Bourdieus und ihrer Erklärung der „Klassenkulturen“ als Faktor für die Aufrechterhaltung von sozialer Ungleichheit.
- Der Begriff der sozialen Ungleichheit: Der Begriff „soziale Ungleichheit“ wird definiert und anhand verschiedener Dimensionen (Bildung, materieller Wohlstand, Macht und Prestige) erläutert. Dabei wird auch die Unterscheidung zwischen sozialer Ungleichheit und Ungerechtigkeit hervorgehoben.
- Die Habitus-Theorie Pierre Bourdiues: Bourdieus Habitus-Theorie wird vorgestellt, die von einer ungleichen Verteilung von ökonomischem, Bildungskapital und sozialem Kapital ausgeht und die Entstehung von „Klassenkulturen“ erklärt. Diese Kulturen prägen die Denk-, Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster von Menschen und beeinflussen deren Handeln.
- Bildungsungleichheit im Bildungssystem: Bourdieus Kritik am Bildungssystem als Reproduktionsmechanismus sozialer Ungleichheiten wird erläutert. Er sieht die Schule nicht nur als Ort der Erziehung, sondern auch als Selektionsmittel, das Wissen, Stile und Haltungen reproduziert.
- Bildungschancenungleichheit durch ein anerkanntes System: Das Beispiel Frankreich: Die Arbeit fokussiert auf das französische Bildungssystem und die Rolle des „Concours général“ als Elitenrekrutierungsprogramm. Die Frage steht im Mittelpunkt, inwieweit dieses System zur Konstruktion einer Eliteklasse beiträgt und die Reproduktion sozialer Ungleichheit unterstützt.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Habitus-Theorie, Pierre Bourdieu, Bildungssystem, Bildungschancen, Klassenkulturen, Elitenrekrutierung, Frankreich, „Concours général“
- Quote paper
- Dipl.-Soz.-Wiss. Nicole König (Author), 2007, Soziale Ungleichheit im Bildungssystem: Das Beispiel Frankreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77528