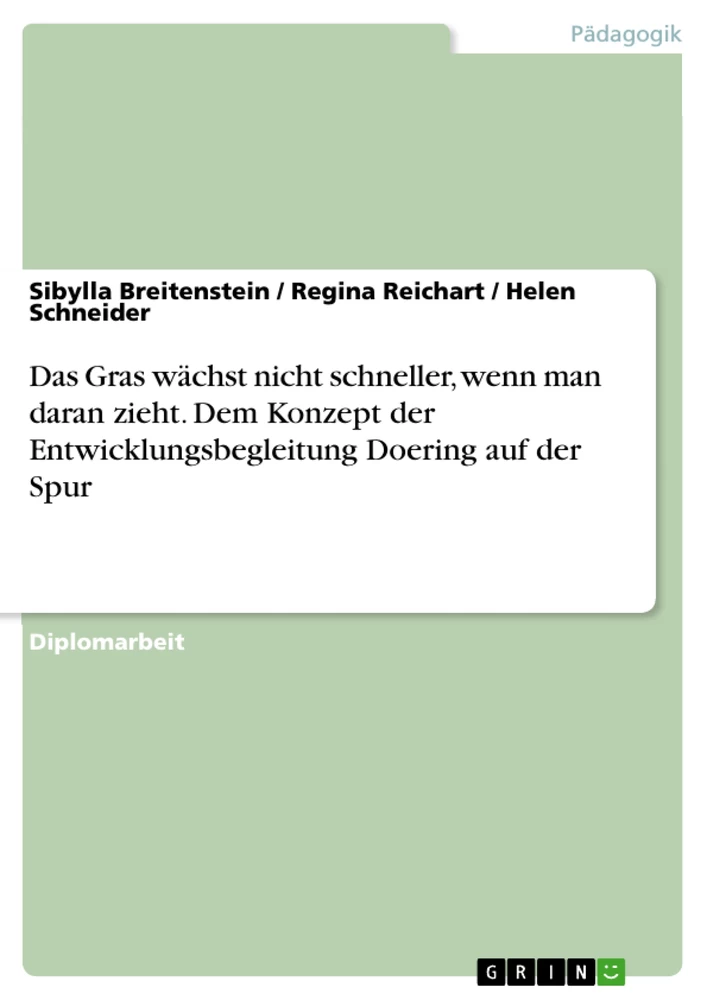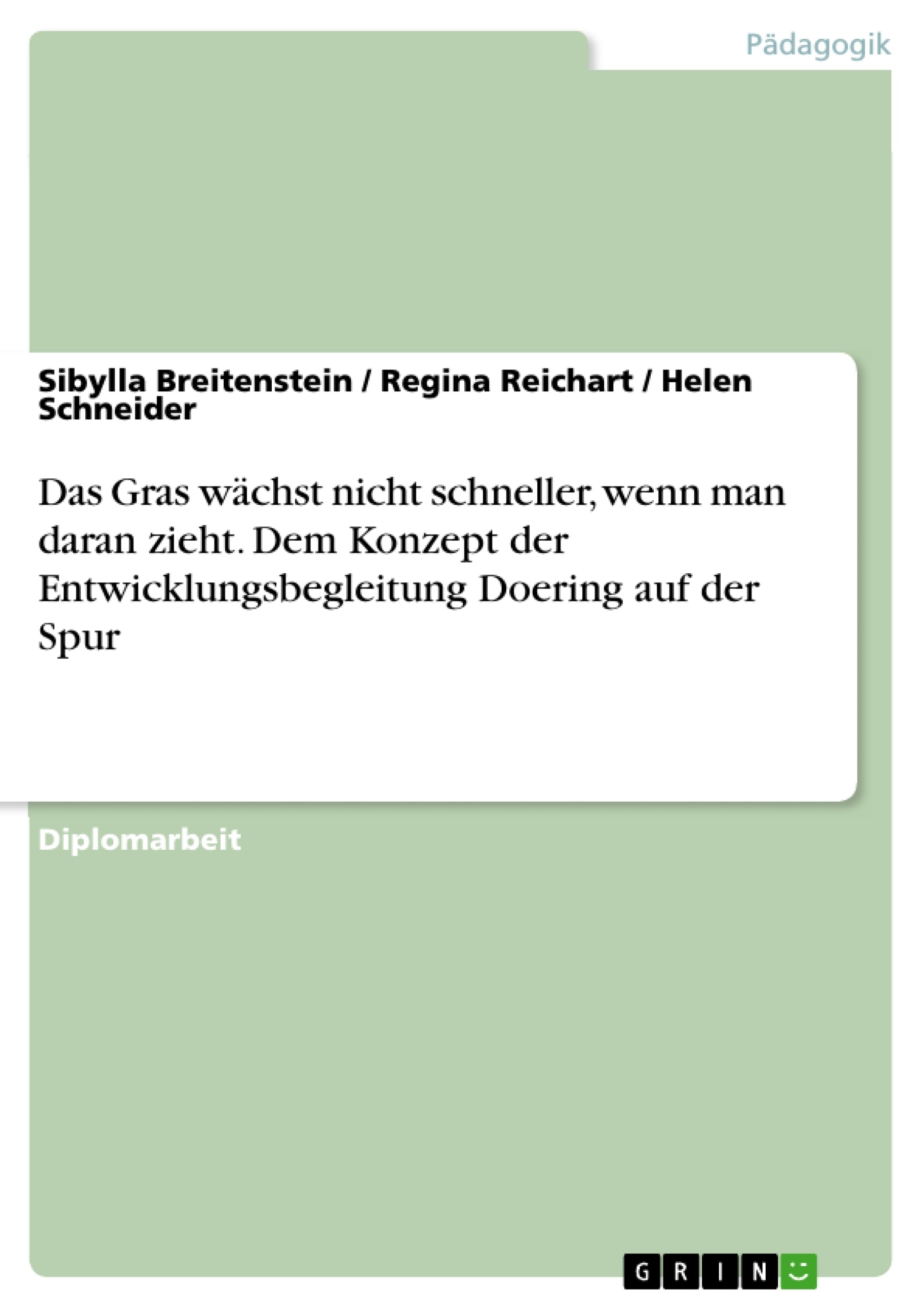Das Konzept der Entwicklungsbegleitung Doering wurde von Waltraut und Winfried Doering, Bremen, entwickelt. Die Entwicklungsbegleitung ist keine starre Methode oder feste Theorie, sie vertritt vielmehr eine Haltung, welche das Kind als Gestalter seiner eigenen Entwicklung betrachtet.Aus der Zielsetzung ergab sich folgende
-> Fragestellung:
Wie können wir das Konzept der Entwicklungsbegleitung Doering in unsere Arbeit als Heilpädagoginnen im Vorschulbereich aufnehmen?
-> Theorie:
Zuerst beschreiben wir das Konzept der Entwicklungsbegleitung Doering und betrachten die Entstehung sowie den Aufbau einer Förderstunde. Wir setzen uns mit dem Begriff Entwicklung auseinander. Das Konzept bezieht sich auf sechs Kernsätze, von welchen wir drei näher beleuchten. Ergänzend dazu berücksichtigen wir eine Auswahl theoretischer Bezüge, die dem Konzept zugrunde liegen.
-> Praxis:
Wir wählen die Methode der Einzelfallstudie und werten zwei heilpädagogische Förderstunden im Vorschulbereich aus. Die Kriterien werden durch die Sichtweisen gebildet, welche durch die Kernsätze vertreten werden.
-> Schlussfolgerungen:
Unsere Haltung gegenüber dem Kind hat sich dahingehend verändert, dass wir in der Arbeit mit ihm, uns vermehrt von diesem leiten lassen. Dies gibt uns eine veränderte kritische Sichtweise auf die Formulierung von Förderzielen, die Durchführung von Fördereinheiten, die Gestaltung der Tagesabläufe und die Auswahl des Materials. Wir können die dem Konzept zugrunde liegende Haltung übernehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Abstract
- Einleitung
- Ziele und Fragestellung
- Vorgehen
- Methodenwahl
- Das Konzept der Entwicklungsbegleitung Doering
- Die Ursprünge der Entwicklungsbegleitung Doering
- Das Institut
- Sechs Kernsätze
- Was ist das Besondere des Konzeptes Doering?
- Was hat uns angesprochen?
- Der Aufbau der Therapiestunden
- Bereich des sensomotorischen Ausdrucks
- Bereich der Repräsentation
- Verschiedene Arten von Therapiestunden
- Räumliche Bedingungen
- Der Entwicklungsgedanke - ein Exkurs
- Die Psychomotorische Praxis Aucouturier
- Das Kind als Akteur seiner Entwicklung
- Entwicklung der Einheit des Selbst
- Die archaischen Verlustängste des Körpers
- Der tonisch - emotionale Dialog
- Das Konzept des Handelns
- Spiele der tiefgreifenden Rückversicherung
- Der Weg in die Herausbildung der Identität
- Der Entwicklungsbegriff im Konzept Doering
- Aspekte der vorgeburtlichen Zeit
- Weitere Sichtweisen auf die Entwicklung
- Heinrich Jacoby
- Elfriede Hengstenberg
- Emmi Pikler
- Hans von Lüpke: Entwicklung im Netzwerk
- Einige Definitionen von Entwicklung
- Das Wissen um Entwicklung und Fördermöglichkeiten beim Kind
- Drei ausgewählte Kernsätze aus dem Konzept Entwicklungsbegleitung Doering
- Begründung der Auswahl der drei Schwerpunkte
- Der Dialog ist der Weg der Entwicklung
- Verschiedene Definitionen von „Dialog“
- Beispiel aus der Literatur
- Verschiedene Theorien
- Wann entstehen die ersten Dialoge und wie entwickeln sie sich?
- Die Sprache im Zusammenhang mit der Dialogfähigkeit
- Die Entwicklung im Dialog aus der Sicht des Instituts Doering
- Entwicklung vollzieht sich in einem Wechselspiel zwischen Stabilität und Instabilität
- Entwicklung ist Veränderung
- Chaosforschung: Chaos - eine Wissenschaft vom Werden
- Konstruktivismus
- Die Einheit von Körper, Seele und Geist
- Körper, Seele und Geist - verschiedene Definitionen
- Findet sich die Einheit von Körper, Seele und Geist auf dem Gebiete der Entwicklungspsychologie wieder?
- Folgerungen aus den theoretischen Bezügen der drei ausgewählten Kernsätze
- Die Bedeutung des Dialoges
- Die Bedeutung von Stabilität – Instabilität
- Die Bedeutung der Einheit von Körper, Seele und Geist
- Weiterführende Gedanken
- Verbindung mit der Praxis
- Erstes Beispiel aus der Praxis
- Was wir beobachtet haben
- Interpretation der Fördereinheit
- Zweites Beispiel aus der Praxis
- Was wir beobachtet haben
- Interpretation der Fördereinheit
- Eingehen auf Ziele, Fragestellung, These und Methodenwahl
- Ziele
- Fragestellung
- These
- Methodenwahl
- Unser Weg
- Literaturverzeichnis
- Internetquellen
- Abbildungsverzeichnis
- Stundenprotokolle
- Beispiel 1 aus der Praxis
- Beispiel 2 aus der Praxis
- Anhang
- Das Leichte ist das Schwere
- Der Neugierologe
- Der Kult um die Kleinsten
- Erlebnisraum Mutterleib
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem Konzept der Entwicklungsbegleitung Doering, einem pädagogischen Ansatz zur Förderung von Kindern mit Entwicklungsverzögerungen. Die Arbeit analysiert die theoretischen Grundlagen des Konzeptes und untersucht, wie die zentrale Idee der Entwicklungsbegleitung in der Praxis umgesetzt werden kann.
- Die Bedeutung des Dialogs in der Entwicklung von Kindern
- Das Zusammenspiel von Stabilität und Instabilität in der Entwicklung
- Die Einheit von Körper, Seele und Geist im Entwicklungsprozess
- Die Praxisanwendung des Konzeptes der Entwicklungsbegleitung Doering
- Die Relevanz der Beziehungsgestaltung in der heilpädagogischen Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Diplomarbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Ziele und Fragestellungen der Arbeit erläutert. Anschliessend wird das Konzept der Entwicklungsbegleitung Doering vorgestellt, seine Ursprünge, Kernsätze und Besonderheiten werden beleuchtet. Im Weiteren befasst sich die Arbeit mit dem Entwicklungsgedanken an sich, indem sie verschiedene theoretische Perspektiven auf die Entwicklung von Kindern beleuchtet, darunter die Psychomotorische Praxis Aucouturier und die Ansätze von Jacoby, Hengstenberg, Pikler und Lüpke. Die Arbeit konzentriert sich anschliessend auf drei ausgewählte Kernsätze des Konzeptes Doering, untersucht deren theoretische Grundlagen und diskutiert ihre praktische Relevanz. Schliesslich wird die Anwendung des Konzeptes in der Praxis anhand von zwei Beispielen aus der Praxis beleuchtet und die Ergebnisse der Arbeit im Kontext der ursprünglichen Ziele und Fragestellungen zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Entwicklungsbegleitung Doering, Dialog, Stabilität, Instabilität, Körper, Seele, Geist, Beziehungsgestaltung, Förderung, Entwicklungsverzögerung, heilpädagogische Praxis.
- Arbeit zitieren
- Sibylla Breitenstein (Autor:in), Regina Reichart (Autor:in), Helen Schneider (Autor:in), 2007, Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Dem Konzept der Entwicklungsbegleitung Doering auf der Spur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77470