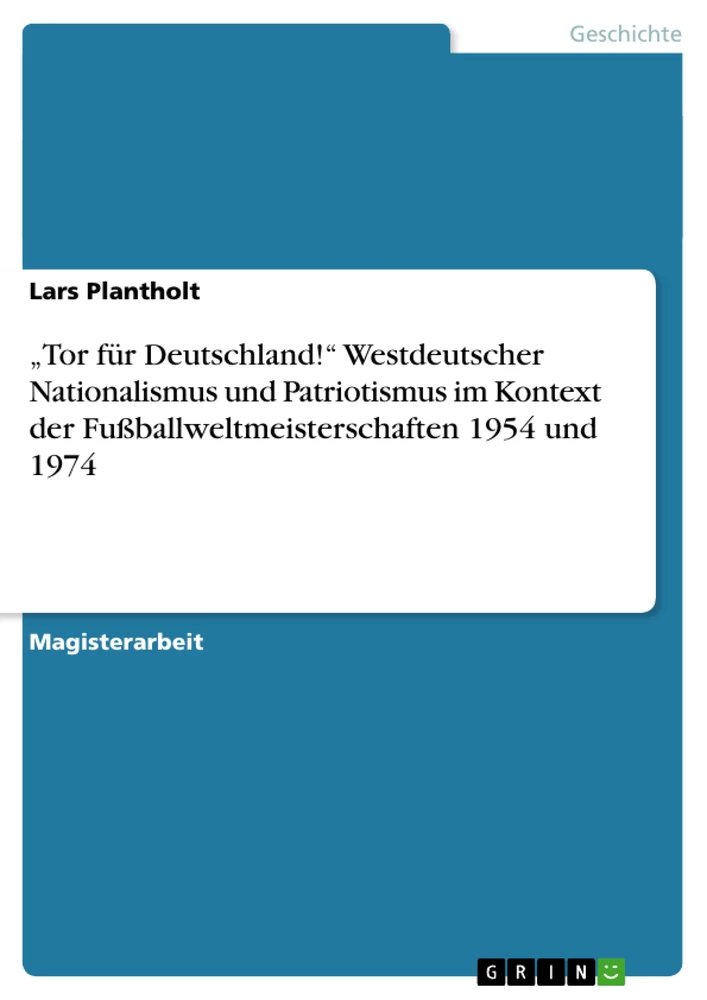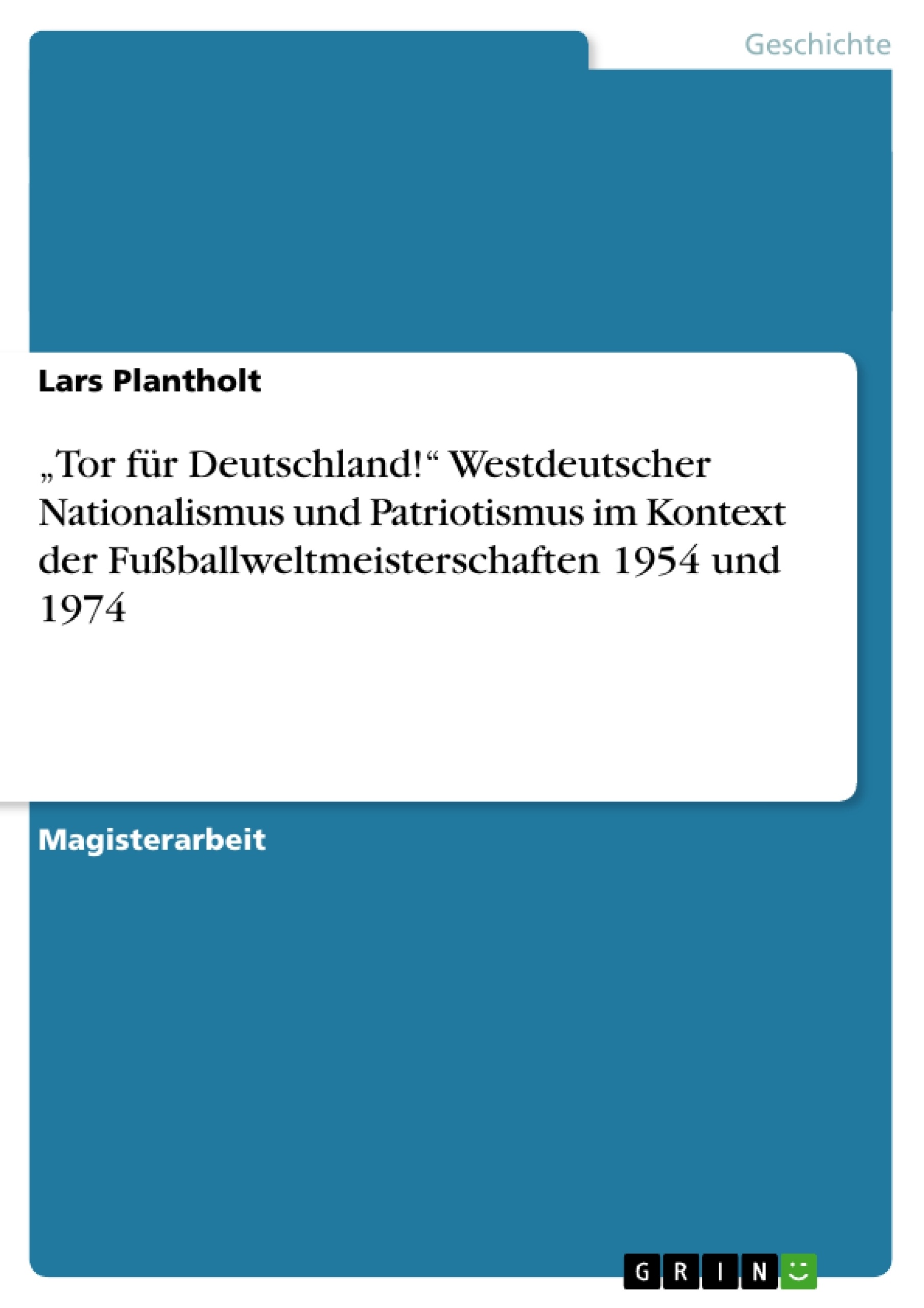Das kollektive Daumenhalten konnte die Niederlage in London nicht verhindern. Wenige Minuten nachdem der Reporter zur Bildung der gesamtdeutschen Gemeinschaft an den heimischen Radiogeräten aufrief, leitete der englische Stürmer Geoffrey Hurst mit dem berühmten ‚Wembleytor‘ die Niederlage der bundesdeutschen Fußballnationalmannschaft ein.
Zwölf Jahre zuvor und acht Jahre später konnte diese indes die jeweiligen Endspiele für sich entscheiden - mit höchst unterschiedlichen Vorzeichen und Folgen. Während dem Titel von 1974 stets eine allenfalls sportliche Bedeutung beigemessen wurde, wird der scheinbar sensationelle Sieg über die Auswahl Ungarns am 4. Juli 1954 als ein die noch junge Bundesrepublik nachhaltig konsolidierendes Ereignis angesehen. Die Kommunikation dieses Endspiels und seine Verankerung in der populären Erinnerungskultur führten in der Folge dazu, dass dem Spiel bzw. dem Spielort bisweilen tatsächlich der Charakter eines lieux de mémoire für die Bundesrepublik Deutschland zuerkannt wird.
1966 zählte der Kommentator des Endspiels zur Daumen drückenden Gemeinschaft auch die Bürger der DDR. Die seinerzeit nicht unübliche Betonung einer gesamtdeutschen Identität fand also sichtbar bzw. in diesem Falle hörbar auch im Kontext des Fußballs statt. Nicht wenige fühlen sich in diesem Zusammenhang immer wieder ermuntert, auf die scheinbar nahe liegende Symbolik des deutschen WM-Titels von 1990 als gewissermaßen emotionalen Vollzug der deutschen Einheit hinzuweisen. Doch die (symbolische) Bedeutung der Nationalelf für Zustand und Perspektive der Nation scheint sich darüber hinaus ungebrochen bis in unsere Gegenwart fortzusetzen, wie eine Beobachtung der Süddeutschen Zeitung ein Jahr vor der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland glauben lässt:
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Ziel und Konzeption der Arbeit
- 1.1 Forschungsstand
- 2. Nation und Fußball
- 2.1 Nation und Nationalismus
- 2.1.1 Nationalismus und Patriotismus: Kerngedanken und Definitionen
- 2.1.2 Nationalismus als „Politische Religion“
- 2.1.3 Nationalismus und Patriotismus in Deutschland
- 2.2 Fußball und (nationale) Identität
- 2.3 Fußball als quasi-religiöses und rituelles Ereignis
- 2.1 Nation und Nationalismus
- 3. Fußball und Fußballkultur in Deutschland 1890-1980
- 3.1 Vom gentleman's zum people's game: Der Ursprung des modernen Fußballs in England
- 3.2 Vom Gesellschafts- zum Soldatenspiel: Fußball im Kaiserreich
- 3.3 Berufssport vs. Amateurprinzip: Fußball in der Weimarer Republik
- 3.4 Staatsamateure und Propagandaspiele: Fußball im Dritten Reich
- 3.5 Kontinuität und Diskontinuität: Fußball in der BRD bis 1974
- 4. Untersuchung der Fußballweltmeisterschaften 1954 und 1974
- 4.1 Art und Auswahl der Printmedien
- 4.1.1 Frankfurter Allgemeine Zeitung
- 4.1.2 Frankfurter Rundschau
- 4.1.3 Bild-Zeitung
- 4.2 Sport und Sportsprache in den Medien
- 4.3 Koordinaten der Untersuchung
- 4.4 Die WM 1954 in der Schweiz
- 4.4.1 Die WM 1954 und ihre Zeit
- 4.4.2 BRD-Türkei (17.6.1954)
- 4.4.3 Ungarn - BRD (20.6.1954)
- 4.4.4 BRD-Türkei (23.6.1954)
- 4.4.5 BRD – Jugoslawien (27.6.1954)
- 4.4.6 BRD - Österreich (30.6.1954)
- 4.4.7 BRD-Ungarn (4.7.1954)
- 4.4.8 Zwischenfazit
- 4.5 Die WM 1974 in der Bundesrepublik Deutschland
- 4.5.1 Die WM 1974 und ihre Zeit
- 4.5.2 Australien - BRD (18.6.1974)
- 4.5.3 BRD Chile (14.6.1974)
- 4.5.4 DDR - BRD (22.6.1974)
- 4.5.5 Jugoslawien - BRD (26.6.1974)
- 4.5.6 BRD Schweden (30.6.1974)
- 4.5.7 Polen BRD (3.7.1974)
- 4.5.8 Niederlande - BRD (7.7.1974)
- 4.1 Art und Auswahl der Printmedien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Fußballweltmeisterschaften von 1954 und 1974 auf die westdeutsche nationale Identität und den Patriotismus. Sie analysiert die mediale Darstellung dieser Ereignisse und deren Rezeption in der Bevölkerung.
- Westdeutscher Nationalismus und Patriotismus im Kontext des Fußballs
- Die Rolle des Fußballs in der nationalen Identitätsbildung der BRD
- Mediale Inszenierung und Rezeption der Fußballweltmeisterschaften
- Vergleich der WM 1954 und 1974 hinsichtlich ihrer politischen und gesellschaftlichen Bedeutung
- Fußball als Spiegel der bundesdeutschen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung der Fußballweltmeisterschaften von 1954 und 1974 für die westdeutsche Identität dar. Sie verortet die Arbeit im bestehenden Forschungsstand und skizziert die methodische Vorgehensweise. Der Vergleich der beiden Turniere, insbesondere im Hinblick auf deren unterschiedliche Rezeption in der öffentlichen Erinnerung, bildet den roten Faden der Arbeit. Die Niederlage von 1966 dient als Kontrastfolie und hebt die besondere Bedeutung der Siege von 1954 und 1974 hervor.
2. Nation und Fußball: Dieses Kapitel analysiert den komplexen Zusammenhang zwischen Nation, Nationalismus und Fußball. Es definiert die Begriffe Nationalismus und Patriotismus und untersucht deren Bedeutung im deutschen Kontext. Der Fußball wird als ein Instrument der nationalen Identitätsbildung betrachtet, dessen quasi-religiöse und rituelle Aspekte beleuchtet werden. Der Fokus liegt auf der Frage, wie Fußball zur Stärkung des Nationalgefühls beitragen kann.
3. Fußball und Fußballkultur in Deutschland 1890-1980: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung des Fußballs in Deutschland vom späten 19. Jahrhundert bis 1974. Es beschreibt die Transformation des Fußballs vom elitären „gentleman's game“ zum populären „people's game“, seine Instrumentalisierung im Kaiserreich und im Dritten Reich sowie seine Rolle in der Weimarer Republik und der jungen Bundesrepublik. Die Kapitel beleuchten die Kontinuitäten und Brüche in der Geschichte des deutschen Fußballs und die damit einhergehende Entwicklung der Fußballkultur.
4. Untersuchung der Fußballweltmeisterschaften 1954 und 1974: Dieses Kapitel analysiert die mediale Berichterstattung über die Weltmeisterschaften 1954 und 1974. Es untersucht die ausgewählten Printmedien (FAZ, Frankfurter Rundschau, Bild-Zeitung) auf ihre Darstellung von Sport und Sportsprache. Der Vergleich der Berichterstattung über einzelne Spiele beider Turniere steht im Mittelpunkt, um die jeweilige politische und gesellschaftliche Bedeutung der Ereignisse herauszuarbeiten. Die Analyse zeigt, wie die Medien zur Konstruktion und Verbreitung nationaler Mythen beitragen.
Schlüsselwörter
Westdeutscher Nationalismus, Patriotismus, Fußballweltmeisterschaft, Fußballkultur, Medien, nationale Identität, BRD, 1954, 1974, Identitätsbildung, Erinnerungskultur, mediale Inszenierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Fußballweltmeisterschaften 1954 und 1974 und die westdeutsche Identität
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Fußballweltmeisterschaften von 1954 und 1974 auf die westdeutsche nationale Identität und den Patriotismus. Sie analysiert die mediale Darstellung dieser Ereignisse und deren Rezeption in der Bevölkerung, insbesondere im Vergleich der beiden Turniere.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Bedeutung hatten die Fußballweltmeisterschaften von 1954 und 1974 für die westdeutsche Identität? Zusätzlich werden Fragen nach der Rolle des Fußballs in der nationalen Identitätsbildung der BRD, der medialen Inszenierung und Rezeption der Weltmeisterschaften und dem Vergleich der beiden Turniere hinsichtlich ihrer politischen und gesellschaftlichen Bedeutung untersucht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den westdeutschen Nationalismus und Patriotismus im Kontext des Fußballs, die Rolle des Fußballs in der nationalen Identitätsbildung der BRD, die mediale Inszenierung und Rezeption der Fußballweltmeisterschaften, den Vergleich der WM 1954 und 1974 sowie den Fußball als Spiegel der bundesdeutschen Gesellschaft.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit analysiert die mediale Berichterstattung über die Weltmeisterschaften 1954 und 1974 in ausgewählten Printmedien: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau und Bild-Zeitung. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung von Sport und Sportsprache sowie den Vergleich der Berichterstattung über einzelne Spiele beider Turniere.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, die die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz erläutert; ein Kapitel zum Zusammenhang zwischen Nation, Nationalismus und Fußball; ein Kapitel zur Entwicklung des Fußballs in Deutschland von 1890-1980; und ein Kapitel zur Analyse der medialen Berichterstattung über die Weltmeisterschaften 1954 und 1974.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Westdeutscher Nationalismus, Patriotismus, Fußballweltmeisterschaft, Fußballkultur, Medien, nationale Identität, BRD, 1954, 1974, Identitätsbildung, Erinnerungskultur, mediale Inszenierung.
Welche Ergebnisse werden erwartet?
Die Arbeit soll aufzeigen, wie die Fußballweltmeisterschaften von 1954 und 1974 zur Konstruktion und Verbreitung nationaler Mythen beitrugen und welche Rolle der Fußball in der nationalen Identitätsbildung der BRD spielte. Der Vergleich der beiden Turniere soll deren unterschiedliche Bedeutung für die westdeutsche Gesellschaft hervorheben.
Wie wird der Vergleich der WM 1954 und 1974 durchgeführt?
Der Vergleich erfolgt durch eine detaillierte Analyse der medialen Berichterstattung beider Turniere in den ausgewählten Printmedien. Dabei wird die Darstellung von einzelnen Spielen, die verwendete Sprache und der Kontext der jeweiligen Zeit betrachtet.
Welche Rolle spielt die Niederlage von 1966?
Die Niederlage von 1966 dient als Kontrastfolie und hebt die besondere Bedeutung der Siege von 1954 und 1974 hervor, indem sie den Kontext und die emotionale Wirkung der Erfolge verdeutlicht.
Wie wird der Begriff Nationalismus definiert?
Die Arbeit definiert Nationalismus und Patriotismus und untersucht deren Bedeutung im deutschen Kontext. Der Fokus liegt auf der Frage, wie Fußball zur Stärkung des Nationalgefühls beitragen kann und wie sich dies in der medialen Berichterstattung widerspiegelt.
- Quote paper
- Lars Plantholt (Author), 2005, „Tor für Deutschland!“ Westdeutscher Nationalismus und Patriotismus im Kontext der Fußballweltmeisterschaften 1954 und 1974, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77224