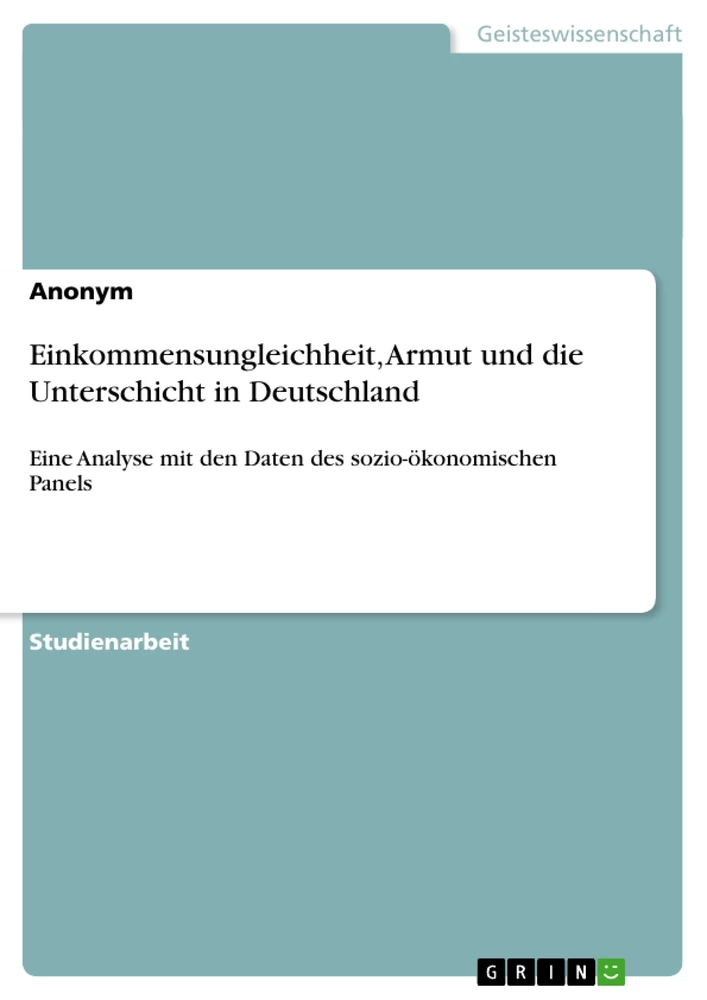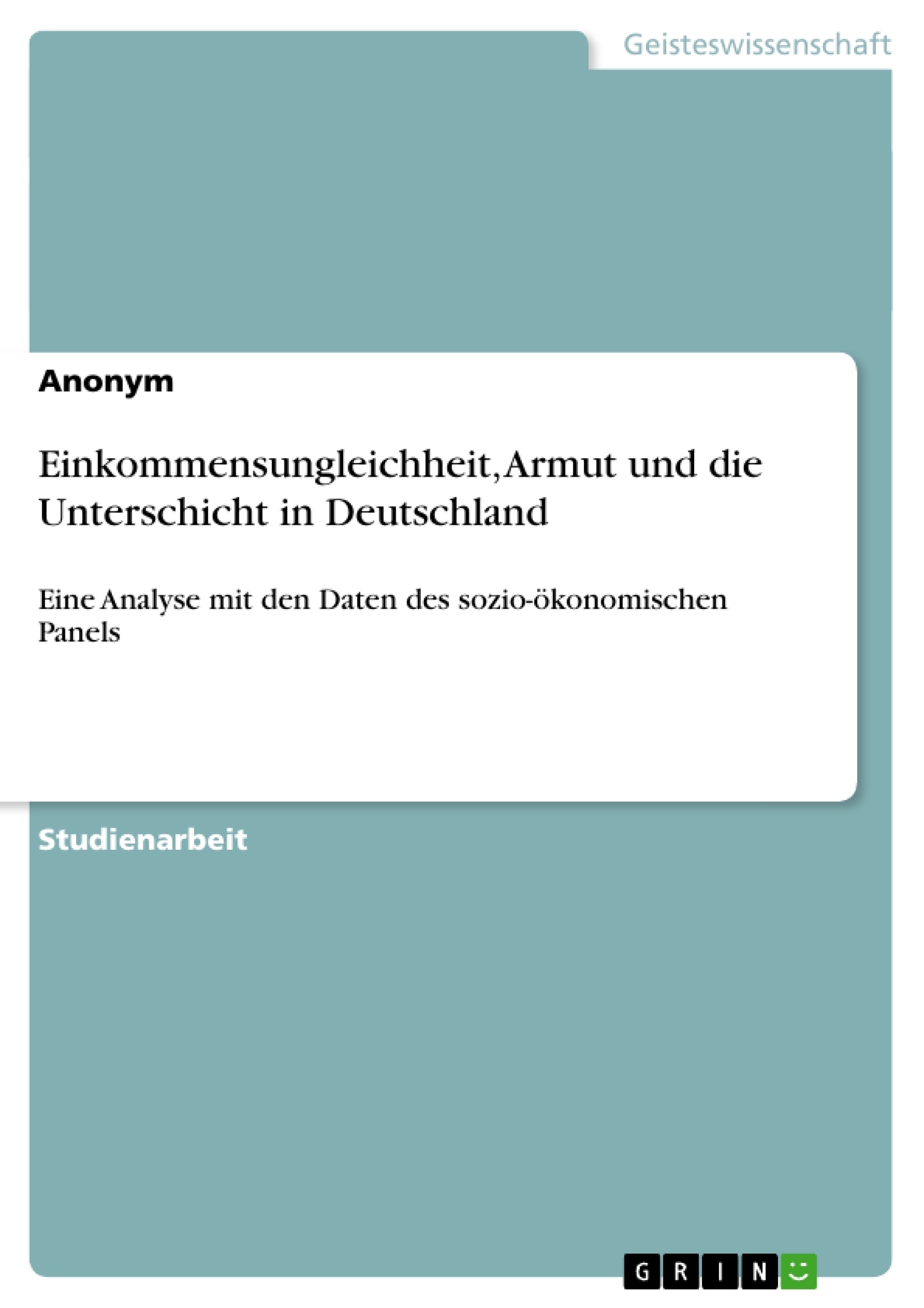In einer der Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung wurde anhand einer repräsentativen Befragung von rund 3000 wahlberechtigten Personen in Deutschland zu Alltageinstellungen, politischen Einstellungen, Werteorientierungen, Religiosität und soziastrukturellen Merkmalen eine Typologie neun politsicher Milieus der deutschen Gesellschaft erstellt. Bei einem dieser Milieus handelt es sich um das so genannte „abgehängte Prekariat“, das der Studie zu Folge 8% der deutschen Bevölkerung ausmacht.
Das „abgehängte Prekariat“, das in der Öffentlichkeit auch als „neue Unterschicht“ bezeichnet wurde, löste eine vehemente politische Diskussion aus, und zwar nicht nur der Wortwahl wegen, sondern auch auf Grund des Bildes, das die Studie von den Betroffenen zeichne. Kurt Beck, Parteichef der SPD, sprach von einem wachsenden „Unterschichten-Problem“, Arbeitsminister Franz Müntefering hingegen lehnte den Begriff „Unterschicht“ ab, es gebe keine Schichten in Deutschland. Unionsfraktionschef Volker Kauder wies die Bezeichnung „Unterschicht“ ebenfalls zurück, dieser Ausdruck sei stigmatisierend. Der SPD-Linke Ottmar Schreiner gibt der Hartz-IV-Politik des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder eine Mitschuld an der gesellschaftlichen Misere, Schröder habe zu kurz gedacht.
An diese Diskussion anschließend wird das Phänomen der „Unterschicht“ in einer deskriptiven Analyse beleuchtet. Im zweiten Kapitel werden daher vorab der Begriff der sozialen Schichtung und seine Verwendung in der Soziologie beschrieben, sowie zentrale Theorien und Problematiken des Schichtbegriffs dargestellt. Im dritten Kapitel werden die Datengrundlage und u.a. das methodische Vorgehen bei der Operationalisierung von „Unterschicht“ erläutert.
Im vierten Abschnitt wird zunächst die Entwicklung der Einkommensverteilung in Deutschland untersucht. Hat das Ausmaß der Armut zugenommen? Sind eher Männer oder Frauen bzw. Westdeutsche oder Ostdeutsche von Armut betroffen? Welche Altersunterschiede lassen sich feststellen? Wie sieht der Trend in anderen europäischen Ländern aus und wie lassen sich mögliche Unterschiede erklären?
In Kapitel fünf wird überprüft, wie sich der Umfang der Unterschicht in Deutschland im Laufe der Zeit entwickelt hat. Lassen sich dabei Geschlechts- und Ost-West-Unterschiede feststellen? Gehören eher Männer oder Frauen bzw. Ost- oder Westdeutsche der Unterschicht an? Welche Altersstruktur kennzeichnet die Unterschicht? Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Die Debatte um die „neue Unterschicht“
- Der Begriff der sozialen Schichtung in der Soziologie
- Daten und Methoden
- Datenbasis
- Das Konzept des Äquivalenzeinkommens
- Die Operationalisierung von „Unterschicht“
- Einkommensungleichheit und Armut
- Entwicklung der Einkommensverteilung in Deutschland
- Armut in Deutschland
- Deutschland im internationalen Vergleich
- Ursachen für die Unterschiede
- Die deutsche Unterschicht
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Einkommensungleichheit, Armut und die Unterschicht in Deutschland anhand von Daten des sozio-ökonomischen Panels. Die Zielsetzung besteht darin, die soziale Struktur Deutschlands zu beleuchten und die Entwicklung der Einkommensverteilung, Armut und die Zusammensetzung der Unterschicht zu untersuchen.
- Entwicklung der Einkommensverteilung in Deutschland
- Armut in Deutschland und im internationalen Vergleich
- Definition und Charakterisierung der „Unterschicht“
- Ursachen für Einkommensungleichheit und Armut
- Zusammensetzung und Merkmale der deutschen Unterschicht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Debatte um die „neue Unterschicht“: Die Einleitung diskutiert die Studie "Politische Milieus in Deutschland" der Friedrich-Ebert-Stiftung. Diese Studie hebt eine Diskrepanz zwischen staatlicher Reformpolitik und der öffentlichen Wahrnehmung hervor. Ein besonderer Fokus liegt auf dem "abgehängten Prekariat", einer Gruppe mit niedrigem sozialem Status, geringer Bildung und hoher Arbeitslosigkeit, die sich prekär und gesellschaftlich abgehängt fühlt. Diese Gruppe wird als Beispiel für die Herausforderungen der deutschen Sozialstruktur herangezogen.
Der Begriff der sozialen Schichtung in der Soziologie: Dieses Kapitel (nicht im Auszug vorhanden, aber für den Inhaltsverzeichniseintrag notwendig) würde voraussichtlich verschiedene soziologische Theorien und Ansätze zur Erklärung sozialer Schichtung vorstellen und definieren, wie soziale Ungleichheit gemessen und analysiert werden kann. Es würde theoretische Grundlagen für die spätere empirische Analyse liefern.
Daten und Methoden: Dieses Kapitel beschreibt die Datenbasis (sozio-ökonomisches Panel), das Konzept des Äquivalenzeinkommens zur Berücksichtigung unterschiedlicher Haushaltsgrößen, und die Operationalisierung des Begriffs „Unterschicht“ für die empirische Analyse. Es legt die methodischen Grundlagen der Studie dar und rechtfertigt die gewählte Vorgehensweise.
Einkommensungleichheit und Armut: Dieser Abschnitt analysiert die Einkommensverteilung in Deutschland, Armutsquoten und den internationalen Vergleich. Er präsentiert Daten zur Entwicklung der Einkommensungleichheit über die Zeit, untersucht die Ausprägung von Armut in Deutschland, vergleicht diese mit anderen Ländern und sucht nach Erklärungen für die festgestellten Unterschiede. Grafiken und Tabellen würden vermutlich die Entwicklung der Einkommensverteilung und die Armutsquoten veranschaulichen.
Die deutsche Unterschicht: Dieses Kapitel (nicht im Auszug detailliert beschrieben) würde die Merkmale der deutschen Unterschicht im Detail untersuchen, möglicherweise untergliedert nach demografischen Merkmalen wie Geschlecht, Alter und Region. Es würde die Ergebnisse der empirischen Analyse darstellen und die Zusammensetzung der Unterschicht beschreiben. Die Ergebnisse würden die vorherigen Kapitel ergänzen und ein umfassenderes Bild der sozialen Ungleichheit in Deutschland liefern.
Schlüsselwörter
Einkommensungleichheit, Armut, Unterschicht, Soziale Schichtung, Deutschland, Sozio-ökonomisches Panel, Äquivalenzeinkommen, Internationale Vergleiche, Reformpolitik, Prekariat.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Einkommensungleichheit, Armut und die „neue Unterschicht“ in Deutschland
Was ist der Gegenstand der Studie?
Die Studie analysiert Einkommensungleichheit, Armut und die „Unterschicht“ in Deutschland. Sie untersucht die Entwicklung der Einkommensverteilung, die Ausprägung von Armut im nationalen und internationalen Vergleich und die Zusammensetzung der Unterschicht. Die Datenbasis bildet das sozio-ökonomische Panel.
Welche Themen werden behandelt?
Die Studie behandelt die Debatte um die „neue Unterschicht“, den Begriff der sozialen Schichtung in der Soziologie, die verwendeten Daten und Methoden (inkl. Äquivalenzeinkommen), die Entwicklung der Einkommensungleichheit und Armut in Deutschland im internationalen Vergleich, sowie eine detaillierte Beschreibung der deutschen Unterschicht.
Welche Daten werden verwendet?
Die Studie basiert auf Daten des sozio-ökonomischen Panels. Das Konzept des Äquivalenzeinkommens wird verwendet, um unterschiedliche Haushaltsgrößen zu berücksichtigen. Die „Unterschicht“ wird anhand einer methodisch definierten Operationalisierung erfasst.
Wie wird die „Unterschicht“ definiert?
Die Studie operationalisiert den Begriff „Unterschicht“ methodisch. Die genaue Definition wird im Kapitel "Daten und Methoden" erläutert. Es wird auf die Herausforderungen der Definition und Messung dieser sozialen Gruppe eingegangen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Studie präsentiert Ergebnisse zur Entwicklung der Einkommensverteilung, Armutsquoten in Deutschland im internationalen Vergleich und eine detaillierte Charakterisierung der deutschen Unterschicht (inkl. demografischer Merkmale). Die Ergebnisse werden in Grafiken und Tabellen veranschaulicht.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Studie?
Die Studie liefert ein umfassendes Bild der sozialen Ungleichheit in Deutschland. Sie beleuchtet die Zusammenhänge zwischen Einkommensungleichheit, Armut und der Zusammensetzung der Unterschicht. Die konkreten Schlussfolgerungen sind im Kapitel "Zusammenfassung" zusammengefasst.
Welche Rolle spielt der internationale Vergleich?
Die Studie vergleicht die Armutsquoten Deutschlands mit denen anderer Länder, um die Situation in Deutschland im internationalen Kontext einzuordnen und mögliche Ursachen für Unterschiede zu untersuchen.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Studie stützt sich auf soziologische Theorien und Ansätze zur Erklärung sozialer Schichtung (detailliert im Kapitel "Der Begriff der sozialen Schichtung in der Soziologie"). Diese liefern die theoretischen Grundlagen für die empirische Analyse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Einkommensungleichheit, Armut, Unterschicht, Soziale Schichtung, Deutschland, Sozio-ökonomisches Panel, Äquivalenzeinkommen, Internationale Vergleiche, Reformpolitik, Prekariat.
Wo finde ich mehr Informationen?
Die vollständigen Ergebnisse und die detaillierten Analysen finden sich im Haupttext der Studie. Dieser Auszug dient lediglich als umfassender Überblick.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2007, Einkommensungleichheit, Armut und die Unterschicht in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77173