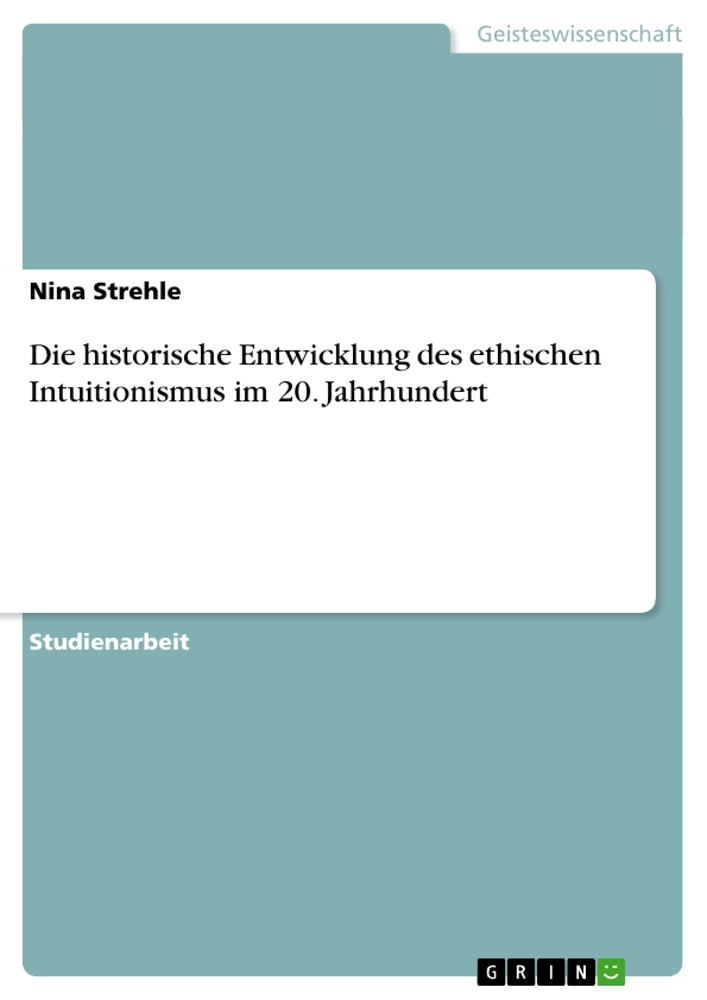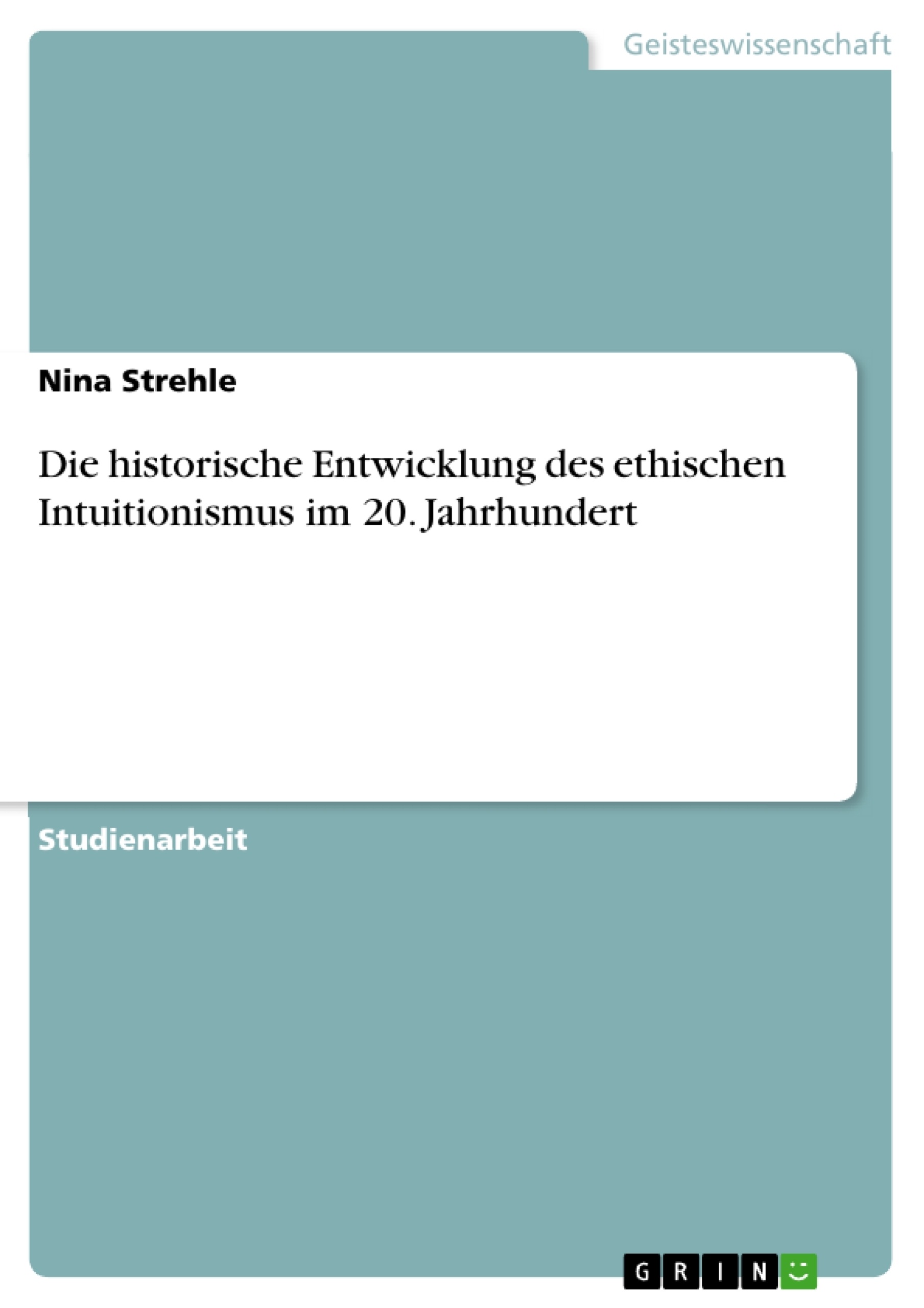1 Einleitung
Der ethische Intuitionismus bezeichnet eine Klasse im einzelnen voneinander abweichender erkenntnistheoretischer Auffassungen, nach denen Moralurteilen und -prinzipien objektive moralische Eigenschaften zugrunde liegen. Diese können wir unmittelbar zur Kenntnis nehmen.
Im 18. Jahrhundert herrscht die Lehre vom moral sense vor, nach der es ein inneres Organ zur Wahrnehmung moralischer Eigenschaften einer Handlung gibt. Diese löst in Abhängigkeit ihrer sittlichen Qualität eine Empfindung der Lust oder Unlust aus, die das moralische Urteil leitet und das Motiv für weiteres Handeln darstellt.
Im ausgehenden 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfährt der britische Intuitionismus eine Erneuerung, die sich vor allem gegen die empiristische Begründung1 des Utilitarismus2 wendet. Im deutschen Sprachraum entwickelt Franz Brentano mit Hilfe deskriptiver psychologischer Methoden eine Wertethik, bei der utilitaristische Rücksichten maßgebend sind. Nach Brentano gibt es drei Klassen psychischer Phänomene: Vorstellungen, Urteile und Gemütsbewegungen. Urteile kennzeichnen Akte des Bejahens bzw. Verneinens eines Vorstellungsinhalts. Gemütsbewegungen werden in Analogie zu den Urteilsakten gesehen; sie sind entweder bejahend (Liebe) oder verneinend (Hass) und sie sind richtig oder unrichtig. Demgemäss ist die Liebe richtig, wenn sie einem Gegenstand gilt, der es wert ist, geliebt zu werden. Diese Vorgehensweise ermöglicht Brentano, die Ethik parallel zur Logik zu konzipieren.
Von Brentano stark beeinflusst, knüpft auch G. E. Moore an die normativen Grundüberzeugungen des Utilitarismus an. Die wesentliche Intention Moores ist, die Grundfragen der Ethik zu beantworten:
1. Was bedeutet gut?
2. Welche Dinge sind gut an sich?
3. Welche Handlungen als Mittel zum Guten sollen wir tun?
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 FRANZ BRENTANO - Intuition als Ursprung sittlicher Erkenntnis
- 2.1 Die Intention der Ethik
- 2.2 Der Ursprung des Guten und des Wahren
- 2.3 Moralische Entscheidungskriterien
- 2.3.1 Das oberste Sittengesetz
- 2.3.2 Sekundäre moralische Regeln
- 3 G. E. MOORE - Die Prinzipien der Ethik
- 3.1 Der naturalistische Fehlschluss
- 3.2 Welche Dinge sind gut an sich?
- 3.3 Was sollen wir tun?
- 3.3.1 Welche Dinge sind gut als Mittel?
- 3.3.2 Die Regeln des Common sense
- 4 W. D. ROSS - Intuition als moralisches Risiko
- 4.1 Der Konflikt der Pflichten
- 4.2 Prima facie Pflichten
- 4.3 Die Rolle der Reflexion
- 5 ROBERT AUDI - Intuitionismus als Form des Reflexionismus
- 5.1 Der ethische Intuitionismus nach ROSS
- 5.2 Systematisierung der Intuitionen
- 5.2.1 Zwei Arten von Selbstevidenz
- 5.2.2 Zwei Arten von Rechtfertigung
- 5.3 Ethischer Reflexionismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Ansätze des ethischen Intuitionismus, insbesondere die Beiträge von Brentano, Moore, Ross und Audi. Ziel ist es, die Grundgedanken dieser Autoren darzustellen, zu vergleichen und allgemeine Probleme des ethischen Intuitionismus aufzuzeigen.
- Der ethische Intuitionismus und seine verschiedenen Ausprägungen
- Vergleichende Analyse der Ansätze von Brentano, Moore, Ross und Audi
- Die Rolle der Intuition in der moralischen Erkenntnis
- Der Konflikt zwischen Intuition und Utilitarismus
- Methodologische Fragen des ethischen Intuitionismus
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des ethischen Intuitionismus ein und beschreibt ihn als eine Klasse erkenntnistheoretischer Auffassungen, die Moralurteilen und -prinzipien objektive moralische Eigenschaften zugrunde legen, die unmittelbar erkennbar sind. Sie skizziert die historische Entwicklung des Intuitionismus, von der Lehre des moral sense im 18. Jahrhundert bis zur Erneuerung im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, insbesondere im Kontext der Auseinandersetzung mit dem Utilitarismus. Der einleitende Abschnitt hebt die Bedeutung der Beiträge von Brentano, Moore, Ross und Audi hervor und kündigt den vergleichenden Ansatz der Arbeit an.
2 FRANZ BRENTANO - Intuition als Ursprung sittlicher Erkenntnis: Dieses Kapitel behandelt Brentanos Wertethik, die stark von deskriptiv-psychologischen Methoden geprägt ist und utilitaristische Aspekte integriert. Brentano unterscheidet drei Klassen psychischer Phänomene: Vorstellungen, Urteile und Gemütsbewegungen. Er argumentiert, dass moralische Urteile auf einer intuitiven Erkenntnis von Richtigkeit und Verbindlichkeit beruhen, vergleichbar mit der Einsicht in logischen Prinzipien. Der Fokus liegt auf der Bestimmung des letzten Zwecks menschlichen Handelns und der Auswahl des besten erreichbaren Ziels als moralisches Entscheidungskriterium. Brentano sucht nach einem natürlichen Sittengesetz, nicht im Sinne angeborener Vorschriften, sondern als Fähigkeit zur intuitiven Erkenntnis moralischer Richtigkeit.
3 G. E. MOORE - Die Prinzipien der Ethik: Dieses Kapitel beschreibt Moores Ansatz, der sich mit den Grundfragen der Ethik auseinandersetzt: Was bedeutet gut? Welche Dinge sind gut an sich? Welche Handlungen sollen wir als Mittel zum Guten tun? Moore verneint die Möglichkeit, "gut" zu analysieren, da es eine einfache, nicht weiter zerlegbare Qualität darstellt. Er betont die Rolle intuitiver, evident einleuchtender Urteile bei der Erkenntnis dessen, was gut an sich ist. Moores Strategie zur Beantwortung der dritten Frage besteht in der genauen Unterscheidung menschlicher Werte und der Rückführung auf den Common sense, um die Problematik zu klären.
4 W. D. ROSS - Intuition als moralisches Risiko: Im Gegensatz zu Moore und beeinflusst von diesem, entwickelt Ross eine intuitionistische Ethik, die sich deutlich vom Utilitarismus entfernt. Zentral ist der Begriff der "prima facie Pflichten", die, obwohl ähnlich mathematischen Axiomen, in moralischen Konfliktsituationen zu widersprüchlichen Entscheidungen führen können. Ross sieht jeden moralischen Entschluss als ein Wagnis, da die Gewichtung der prima facie Pflichten situationsabhängig und nicht immer eindeutig ist. Das Kapitel betont die Komplexität und die Möglichkeit von Konflikten innerhalb des intuitionistischen Systems.
5 ROBERT AUDI - Intuitionismus als Form des Reflexionismus: Audi rekonstruiert und erweitert Ross' Konzeption und sucht nach Wegen, diese mit utilitaristischen Grundsätzen zu vereinbaren. Er versucht, die Überzeugungskraft des Intuitionismus durch den ethischen Reflexionismus zu stärken und ihn gegenüber anderen erkenntnistheoretischen Ansätzen zu verteidigen. Audi arbeitet mit einer Systematisierung von Intuitionen und verschiedenen Arten von Selbstevidenz und Rechtfertigung, um den Intuitionismus zu präzisieren und zu verteidigen.
Schlüsselwörter
Ethischer Intuitionismus, Moralurteil, Moralprinzipien, objektive moralische Eigenschaften, unmittelbare Erkenntnis, Brentano, Moore, Ross, Audi, Utilitarismus, prima facie Pflichten, ethischer Reflexionismus, natürliches Sittengesetz, Wertethik, Common sense.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Ethischer Intuitionismus bei Brentano, Moore, Ross und Audi
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text bietet eine umfassende Übersicht über den ethischen Intuitionismus, indem er die Ansätze von Franz Brentano, G.E. Moore, W.D. Ross und Robert Audi untersucht, vergleicht und kritisch beleuchtet. Er analysiert die Grundgedanken der Autoren, ihre jeweiligen Stärken und Schwächen und beleuchtet allgemeine Probleme des ethischen Intuitionismus.
Welche Autoren werden behandelt?
Der Text konzentriert sich auf vier bedeutende Vertreter des ethischen Intuitionismus: Franz Brentano, G.E. Moore, W.D. Ross und Robert Audi. Die jeweiligen Kapitel sind ihren Beiträgen zum Thema gewidmet.
Was ist ethischer Intuitionismus?
Ethischer Intuitionismus ist eine erkenntnistheoretische Position in der Ethik. Sie geht davon aus, dass moralische Urteile und Prinzipien auf objektiven moralischen Eigenschaften beruhen, die unmittelbar erkennbar sind – also intuitiv erfasst werden können. Der Text untersucht verschiedene Ausprägungen dieser Position.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt verschiedene Facetten des ethischen Intuitionismus, darunter:
- Die verschiedenen Ausprägungen des ethischen Intuitionismus.
- Einen vergleichenden Überblick über die Ansätze von Brentano, Moore, Ross und Audi.
- Die Rolle der Intuition in der moralischen Erkenntnis.
- Den Konflikt zwischen Intuitionismus und Utilitarismus.
- Methodologische Fragen des ethischen Intuitionismus.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in fünf Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, gefolgt von Kapiteln zu Brentano, Moore, Ross und Audi. Jedes Kapitel fasst den jeweiligen Ansatz zusammen und analysiert seine zentralen Aspekte. Zusätzlich enthält der Text ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, die Zielsetzung und die wichtigsten Schlüsselbegriffe.
Welche Rolle spielt die Intuition in den verschiedenen Ansätzen?
Die Rolle der Intuition variiert je nach Autor. Brentano sieht die Intuition als Ursprung sittlicher Erkenntnis, ähnlich der Einsicht in logische Prinzipien. Moore betont die Rolle intuitiver, evident einleuchtender Urteile bei der Erkenntnis des Guten. Ross entwickelt den Begriff der "prima facie Pflichten", die intuitiv erkannt werden, aber in Konfliktsituationen abgewogen werden müssen. Audi versucht, Ross' Ansatz zu systematisieren und mit utilitaristischen Elementen zu verbinden.
Wie wird der Intuitionismus im Text kritisiert oder bewertet?
Der Text präsentiert nicht nur die verschiedenen Ansätze des Intuitionismus, sondern analysiert auch deren Stärken und Schwächen. Insbesondere werden die Probleme im Umgang mit moralischen Konflikten und die methodologischen Herausforderungen des Intuitionismus thematisiert. Ein expliziter Vergleich mit dem Utilitarismus wird ebenfalls vorgenommen.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig für das Verständnis des Textes?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Ethischer Intuitionismus, Moralurteil, Moralprinzipien, objektive moralische Eigenschaften, unmittelbare Erkenntnis, Brentano, Moore, Ross, Audi, Utilitarismus, prima facie Pflichten, ethischer Reflexionismus, natürliches Sittengesetz, Wertethik, Common sense.
- Quote paper
- Nina Strehle (Author), 2002, Die historische Entwicklung des ethischen Intuitionismus im 20. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7577