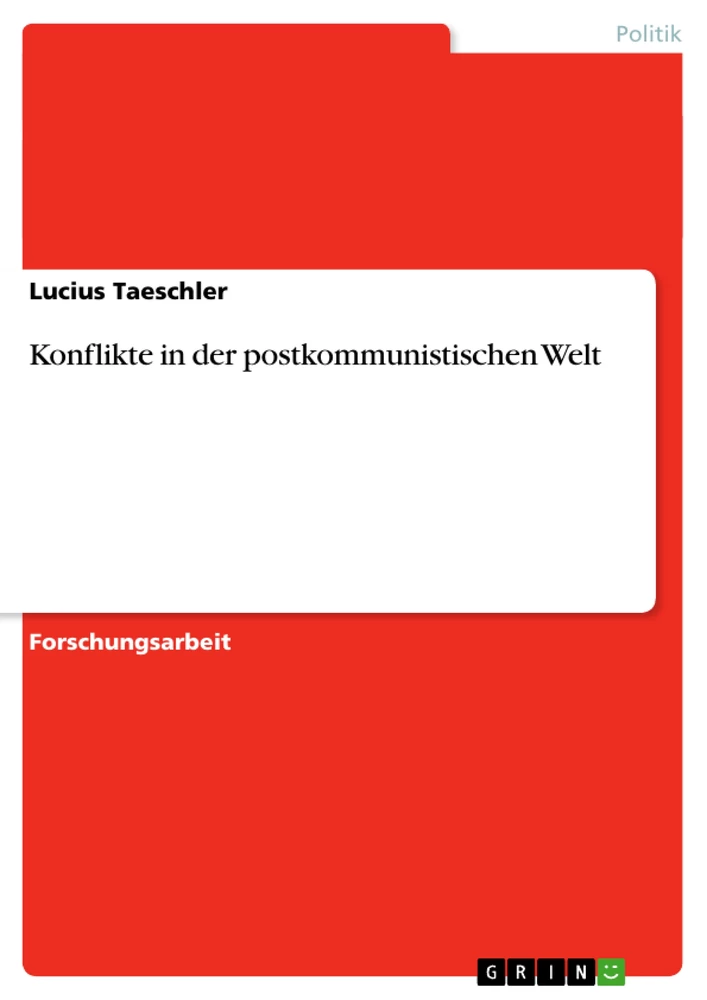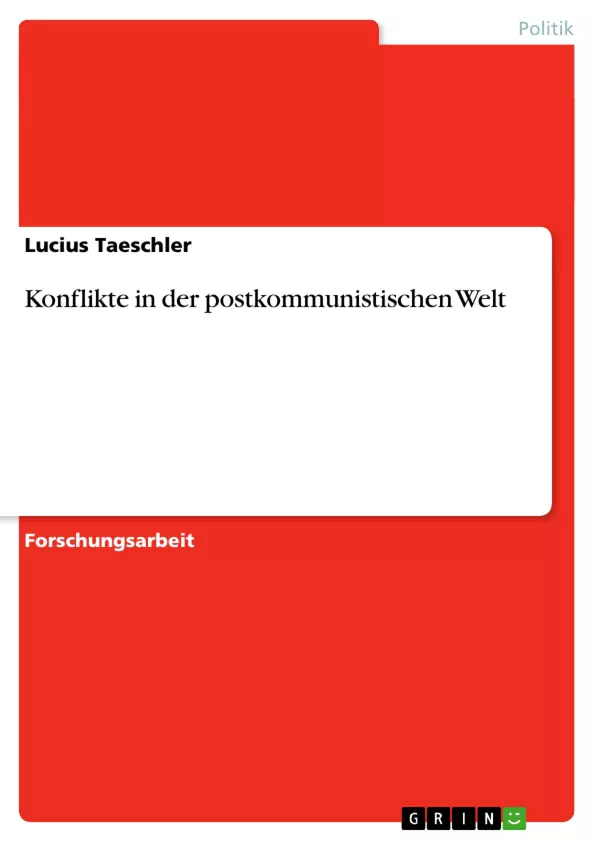Das Ziel dieser Arbeit ist es, die ansonst relativ verallgemeinernden Konflikttheorien auf eine bestimmte Region anzuwenden, indem die bisherigen Erklärungsansätze in ein regionalspezifisches Modell übertragen
werden. Dabei werden die meisten Theorieansätze grob bestätigt: Die bisherigen Erklärungsvariablen - beispielsweise Demokratisierung und ethnische Zusammensetzung - scheinen auch in den postkommunistischen Staaten Einfluss auf das Eintreten eines Bürgerkrieges zu haben. Allerdings werden auch die Schwächen der Ansätze im Hinblick auf diese Region klar. So wurde das Hauptargument der Demokratisierungstheoretiker (z.B. Hegre et al. 2001, Mansfield&Snyder 1995) nicht bestätigt, dass anocracies anfälliger auf Konflikte sind, während Demokratien und Autokratien resistenter sein sollten. Trotzdem hat Demokratie starken Einfluss auf das Eintreten eines bewaffneten Konflikts - jedoch einen linearen: je demokratischer ein Staat, desto kleiner die Chance eines bewaffneten Konflikts. Die Stabilität von Autokratien kann aber nicht bestätigt werden. Wird diese Aussage noch mit der zusätzlichen Bedingung einer radikalen Demokratisierung ergänzt, kann gesagt werden, dass diese beiden Faktoren zusammen einen schnellen, friedlichen Übergang zu einem neuen, stabilen System ermöglichten. Diese Stabilität - oder Konsolidierung - führte dazu, dass die negativen Aspekte der Demokratisierung (beispielsweise die Ausweitung des politischen Spektrums, eine effiziente Entmachtung und Ersetzung der alten Elite sowie die Schwächung der zentralen Autorität) gröosstenteils durch neue Anreizsysteme - beispielsweise gleiche Rechte für alle oder Ausblick auf Teilhabe an ökonomischen Gewinnen - verhindert werden konnten. Auch die ethnischen Argumente der allgemeinen Konflikttheorie müssen in einigen wichtigen Aspekten modifiziert werden, um auf die postkommunistischen Fälle angewendet werden zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie
- Politisch-institutionelle Gründe
- Demokratisierung.
- Power-sharing Institutions
- Soziokulturelle Gründe . .
- Ethnische Heterogenität
- Stärke von ethnischer Gruppen
- Ökonomische Faktoren
- „Nationalstaat-Kultur“
- Politisch-institutionelle Gründe
- Operationalisierung und Datengrundlage
- Untersuchungsanordnung
- Fallzahl und Messzeitpunkte.
- Modelle
- Resultate
- Allgemeine Modellgüte
- Demokratisierung.
- Demokratisierungsgrad.
- Radikalität der Demokratisierung.
- Föderalismus
- Soziokulturelle Gründe
- Ethnische Heterogenität
- Stärke einer Ethnischen Gruppierung.
- Nationalstaat-Kultur.
- Ökonomische Gründe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Ursachen von bewaffneten Konflikten in den postkommunistischen Staaten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Gültigkeit allgemeiner Konfliktforschungstheorien im spezifischen Kontext der postkommunistischen Transformation. Darüber hinaus werden regionsspezifische Faktoren beleuchtet, die einen zusätzlichen Einfluss auf das Auftreten von Konflikten haben könnten.
- Politisch-institutionelle Faktoren
- Soziokulturelle Faktoren
- Ökonomische Faktoren
- Die Rolle der "Nationalstaat-Kultur" im Kontext der postkommunistischen Transformation
- Die empirische Analyse des Einflusses der genannten Faktoren auf das Auftreten von bewaffneten Konflikten in den postkommunistischen Staaten.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den historischen Kontext der postkommunistischen Transformation dar und hebt die unterschiedlichen Entwicklungen in der Region hervor. Sie führt den Leser in das Forschungsfeld der Konfliktforschung im postkommunistischen Kontext ein und verdeutlicht die Notwendigkeit eines multifaktoriellen Ansatzes zur Erklärung von Konflikten in der Region.
- Theorie: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Theorien der Konfliktforschung, die auf die Analyse von Konflikten in den postkommunistischen Staaten angewendet werden können. Es werden politisch-institutionelle, soziokulturelle und ökonomische Faktoren sowie der spezifische Einfluss der "Nationalstaat-Kultur" diskutiert.
- Operationalisierung und Datengrundlage: In diesem Abschnitt werden die verwendeten Variablen, die Datengrundlage und die Operationalisierung der Konzepte definiert. Die Analyse der Variablen umfasst den Demokratisierungsgrad, die Radikalität der Demokratisierung, Power-sharing Institutionen, ethnische Heterogenität, Stärke von ethnischen Gruppen, wirtschaftliche Entwicklung und die "Nationalstaat-Kultur".
- Untersuchungsanordnung: Dieses Kapitel stellt die methodische Vorgehensweise vor, einschließlich der Fallzahl, der Messzeitpunkte und der Modelle, die zur empirischen Analyse verwendet werden.
- Resultate: Die Ergebnisse der empirischen Analyse werden präsentiert. Der Fokus liegt auf der allgemeinen Modellgüte, den Auswirkungen der verschiedenen Variablen (Demokratisierung, Föderalismus, soziokulturelle Faktoren, Nationalstaat-Kultur und ökonomische Gründe) auf das Auftreten von bewaffneten Konflikten in den postkommunistischen Staaten.
Schlüsselwörter
Postkommunistische Transformation, Konflikte, Bürgerkriege, Demokratisierung, Power-sharing Institutionen, ethnische Heterogenität, "Nationalstaat-Kultur", ökonomische Faktoren, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptgründe für Konflikte in postkommunistischen Staaten?
Die Arbeit nennt politisch-institutionelle Faktoren (Demokratisierung), soziokulturelle Gründe (Ethnizität) und ökonomische Faktoren als zentrale Auslöser.
Wie wirkt sich Demokratisierung auf die Konfliktwahrscheinlichkeit aus?
Entgegen herkömmlicher Theorien zeigt die Studie einen linearen Zusammenhang: Je demokratischer ein Staat ist, desto geringer ist die Chance eines bewaffneten Konflikts.
Sind Autokratien in dieser Region stabiler?
Die oft angenommene Stabilität von Autokratien konnte in den postkommunistischen Fällen nicht bestätigt werden.
Welche Rolle spielt die ethnische Zusammensetzung?
Ethnische Heterogenität hat Einfluss, jedoch müssen allgemeine Konflikttheorien modifiziert werden, um auf die spezifische Situation postkommunistischer Staaten zu passen.
Was versteht man unter "Nationalstaat-Kultur"?
Dies beschreibt regionale Besonderheiten und Traditionen der Staatsführung, die den Übergang zu einem stabilen System entweder fördern oder behindern können.
- Citar trabajo
- Lucius Taeschler (Autor), 2007, Konflikte in der postkommunistischen Welt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75617