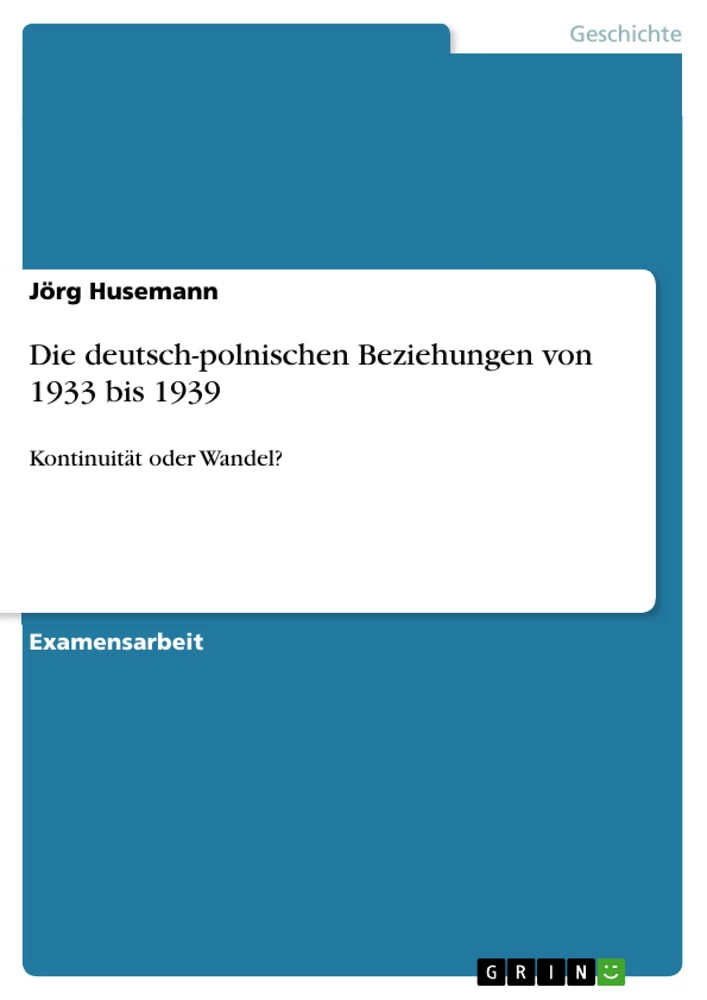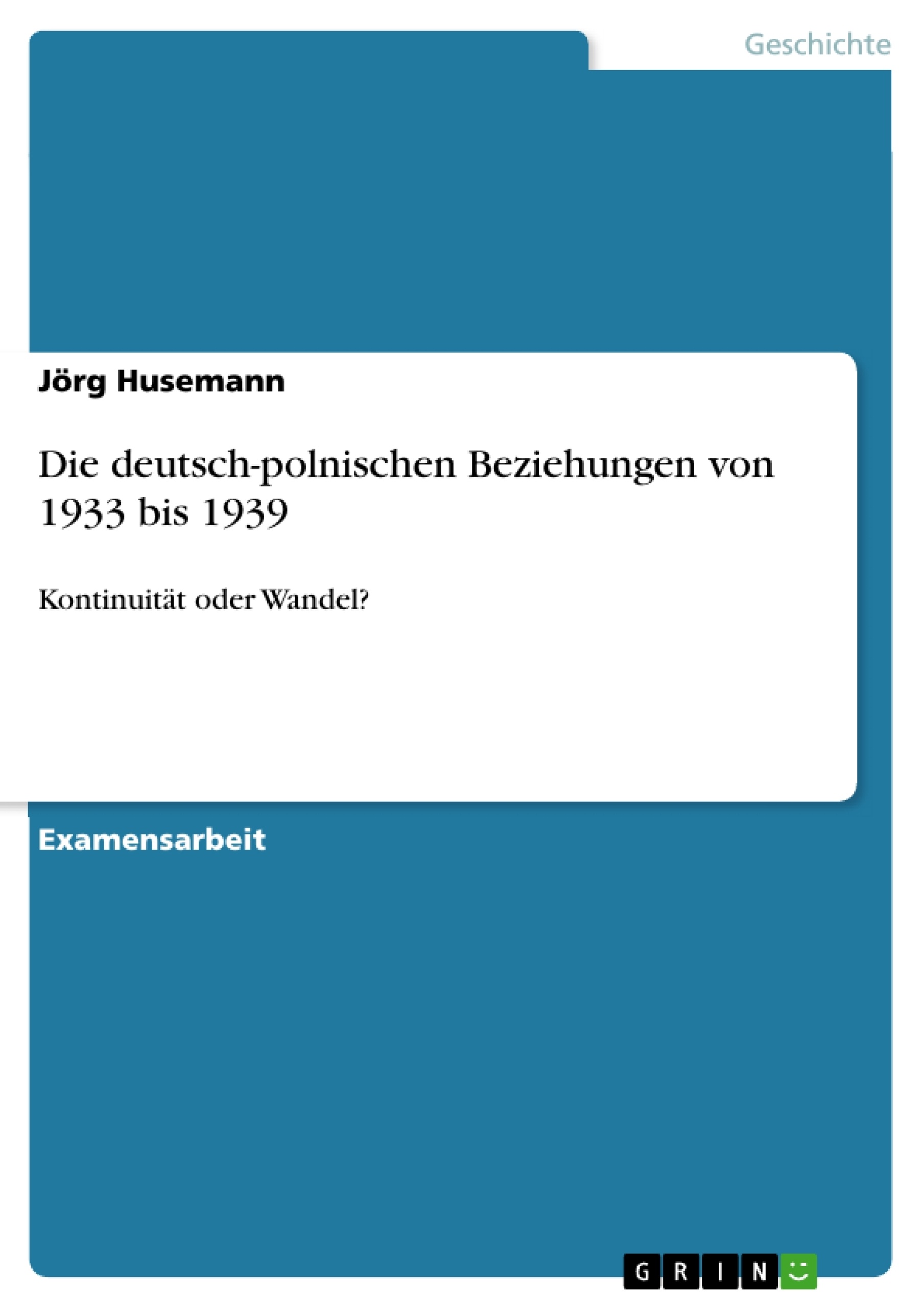Als Warschau und Berlin – knapp ein Jahr nach Ernennung Hitlers zum Reichskanzler – am 26. Januar 1934 die deutsch-polnische Nichtangriffserklärung proklamierten, kam dies einer politischen Sensation gleich. Nach Jahren diffamierender Hetze auf beiden Seiten schien ein Wandel in den gegenseitigen Beziehungen eingetreten zu sein, der für die weitere Zukunft hoffen ließ. Dabei stand der Pakt „augenscheinlich“ im völligen Widerspruch zur Außenpolitik der Weimarer Republik, in der eine derartige deutsch-polnische Verständigung sicherlich nie zur Verwirklichung gekommen wäre.
Im Gegenteil: Die deutschen Machteliten, das Auswärtige Amt und auch die Reichswehr wurden durch diesen außenpolitischen Schritt Hitlers regelrecht „brüskiert“, bestand doch noch bis in die Dreißiger Jahre hinein der Konsens, dass eine gutnachbarschaftliche Beziehung zu Polen nur erreicht werden könnte, wenn Polen einer
Revision seiner Westgrenze zugunsten Deutschlands zustimmen würde. Zuschriften konservativer Kreise an den Reichspräsidenten von Hindenburg drückten vehement ihre starke Besorgnis über Hitlers eingeleitete Annäherung an Polen aus. Dabei hatte diese Gruppe noch vor einem Jahr Hitler in den „Sattel der Regierung“ verholfen.
Doch Hitler, der mit diesem Nichtangriffspakt seinen ersten größeren außenpolitischen Erfolg feiern konnte und damit scheinbar die Kontinuität des Weimarer Revisionismus durchbrochen hatte, setzte sich auch gegen die eigene Parteispitze der NSDAP durch. Welche Vorteile erhoffte er sich aber von diesem Übereinkommen? Und wie kam dieser Pakt überhaupt zustande, der – ursprünglich auf zehn Jahre angelegt – bereits fünf Jahre
später in den Zweiten Weltkrieg mündete? War es Hitlers eiskaltes Kalkül, einen Pakt mit Polen auszuhandeln, den er am Ende doch nicht zu halten gedachte? Oder erhoffte er sich eine wirkliche Aussöhnung mit dem ewigen „Erbfeind“ Polen? Und wie standen die Polen dem Pakt mit Hitlerdeutschland gegenüber? Ahnte man damals in Warschau nicht, dass Hitler bereits den Weg „hin zum Krieg“ beschritt?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Retrospektive: „Eine schwierige Nachbarschaft“.
- Die Polenpolitik des Deutschen Kaiserreiches zwischen Germanisierung und Unterdrückung.
- Polen im Ersten Weltkrieg – zwischen Kollaboration und territorialer Emanzipation.
- Die Polenpolitik der Weimarer Republik zwischen Revision und Unterdrückung.
- Die deutschen Ziele gegenüber Polen 1918-1932.
- Die polnischen Ziele gegenüber Deutschland 1918-1932.
- Das Dritte Reich und Polen Zwischen Krisen und Entspannung.
- Die Phase vom 30. Januar 1933 bis zu Hitlers „Friedensrede“ am 17. Mai 1933.
- Hitlers Einstellung zu Polen.
- Die polnische Politik in Reaktion auf Hitlers Machtergreifung 1933.
- Der Fall Danzig und die „Westerplattenaffäre“ vom März 1933.
- Die These von Piłsudskis Präventivkrieg gegen Deutschland.
- Die Phase von Hitlers „Friedensrede“ am 17. Mai 1933 bis zum deutsch-polnischen Nichtangriffspakt 1934.
- Hitlers und von Neuraths Bemühungen um einen deutsch-polnischen Ausgleich.
- Die deutsch-polnischen Verhandlungen über einen Nichtangriffspakt.
- Das deutsche Paktmuster und dessen polnischer Gegenentwurf.
- Erstes Streitthema der Verhandlungen: „Die Schiedsgerichtsbarkeit“.
- Zweites Streitthema der Verhandlungen: „Die Souveränitätsklausel und der Minderheitenschutz“.
- Drittes Streitthema der Verhandlungen: „Die Nichtberührung anderer Verträge“.
- Die Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nichtangriffsabkommens am 26. Januar 1934.
- Die Phase nach dem deutsch-polnischen Nichtangriffspakt von 1934 bis zur Verschärfung der Gegensätze im Frühjahr 1939.
- Die Benutzung des Abkommens durch das Deutsche Reich.
- Die Benutzung des Abkommens durch Polen.
- Der Auftrag Görings als „Sonderemissionär“.
- Piłsudskis Tod und die Politik seiner Nachfolger.
- Der Beginn des deutsch-polnischen Konfliktes von Oktober 1938 bis zum Januar 1939.
- Die Phase vom Frühjahr 1939 „hin zum Krieg“.
- Die Kündigung der deutsch-polnischen Nichtangriffserklärung vom April 1939.
- Der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt vom August 1939 und die erneute Teilung Polens.
- Der deutsche Überfall auf Polen.
- Die Phase vom 30. Januar 1933 bis zu Hitlers „Friedensrede“ am 17. Mai 1933.
- Exkurs: Polen im Spiegel der nationalsozialistischen Presse.
- Der „Völkische Beobachter“
- Das Polenbild des „Völkischen Beobachters“ 1932 bis Januar 1934.
- Das Polenbild des „Völkischen Beobachters“ 1934 bis September 1939.
- Kriegspropaganda im „Völkischen Beobachter“ 1939.
- Der Kladderadatsch.
- Das Polenbild des „Kladderadatsch“ von 1932 bis 1939 in Karikaturen.
- Der „Völkische Beobachter“
- Schlussbemerkungen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die deutsch-polnischen Beziehungen von 1933 bis 1939, wobei der Fokus auf der Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Dritten Reich und Polen liegt. Sie befasst sich mit der Frage, ob es in dieser Zeitspanne zu einer tatsächlichen Veränderung der Beziehungen kam oder ob eher Kontinuität zu beobachten ist. Die Arbeit untersucht dabei die politischen Strategien und Ziele beider Staaten, die jeweiligen Reaktionen auf die Machtergreifung Hitlers und die Bedeutung des deutsch-polnischen Nichtangriffspaktes von 1934.
- Die Rolle des „Völkischen Beobachters“ und des „Kladderadatsch“ in der nationalsozialistischen Propaganda
- Die Bedeutung des deutsch-polnischen Nichtangriffspaktes von 1934
- Die Vorgeschichte der deutsch-polnischen Beziehungen
- Die politischen Strategien und Ziele Deutschlands und Polens
- Die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die deutsch-polnischen Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die historische Bedeutung des deutsch-polnischen Nichtangriffspaktes von 1934 und stellt die Forschungsfrage nach der Kontinuität oder dem Wandel in den Beziehungen zwischen Deutschland und Polen von 1933 bis 1939. Kapitel 2 befasst sich mit der Vorgeschichte der deutsch-polnischen Beziehungen, beginnend mit der Polenpolitik Preußens, des Deutschen Kaiserreiches und der Weimarer Republik. Kapitel 3 behandelt die deutsch-polnischen Beziehungen unter der Herrschaft des Dritten Reiches, eingeteilt in verschiedene Phasen, die durch Krisen, Konflikte, Friedenshoffnungen und Verständigungswillen geprägt waren. Der Exkurs in Kapitel 4 beleuchtet die Rolle der nationalsozialistischen Presse, insbesondere des „Völkischen Beobachters“ und des „Kladderadatsch“, in der Darstellung Polens. Die Schlussbemerkungen fassen die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den deutsch-polnischen Beziehungen, dem Dritten Reich, Hitler, Polenpolitik, Nichtangriffspakt, nationalsozialistische Propaganda, „Völkischer Beobachter“, „Kladderadatsch“, Revisionismus, Kontinuität, Wandel.
- Quote paper
- Jörg Husemann (Author), 2007, Die deutsch-polnischen Beziehungen von 1933 bis 1939, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74776