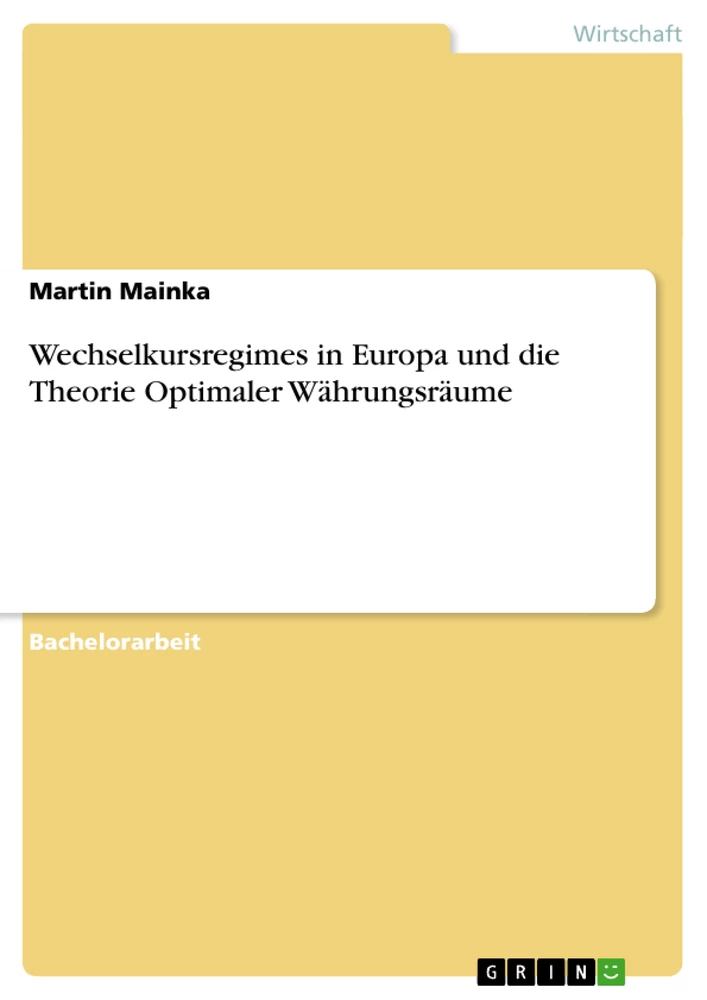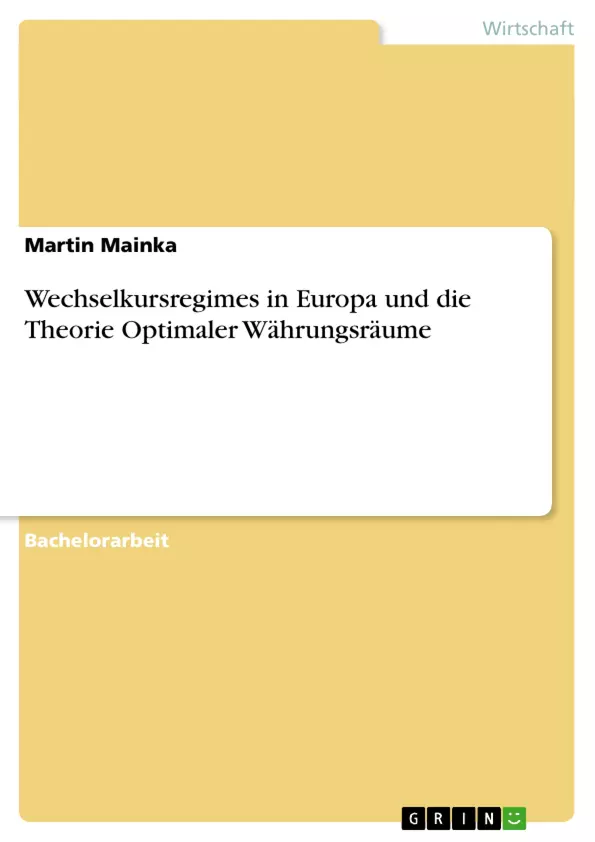1. Einleitung
„Es gibt kein feineres und kein sicheres Mittel, die bestehenden Grundlagen
der Gesellschaft umzustürzen, als die Vernichtung der Währung.“
John Maynard Keynes 1920
Am 1. Januar 1999 schlugen 11 Mitgliedsländer der Europäischen Union (EU) mit der Einführung des Euro den Weg zu einer gemeinsamen Währung ein. Damit wurde gleichzeitig ein neues Kapitel in den Integrationsbemühungen Europas, das bereits mit der 1951 gegründeten Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montanunion) begann, aufgeschlagen. Inzwischen umfasst die EU, nach den jüngsten Beitritten Bulgariens und Rumäniens am 1.1.2007, 27 Mitgliedsstaaten und der Euro wurde in nunmehr 13 Ländern als das gesetzliche Zahlungsmittel fest etabliert. Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU), die als ein kühnes und visionäres Experiment begann, ist heute mit 457 Millionen Einwohnern der größte Binnenmarkt der Welt. Was steckt hinter diesem ehrgeizigen und auf den ersten Blick durchaus erfolgreich erscheinenden Projekt? Kaum ein anderes Vorhaben in der europäischen Geschichte hat derart große Kontroversen ausgelöst. Kritiker der Europäischen Währungsunion (EWU) sehen die Stabilität der bisherigen Integration Europas als gefährdet an. Die Bedenken stützen sich dabei überwiegend auf die Annahme, dass die EU keinen „optimalen Währungsraum“ darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wechselkurssysteme in Europa und der Weg zur Europäischen Einheitswährung
- 2.1. Das „Bretton-Woods-System“
- 2.2. Der „Werner-Plan“ und die „Währungsschlange“
- 2.3. Das Europäische Währungssystem
- 2.4. Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion
- 3. Die Theorie optimaler Währungsräume
- 3.1. Traditionelle Ansätze
- 3.1.1. Der Ansatz von Mundell und das Kriterium der Faktormobilität
- 3.1.2. Der Ansatz von McKinnon und das Kriterium der Offenheit einer Volkswirtschaft
- 3.1.3. Der Ansatz von Kenen und das Kriterium der Diversifikation
- 3.2. Neuere Theorien: Kosten und Nutzen einer Währungsunion
- 3.2.1. Kostenkriterien
- 3.2.2. Nutzenkriterien
- 3.2.3. Kosten-Nutzen-Analyse
- 3.3. Empirische Evidenzen für Europa
- 3.3.1. Die Europäische Währungsunion hinsichtlich traditioneller und neuer Theorien
- 3.3.2. Endogenität der Kriterien
- 3.3.3. Ist Europa ein optimaler Währungsraum?
- 4. Fazit und Ausblick
- Entwicklung von Wechselkursregimes in Europa
- Analyse der traditionellen und neueren Theorien optimaler Währungsräume
- Empirische Evidenz der Kriterien für einen optimalen Währungsraum im Kontext Europas
- Bewertung der Europäischen Währungsunion im Lichte der Theorie optimaler Währungsräume
- Diskussion der Kosten und Nutzen einer Währungsunion
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Relevanz und den Hintergrund der Europäischen Währungsunion sowie die kritischen Stimmen zu ihrer Optimalität dar.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung von Wechselkursregimes in Europa, beginnend mit dem Bretton-Woods-System bis hin zur Errichtung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU).
- Kapitel 3: Im Fokus dieses Kapitels stehen die wichtigsten traditionellen und neueren Theorien optimaler Währungsräume. Dabei werden die Kriterien, die den Verzicht auf den Wechselkurs als Anpassungsinstrument rechtfertigen, sowie die Kosten und Nutzen einer Währungsunion untersucht.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit analysiert die Entwicklung Europas hin zu einem gemeinsamen Währungsraum mit einer einheitlichen Währung, dem Euro. Die Arbeit befasst sich mit der „Theorie optimaler Währungsräume“ und untersucht, inwiefern ihre Kriterien auf Europa zutreffen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Wechselkursregimes, Europäische Währungsunion, Theorie optimaler Währungsräume, Faktormobilität, Kosten und Nutzen einer Währungsunion, empirische Evidenz, Endogenität, und die Optimalität des europäischen Währungsraums.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Theorie optimaler Währungsräume?
Sie untersucht die Kriterien, unter denen es für Länder vorteilhaft ist, ihre eigene Währung aufzugeben und einer Währungsunion beizutreten.
Welches Kriterium stammt von Robert Mundell?
Mundell betonte die Faktormobilität (insbesondere der Arbeit), um asymmetrische Schocks innerhalb einer Währungsunion auszugleichen.
Ist die Europäische Union ein optimaler Währungsraum?
Kritiker bezweifeln dies, da die Kriterien wie Faktormobilität oder fiskalische Transfers in der EU nicht im selben Maße wie in Nationalstaaten erfüllt sind.
Was sind die Kosten einer Währungsunion?
Der größte Nachteil ist der Verlust des Wechselkurses als Instrument zur Anpassung bei wirtschaftlichen Krisen einzelner Mitgliedsländer.
Wie entwickelten sich die Wechselkurssysteme in Europa?
Die Arbeit zeichnet den Weg vom Bretton-Woods-System über die „Währungsschlange“ und das EWS bis hin zur Einführung des Euro nach.
- Citation du texte
- Martin Mainka (Auteur), 2007, Wechselkursregimes in Europa und die Theorie Optimaler Währungsräume, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74579