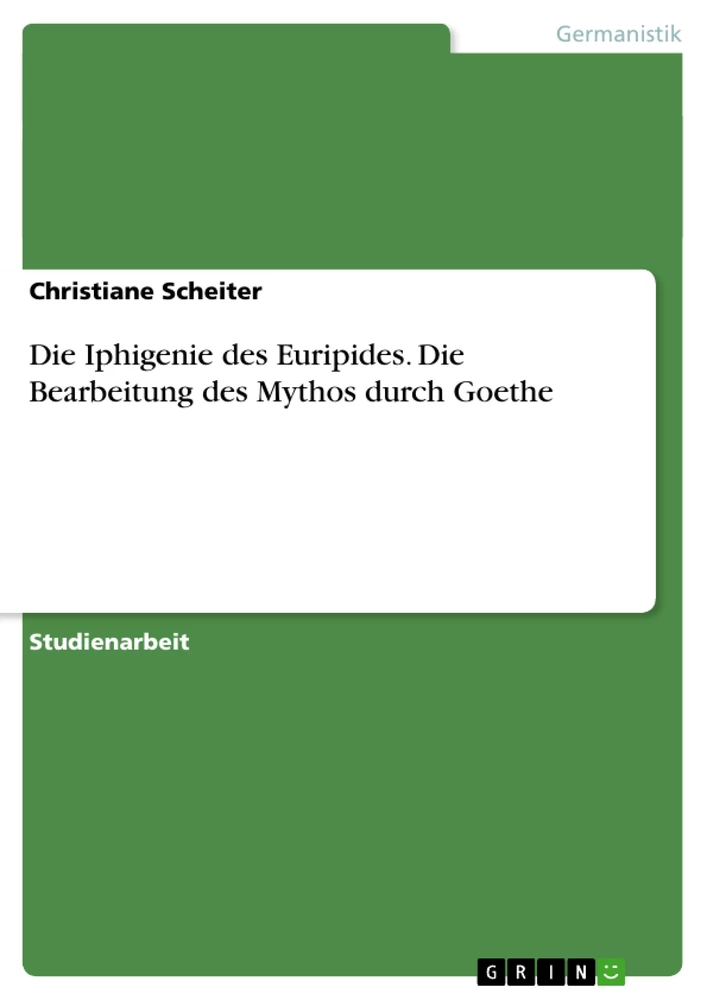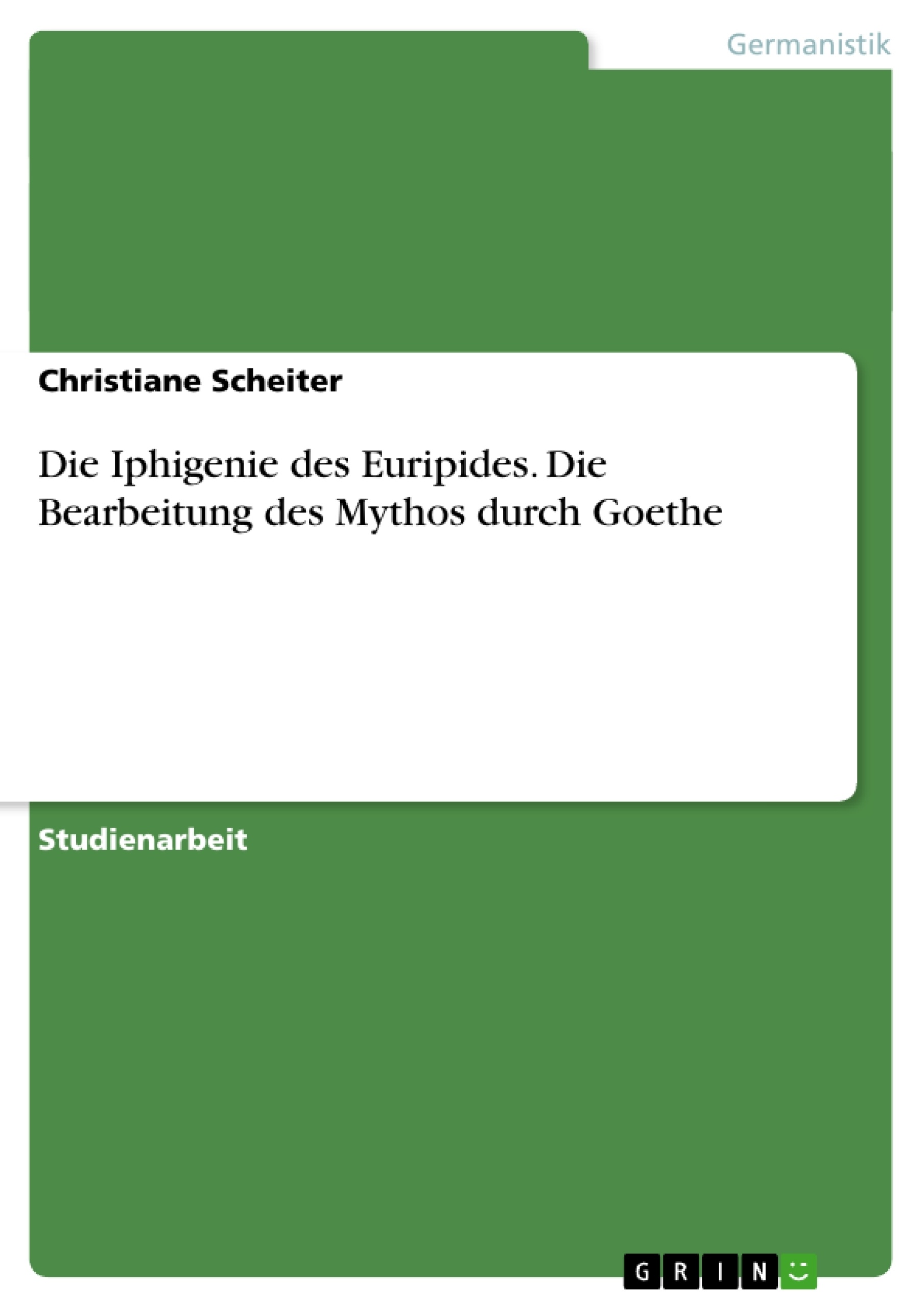Goethe griff mit Iphigenie auf einen antiken Stoff zurück, hinzu kam als besondere Grundlage die dramatische Gestaltung durch Euripides. In einem Punkt stimmt die Forschung in ihren Meinungen überein: „In doppelter Weise ist in Goethes Werk der Euripideische Hintergrund ständig bemerkbar, sei es als Ausgangspunkt oder als Gegensatzfolie.“ Aufgrund des großen Zeitabstandes zwischen der Vorlage des Euripides (412 v. Chr.) und der Bearbeitung des Stoffs durch Goethe (1773-1786), ist es für das Verständnis von Goethes Werk interessant, es mit der Vorlage zu vergleichen. Es muss also um das Aufzeigen von Veränderungen gehen, denn „bei der Schlußredaktion der Iphigenie orientiert er sich […] an Euripides.“
Deshalb gilt es zu beweisen, welche Abwandlungen Goethe vornimmt und inwiefern die Vorlage ihn beeinflusst hat. Aus diesem Grund muss man die Frage stellen: Inwieweit bemerkbar wird, dass sich Goethes Iphigenie auf Tauris an der Euripides Iphigenie bei den Taurern orientiert hat?
In dieser Arbeit soll zuerst der Entstehungsgeschichtliche Hintergrund Goethes und Euripides Iphigenie näher beleuchtet werden, womit das Verhältnis der beiden Werke zueinander klar wird. Weiterhin soll deutlich werden, dass nicht erst in Goethes Iphigenie ein humanisierender Aspekt zum Vorschein kommt, sondern dieser schon in der Antiken Vorlage bemerkbar war, wenn auch noch nicht so ausgeprägt wie bei Goethe. Auch die inhaltliche, formelle und stilistische Annährung an das Original soll hier betrachtet werden. Fast noch größer als die Gemeinsamkeiten sind jedoch die Unterschiede zwischen den beiden Versionen. Dazu gehören vor allem die inhaltlichen Veränderungen, die Goethe in Abweichung der Vorlage vorgenommen hat. Anhand von zahlreichen Beispielen aus den beiden Primärtexten wird dies veranschaulicht dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Euripides Iphigenie - Abänderungen durch Goethe
- Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund
- Ideal der antiken Literatur
- Humanitätsideal
- Inhalt, Form und Stil
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bearbeitung des Iphigenie-Mythos durch Goethe und untersucht die Veränderungen, die er im Vergleich zu Euripides' Vorlage vorgenommen hat. Die Untersuchung konzentriert sich auf den Entstehungsgeschichtlichen Hintergrund beider Werke, das Ideal der antiken Literatur, insbesondere das Humanitätsideal, sowie die inhaltlichen, formalen und stilistischen Unterschiede zwischen den beiden Versionen.
- Entstehungsgeschichte und Verhältnis der beiden Werke
- Humanitätsideal in Goethes und Euripides' Iphigenie
- Inhaltliche Veränderungen durch Goethe
- Formelle und stilistische Aspekte der beiden Versionen
- Einfluss des antiken Stoffes auf Goethes Werk
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und skizziert den Forschungsstand zum Verhältnis von Goethes und Euripides' Iphigenie. Sie betont die Bedeutung des Vergleichs beider Werke und die Frage nach den Veränderungen, die Goethe im Vergleich zur Vorlage vorgenommen hat.
2. Euripides Iphigenie – Abänderungen durch Goethe
2.1 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund
Dieser Abschnitt beleuchtet den Entstehungsgeschichtlichen Hintergrund beider Werke und analysiert Goethes Auseinandersetzung mit der antiken Vorlage. Er zeigt, wie Goethe die griechische Tragödie sowohl im formalen Aufbau als auch in der Abfolge der dramatischen Ereignisse als Vorbild nutzt, gleichzeitig aber ein eigenständiges Werk schafft.
2.2 Ideal der antiken Literatur
2.2.1 Humanitätsideal
Dieser Abschnitt untersucht das Humanitätsideal, das in Euripides' Werk und in Goethes Iphigenie zum Ausdruck kommt. Es wird gezeigt, dass bereits in der antiken Vorlage ein humanisierender Aspekt zu erkennen ist, der jedoch in Goethes Version noch stärker ausgeprägt ist.
2.2.2 Inhalt, Form und Stil
Dieser Abschnitt analysiert die inhaltlichen, formalen und stilistischen Unterschiede zwischen Goethes und Euripides' Iphigenie. Es werden zahlreiche Beispiele aus den beiden Primärtexten herangezogen, um die Veränderungen aufzuzeigen, die Goethe im Vergleich zur Vorlage vorgenommen hat.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind die antike Literatur, insbesondere Euripides' Iphigenie, Goethes Bearbeitung des Stoffes, die Entstehung der Iphigenie auf Tauris, das Humanitätsideal, die vergleichende Analyse von Texten, die Dramaturgie, die Veränderung des Mythos, sowie die Rezeption und die Bedeutung der Iphigeniegestalt in der Literatur.
- Quote paper
- Christiane Scheiter (Author), 2007, Die Iphigenie des Euripides. Die Bearbeitung des Mythos durch Goethe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74049