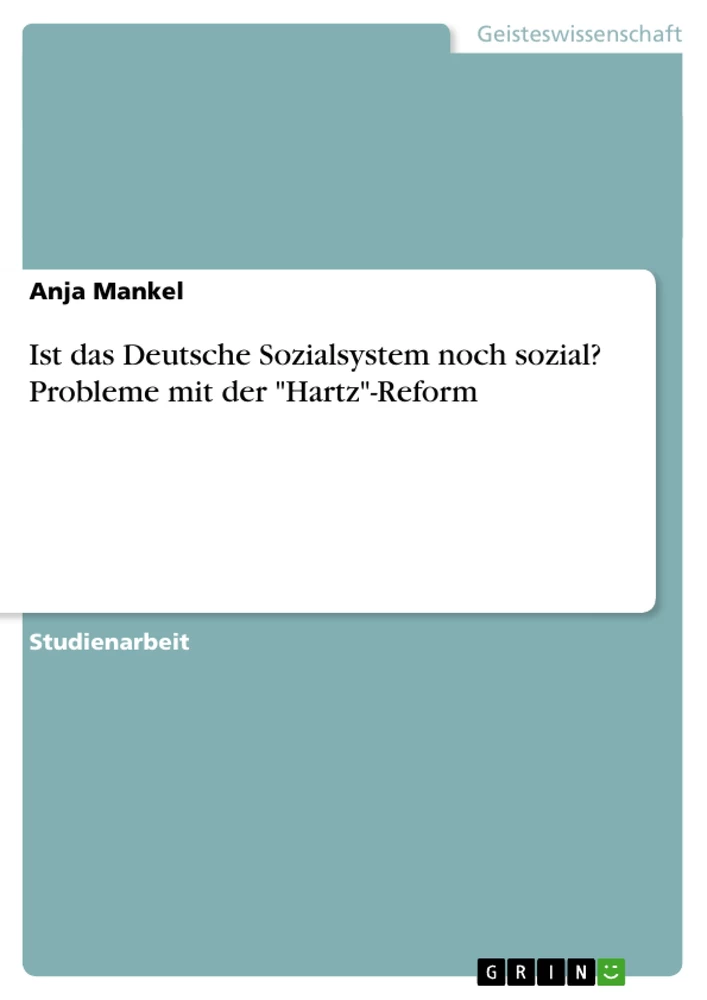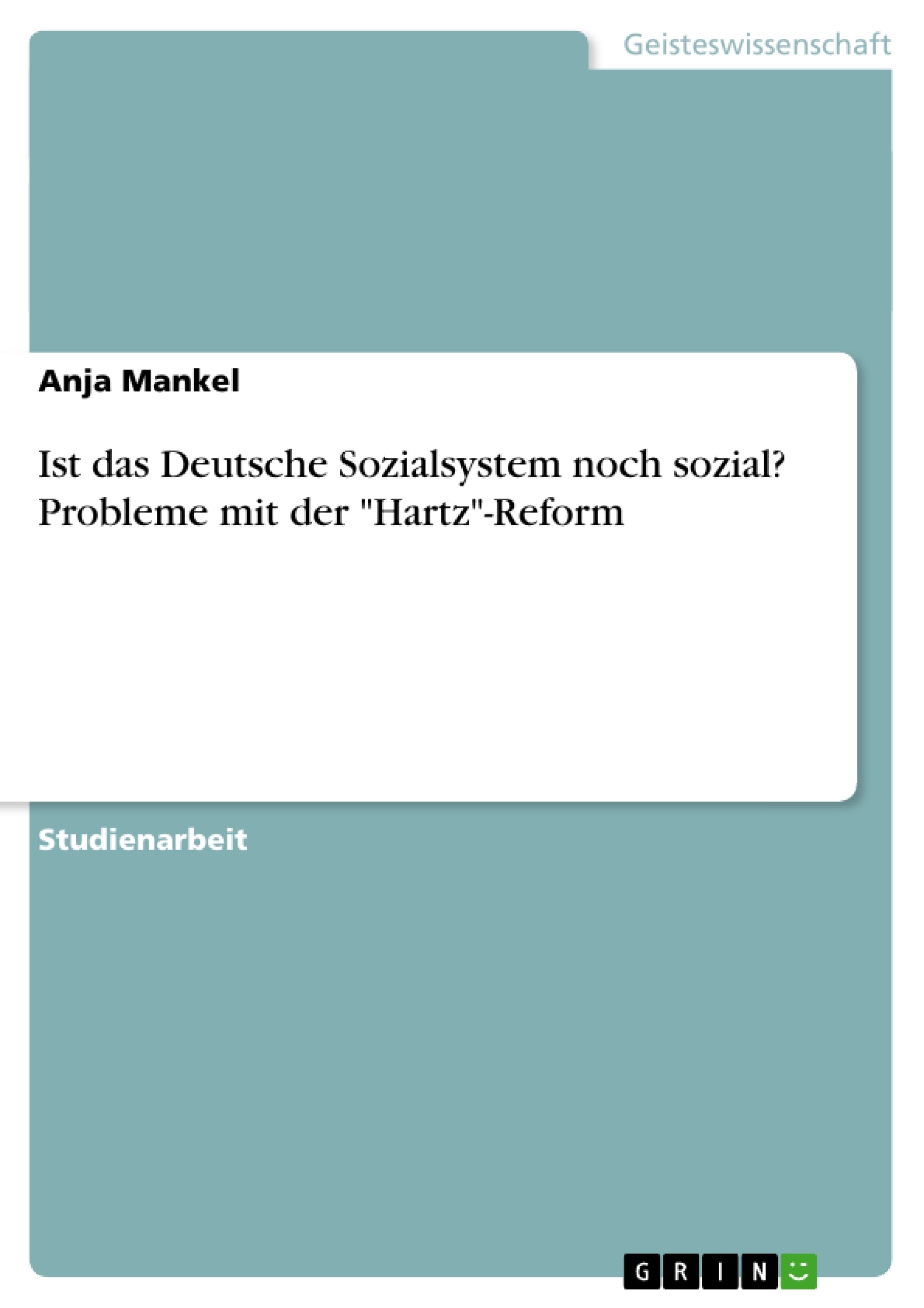Wenn man den Aufwand und die mit diesem Sicherungssystem verbundenen Probleme betrachtet, kann die Frage aufkommen, ob es überhaupt Aufgabe des Staates ist, für ein Einkommen der Menschen zu sorgen? Ist damit nicht der „deutsche Sozialstaat zum allumfassenden Versorgungsstaat geworden“?
Es kommt die Frage auf, ob dieses System der sozialen Versicherung überhaupt noch ein Gerechtes und Soziales genannt werden kann, wenn regulierend eingegriffen wird, und die Verteilungsmacht der Leistungen beim Staat liegt. Wenn „Beplanung und Bevormundung“ stattfindet und die persönliche Freiheit gegen die finanzielle Sicherheit eingetauscht wird.
Wenn der finanzielle Druck auf die Arbeitslosen steigt und sie gezwungen sind, Tätigkeiten mit einer „Aufwandsentschädigung“ von einem Euro pro Stunde anzunehmen, da sonst eine Kürzung der Leistungen droht. Sollte nicht vielmehr eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln in den Vordergrund gerückt werden?
Auf all diese Fragen kann hier nicht erschöpfend eingegangen werden, doch soll der Konflikt, der durch die Schaffung der neuen Leistung Arbeitslosengeld II durch die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe entstanden ist, aufgezeigt und diskutiert werden.
Es stellt sich also die Frage, ob dieses System noch sozial verträglich ist, oder ob es auf Dauer unsere wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage verschlechtert, wenn die Einnahmeverluste auf der „Steuer- und Beitragsseite die Basis der Leistungssysteme schwächen“ und so durch das „Massenphänomen“ Arbeitslosigkeit die „Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit der Versicherung“ steigt und auf der anderen Seite Empfänger von ALG II in der Gesellschaft stigmatisiert werden, da „das Einverständnis der Bevölkerung […] die diese Leistungen finanziert“ nicht immer gegeben ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau des staatlichen Sicherungssystems
- Das Versicherungsprinzip
- Gliederung der Arbeitslosenversicherung
- Ist der „Sozialstaat“ noch sozial?
- Begriffsbestimmung: Was ist sozial?
- Zusammenlegung wohlfahrtsstaatlicher Prinzipien
- Wirtschaftliche Probleme
- Gesellschaftliche/soziale Probleme
- Rechtliche Probleme
- Zusammenfassung und Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob das deutsche Sozialsystem angesichts der Hartz-IV-Reform noch als sozial bezeichnet werden kann. Sie analysiert den Aufbau des staatlichen Sicherungssystems und beleuchtet kritische Aspekte der aktuellen Situation.
- Aufbau und Prinzipien des deutschen Sozialversicherungssystems
- Die Problematik der Hartz-IV-Reform und ihre Auswirkungen
- Die Vereinbarkeit von Solidaritäts- und Fürsorgeprinzipien im aktuellen System
- Wirtschaftliche und soziale Folgen des Sozialsystems
- Rechtliche Herausforderungen des Sozialsystems
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert den historischen Kontext des deutschen Sozialversicherungssystems, beginnend mit seiner Einführung im 19. Jahrhundert als Reaktion auf die Industrialisierung und Verarmung. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der sozialen Tragfähigkeit des heutigen Systems im Kontext der Hartz-IV-Reform und der damit verbundenen Probleme.
Aufbau des staatlichen Sicherungssystems: Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau des deutschen Sozialversicherungssystems, welches sich in die Bereiche Arbeitslosen-, Pflege-, Kranken-, Renten- und Unfallversicherung gliedert und auf den Prinzipien Versicherung, Versorgung und Fürsorge basiert. Es wird das Versicherungsprinzip detailliert erläutert, welches sich hauptsächlich durch Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber finanziert. Die Ausnahme bildet das Arbeitslosengeld II, welches aus Steuermitteln finanziert wird. Das Kapitel beleuchtet auch das Solidaritätsprinzip und seine Abgrenzung zum Äquivalenzprinzip in der Rentenversicherung.
Ist der „Sozialstaat“ noch sozial?: Dieses Kapitel analysiert kritisch, ob das deutsche Sozialsystem angesichts bestehender Probleme noch als sozial bezeichnet werden kann. Es untersucht wirtschaftliche Herausforderungen wie die Belastung der Arbeitslosen durch niedrige Aufwandsentschädigungen und die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit der Versicherungssysteme aufgrund von Einnahmeverlusten. Des Weiteren werden gesellschaftliche Probleme wie die Stigmatisierung von ALG-II-Empfängern und die Frage nach der Vermischung von Solidaritäts- und Fürsorgeprinzipien im Kontext der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe erörtert. Schließlich werden rechtliche Aspekte beleuchtet, die sich aus den Reformen ergeben.
Schlüsselwörter
Sozialstaat, Hartz-IV-Reform, Sozialversicherungssystem, Arbeitslosenversicherung, Solidaritätsprinzip, Fürsorgeprinzip, Wirtschaftliche Probleme, Gesellschaftliche Probleme, Rechtliche Probleme, soziale Gerechtigkeit.
FAQ: Analyse des deutschen Sozialsystems nach der Hartz-IV-Reform
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das deutsche Sozialversicherungssystem und untersucht kritisch, ob es angesichts der Hartz-IV-Reform noch als „sozial“ bezeichnet werden kann. Sie beleuchtet den Aufbau des Systems, seine Prinzipien und die damit verbundenen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und rechtlichen Probleme.
Welche Aspekte des Sozialsystems werden untersucht?
Die Analyse umfasst den Aufbau des staatlichen Sicherungssystems (Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung), die Prinzipien des Versicherungssystems (Solidarität, Fürsorge, Äquivalenz), die Auswirkungen der Hartz-IV-Reform, wirtschaftliche Herausforderungen (z.B. Belastung der Arbeitslosen, Zahlungsfähigkeit der Systeme), gesellschaftliche Probleme (z.B. Stigmatisierung von ALG-II-Empfängern) und rechtliche Aspekte der Reformen.
Welche zentralen Fragen werden gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Ist der deutsche Sozialstaat nach der Hartz-IV-Reform noch sozial? Weitere wichtige Fragen betreffen die Vereinbarkeit von Solidaritäts- und Fürsorgeprinzipien, die Auswirkungen niedriger Aufwandsentschädigungen für Arbeitslose und die Folgen der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Aufbau des staatlichen Sicherungssystems, ein Kapitel zur kritischen Analyse der Sozialität des Systems und eine Zusammenfassung/Schlussfolgerung. Zusätzlich werden die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie eine Kapitelzusammenfassung bereitgestellt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Sozialstaat, Hartz-IV-Reform, Sozialversicherungssystem, Arbeitslosenversicherung, Solidaritätsprinzip, Fürsorgeprinzip, Wirtschaftliche Probleme, Gesellschaftliche Probleme, Rechtliche Probleme, soziale Gerechtigkeit.
Welche Prinzipien des Sozialversicherungssystems werden erläutert?
Die Arbeit erläutert das Versicherungsprinzip (hauptsächlich finanziert durch Beiträge von Versicherten und Arbeitgebern), das Solidaritätsprinzip und das Äquivalenzprinzip (insbesondere im Kontext der Rentenversicherung) sowie das Fürsorgeprinzip.
Welche Probleme werden im Zusammenhang mit der Hartz-IV-Reform behandelt?
Die Arbeit behandelt die wirtschaftlichen Probleme (z.B. niedrige Aufwandsentschädigungen, finanzielle Belastung der Systeme), die gesellschaftlichen Probleme (z.B. Stigmatisierung von ALG-II-Empfängern) und die rechtlichen Herausforderungen, die sich aus der Reform ergeben haben.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen werden in einem separaten Kapitel zusammengefasst. Der genaue Inhalt der Schlussfolgerung ist aus dem vorliegenden Textfragment nicht vollständig ersichtlich.
- Quote paper
- Anja Mankel (Author), 2006, Ist das Deutsche Sozialsystem noch sozial? Probleme mit der "Hartz"-Reform, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73489